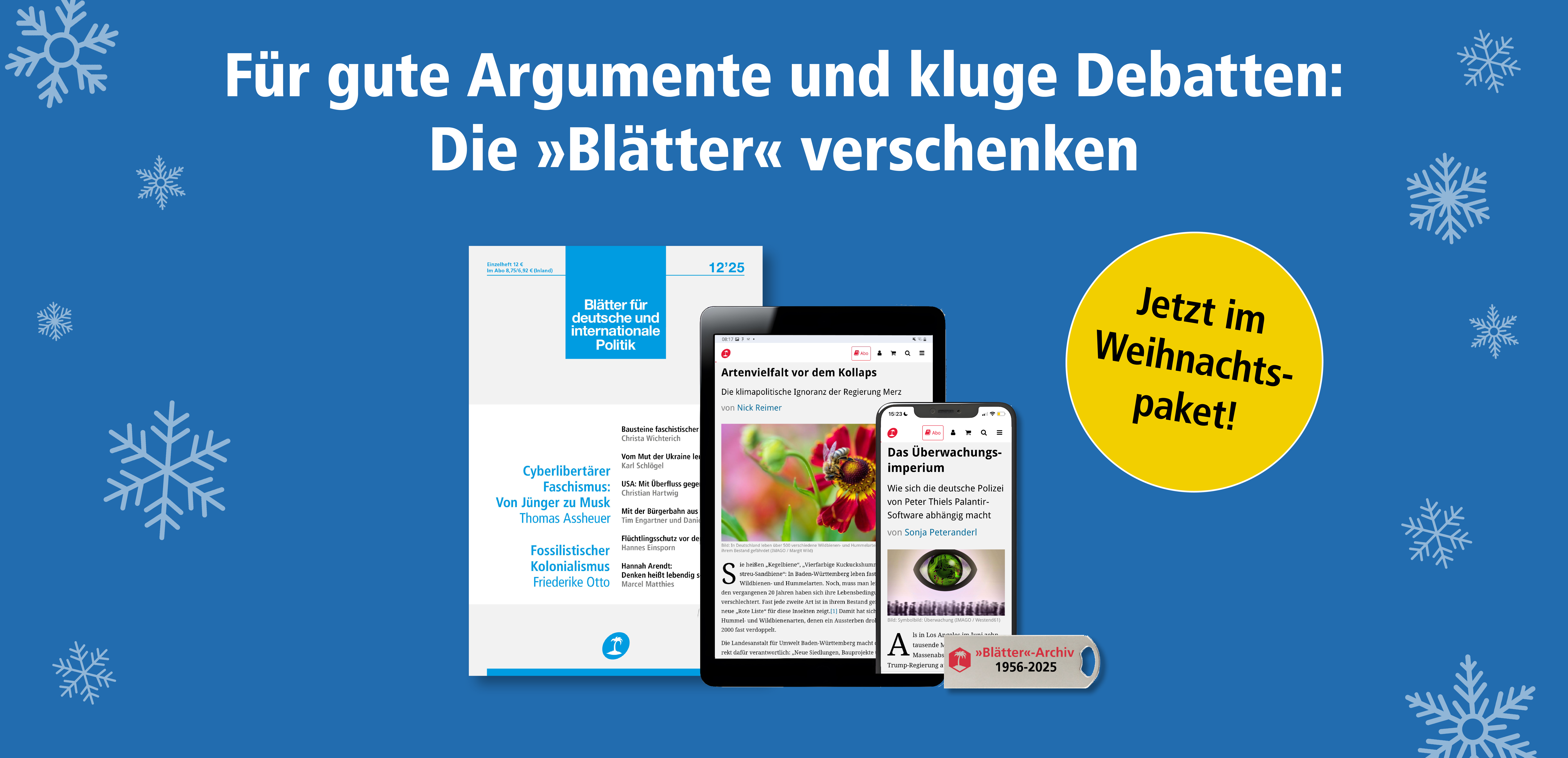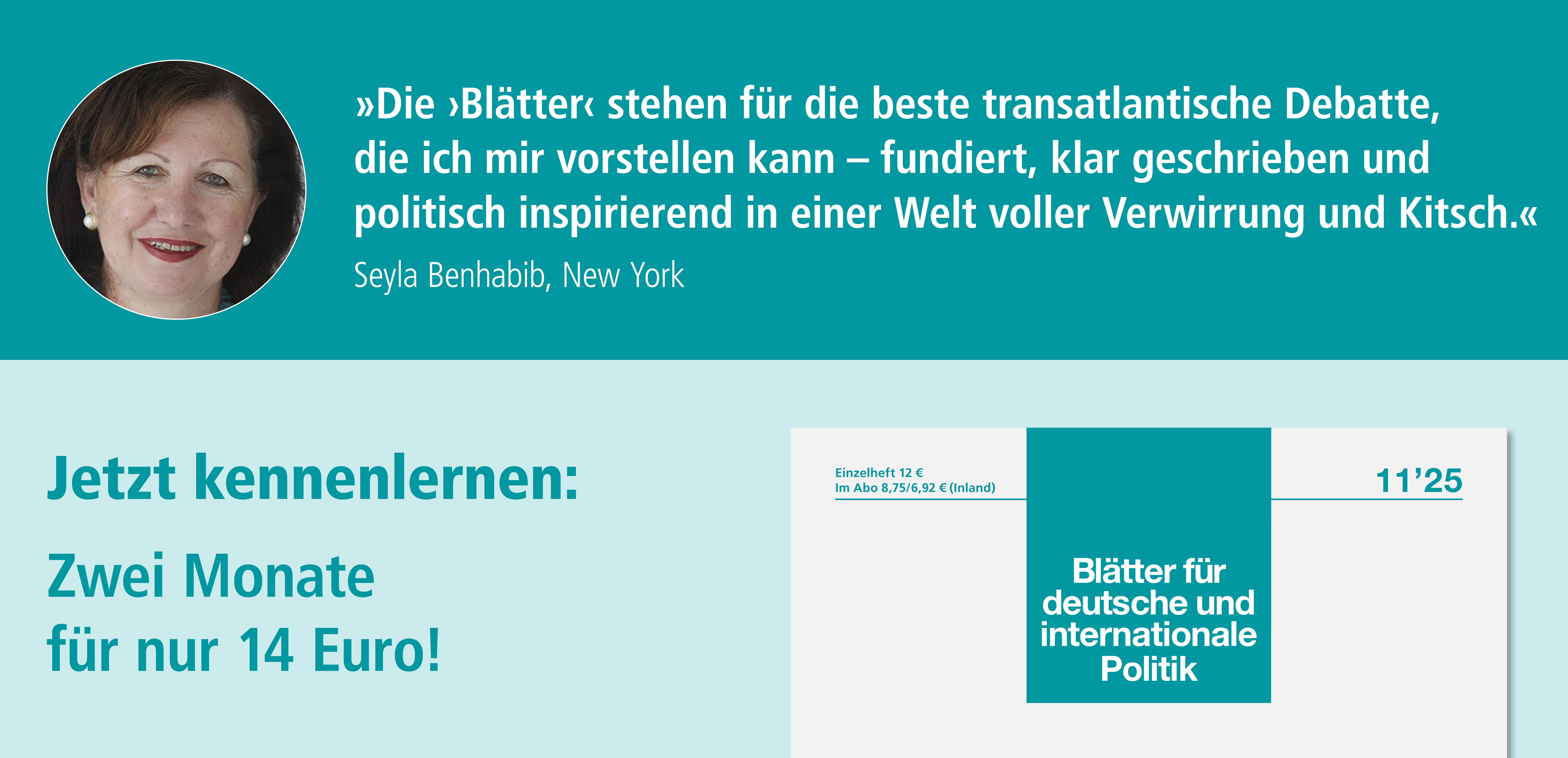Territoriale Expansion in Zeiten der Klimakrise

Bild: Ein Schiff liegt im Hafen von Dudnika. Der Seehafen verbindet das Industriezentrum der Region mit der Nordostpassage. Mit dem Klimawandel wird diese Schifffahrtsroute wichtiger werden, Foto vom 1.12.2022 (IMAGO / ITAR-TASS)
Lange war die Nachkriegsordnung eine starke Hürde für Versuche, Land zu erobern und zu erwerben – ansonsten ein beständiges Merkmal der menschlichen Geschichte. Aber nun scheint es, dass diese Periode relativer Zurückhaltung kein klarer Bruch mit den aggressiven Praktiken der Vergangenheit gewesen ist, sondern nur eine kurze Abweichung vom historischen Muster. Von der russischen Invasion der Ukraine bis zum erklärten Interesse des US-Präsidenten Donald Trump an Grönland: Internationaler Landraub steht wieder auf der Tagesordnung. Die Androhung territorialer Eroberungen ist wieder zu einem zentralen Aspekt von Geopolitik geworden, angetrieben von einer neuen Phase der Großmachtkonkurrenz, wachsendem Bevölkerungsdruck, technologischem Wandel und von einem sich wandelnden Klima als vielleicht wichtigstem Faktor.
Grönland ist das Paradebeispiel dafür, wie der Klimawandel einen globalen Wettstreit um Land auslösen kann. Trump stellte erstmals kurz vor seiner Amtseinführung die Eingliederung des dänischen Gebiets in die USA in Aussicht. Seither hat er diesen Wunsch mehrmals bekräftigt und sich geweigert, die Anwendung von Gewalt auszuschließen, um dieses Ziel zu erreichen. Dänemark ist nicht daran interessiert, Grönland zu verkaufen, und die größtenteils indigene Bevölkerung des Gebiets misstraut äußeren Mächten – ein Erbe der brutalen Geschichte der dänischen Herrschaft über die Insel. Doch das hat Trump nicht von seinen Angeboten oder Drohungen abgehalten. Sein Interesse an dem Gebiet geht angeblich auf dessen strategische Position als Puffer zwischen den Vereinigten Staaten und seinen Großmachtrivalen zurück. „Es hat mit der Freiheit der Welt zu tun“, sagte Trump im Januar. Aber es sind andere Gründe, die Grönland für Außenstehende attraktiv werden lassen, wenn dort wegen der zurückgehenden Eisdecke und dem dünner werdenden Meereis bisher unwirtliche Gebiete zugänglich werden.
Washingtons Interesse an Grönland ist nur das erste Kapitel eines neuen globalen Wettbewerbs um Territorium. Es gibt viele Merkmale, die Land wertvoll machen. Dazu gehören der Zugang zu Ressourcen, die Bewohnbarkeit für Menschen, die landwirtschaftliche Produktivität und die Nähe zu Handelsrouten. Jahrzehntelang haben sich die meisten Länder mit dem zufriedengegeben, was sie hatten. Aber jetzt werden durch den Klimawandel die Karten neu gemischt. Da große Mächte sich in Stellung bringen, um in einer wärmer werdenden Welt erfolgreich zu sein, werden viele Länder sich beeilen, sich den Zugang zu lebenswichtigen Gebieten und Ressourcen zu sichern – und damit läuten sie eine Ära ein, in der unverhohlener Landraub ein wiederkehrendes Thema sein wird.
Was heute unverschämt und seltsam erscheint, könnte zu einer gewöhnlichen Praxis werden, wenn politische Entscheider mit den Folgen eines sich erwärmenden Planeten kämpfen. Für eine Großmacht, die in einer durch den Klimawandel geprägten Zukunft erfolgreich sein will, ist Grönland ein Hauptgewinn. Die riesige Insel wird voraussichtlich zu einem wichtigen Zwischenstopp für neue Schifffahrtsrouten im Norden, die durch das schmelzende Arktiseis entstehen. Obwohl die Eisdecke bisher die Erkundung der Rohstoffvorkommen in Grönland behindert hat, glauben Wissenschaftler, dass das Land über bedeutende Mengen an Eisenerz, Blei, Gold, seltenen Erden, Uran, Öl und anderen wertvollen Ressourcen verfügt, einschließlich der Mineralien, die man für den Übergang zu sauberer Energie braucht.
Mit steigenden Temperaturen werden Menschen gezwungen sein, aus Gebieten zu fliehen, die der steigende Meeresspiegel, unerträgliche Hitze und Extremwetter in unbewohnbare Zonen verwandeln – und bis dahin wird Grönland sehr viel angenehmer für menschliche Besiedlung sein: Bitterkalte Winter werden nachlassen und die Sommer erheblich wärmer sein. Die jüngsten Durchschnittstemperaturen in Grönland gehörten zu den wärmsten der vergangenen tausend Jahre und liegen etwa 1,5 Grad über dem Durchschnitt des 20. Jahrhunderts. Weitere Temperaturanstiege werden neue Vegetation und sogar Landwirtschaft begünstigen. Klimaprognosen zeigen, dass Gegenden, die heute von der bodennahen Vegetation der Tundra bedeckt sind, im Jahr 2100 Heimat wachsender Wälder sein könnten.[1] Der Klimawandel wird einige Länder vor hartnäckige Probleme stellen und für andere neue Möglichkeiten eröffnen, was einen Wettlauf um Land auslösen wird. Veränderungen bei Produktivität und Bewohnbarkeit, die von der globalen Erwärmung ausgelöst werden, lenken wirtschaftliche Produktion und Migration in neue Bahnen. Beispielsweise wird die Auswanderung aus Nordafrika, dem Sahel und dem Nahen und Mittleren Osten zunehmen, da dort die Temperatur steigen und die landwirtschaftliche Produktivität abnehmen wird. Die Menschen werden sich auch aus tiefliegenden und hochwassergefährdeten Küstengebieten zurückziehen, wie dem Delta des Ganges in Bangladesch und Teilen der Küste Floridas.
Nördliche Klimazonen und höher gelegene Gegenden werden die meisten dieser vertriebenen Menschen anziehen. Mit den Temperaturen steigt in kühleren Klimazonen die ökonomische Produktivität, während sie in heißeren Klimazonen fällt.[2] Die Gründe sind offensichtlich: Gemäßigte Klimazonen erlauben eine höhere landwirtschaftliche Produktion, eine bessere Gesundheit der Bevölkerung und bessere Arbeitsbedingungen. Übermäßig heiße Klimazonen führen zu mehr hitzebedingten Todesfällen, höheren Energiekosten, Wasserknappheit und geringeren landwirtschaftlichen Erträgen. Länder mit sehr großen Gebieten, die schon bald begehrt sein werden, können profitieren, wenn sie ihre Karten richtig ausspielen. Kanada und Russland, die beiden größten nördlichen Länder der Welt, sind besonders gut aufgestellt. Die landwirtschaftliche Produktion könnte aufgrund längerer Anbauperioden, höherer Temperaturen und des Schmelzens des Permafrosts dramatisch ausgeweitet werden. Für Kanada könnte dies einen Zugewinn von 1,6 Mio. Quadratmeilen an anbaufähigem Land ergeben, das im Jahr 2080 für den Anbau von Feldfrüchten wie Weizen, Mais und Kartoffeln geeignet sein wird – eine Vervierfachung der heutigen landwirtschaftlichen Nutzfläche.[3] Russland wird ähnliche Zuwächse verzeichnen. Obwohl die Böden dieser Flächen nicht alle hochproduktiv sein werden, führt allein die schiere Größenordnung dieses Wandels dazu, das diese beiden Länder die Getreidemärkte der Zukunft dominieren werden.
Der internationale Landraub ist zurück
Kanada und Russland werden bald auch an wichtigen internationalen Schifffahrtsrouten liegen. Das schmelzende Eis öffnet schiffbare Passagen in der Arktis, und der Schiffsverkehr in dieser Region, der sich ohnehin schon im Aufwind befindet, wird mit der Erwärmung weiter zunehmen. Wichtige Volkswirtschaften haben ein Auge auf zwei Schifffahrtsrouten geworfen, die den Atlantik mit dem Pazifik verbinden: die Nordwestpassage, die am nördlichen Kanada und an Grönland entlangführt, und die Nordostpassage, die am nördlichen Rand von Russland verläuft. Die Position von Kanada und Russland an diesen Routen wird wirtschaftliche Aktivitäten in diesen Ländern fördern und ihnen Verhandlungsmacht im Schiffsverkehr verleihen.
Sicherlich müssen auch Kanada und Russland mit klimawandelinduzierten Naturkatastrophen rechnen. Diese und andere teure Risiken sowie die Schäden, die der auftauende Permafrost an der Infrastruktur verursachen kann, werden ihre Ökonomien belasten. Aber die einsetzenden milderen Temperaturen werden auch Bevölkerungswachstum erzeugen und insgesamt die wirtschaftliche Aktivität fördern. Zumindest Kanada entwickelt bereits Ideen, wie man sich diese Trends zunutze machen könnte. Einflussreiche und gut vernetzte kanadische Führungspersönlichkeiten aus Wirtschaft und Politik haben eine Gruppe gegründet, die sich die Century Initiative nennt und die sich dafür einsetzt, die Bevölkerung des Landes von den heutigen ungefähr 40 Millionen bis 2100 auf 100 Millionen zu erhöhen, vor allem durch massiv ausgeweitete Migration und durch die Einrichtung regionaler Entwicklungszentren. Einer der Gründer der Initiative war Wirtschaftsberater des bisherigen Premierministers Justin Trudeau, und ihr Programm wird von prominenten Mitgliedern der Liberalen und der Konservativen Partei unterstützt.
Die Aussichten Russlands sind gemischter. Die Erwärmung weiter Teile seiner gewaltigen Tundra und des winterkalten Nadelwaldgürtels birgt sicherlich erhebliches wirtschaftliches Potenzial. Aber Russlands Ausrichtung auf die Förderung fossiler Rohstoffe führt dazu, dass seine Wirtschaft angesichts der weltweiten Verlagerung hin zu erneuerbaren Energien verwundbar ist – vor allem, wenn die Landwirtschaft, der Schiffbau und andere wirtschaftliche Aktivitäten, die nun rentabel werden, die abnehmenden Exporte von fossilen Brennstoffen nicht kompensieren können. Und während Kanada seine niedrigen Geburtenraten mit einer relativ offenen Migrationspolitik ausgleicht, ist Russland viel weniger offen für Zuwanderung. Daher könnte die russische Bevölkerung bis 2100 um 25 Prozent zurückgehen.
Andere nördliche Regionen wie Finnland, Norwegen, Schweden und der US-Bundesstaat Alaska werden in den nächsten Jahrzehnten ähnliche Veränderungen wie Kanada und Russland erleben. Ihr Bestand an anbaufähigem Land wird wachsen. Dagegen werden die landwirtschaftlichen Erträge im Großteil der USA und in China sinken, die Migration aus ihren heißesten und für Naturkatastrophen anfälligsten Gegenden wird wachsen sowie die Produktivität abnehmen. Die Macht und der Einfluss beider Staaten könnte schwinden, wenn sie es nicht schaffen, diese Nachteile mit Investitionen in billige erneuerbare Energie und mit Plänen für die Umsiedlung gefährdeter Bevölkerungsteile in lebensfreundlichere Orte auszubalancieren.
Angesichts der krassen klimabezogenen wirtschaftlichen und demographischen Herausforderungen werden alle Länder versuchen, sich jeden möglichen Vorteil zu sichern. Das Gezerre um Grönland ist erst der Anfang. Weltweit gibt es Dutzende Gebiete mit ähnlichen Merkmalen wie Grönland: dünn besiedelt, in den nächsten Jahrzehnten wahrscheinlich bewohnbarer oder mit wertvollen Ressourcen ausgestattet, und deren Souveränität schwach oder unklar ist oder sich im Übergang befindet. Grönland ist ein selbstverwaltetes Gebiet Dänemarks und seine Außenpolitik wird von Kopenhagen gesteuert, aber seine Politiker wünschen eine vollständige Unabhängigkeit und haben eine eigene Verfassung entworfen. Obwohl die meisten Grönländer auf Trumps Angebot, den USA beizutreten, zunächst mit Abscheu reagiert haben, ist es nicht völlig abwegig, dass das Gebiet unabhängig wird und diesen Vorschlag in der Zukunft erwägt. Andere nichtsouveräne Gebiete wie die Falklandinseln, Französisch-Guyana und Neukaledonien könnten ebenfalls auf dem Radar von Großmächten auftauchen oder ins Visier von Nachbarstaaten geraten, die eine Gelegenheit sehen, sich zu vergrößern. All diese Gebiete waren einmal umkämpft und könnten es erneut sein.
Die Antarktis ist ein weiterer Brennpunkt. Während des Kalten Krieges unterzeichneten die Großmächte den Antarktis-Vertrag. Sie stellten territoriale Ansprüche zurück und verpflichteten sich, die Antarktis als Ort internationaler Forschung und Zusammenarbeit zu nutzen. Diese Vereinbarung beginnt nun zu wanken. China und Russland haben kürzlich ihre Interessen am Zugriff auf die Antarktis in ihren nationalen Sicherheitsstrategien verankert, und China hat in eine Flotte von Eisbrechern und in den Bau von Erdfunkstationen für die Satellitenkommunikation auf dem Kontinent investiert, die auch zu militärischen Zwecken eingesetzt werden können. Beide Länder haben ihre Krillfischerei in den Gewässern rund um die Antarktis ausgeweitet, weigern sich, existierende Meeresschutzmaßnahmen zu erneuern, und lehnen die Vorschläge für zusätzliche Maßnahmen durch die aus 26 Ländern bestehende Kommission zur Erhaltung der lebenden Meeresschätze der Antarktis ab. Argentinien und Chile haben daraufhin ihrerseits ihre lange währenden Ansprüche auf Gebiete auf dem Kontinent geltend gemacht. Wenn der Klimawandel die Förderung wertvoller Ressourcen, die Ausweitung der Kontrolle über die sich erweiternden Schifffahrtsrouten und den Bau von Kontrollstationen und Forschungsbasen, die militärisch nutzbar gemacht werden könnten, möglich macht, könnte die antarktische Kooperation vollständig zusammenbrechen.
Vom Kongo zur Ukraine: Kampf um Ressourcen und Nahrungsmittel
Länder mit Ressourcen, die für den Übergang zu erneuerbaren Energien wichtig sind, werden ebenfalls zu Schauplätzen der Konkurrenz. Ein Treiber dabei ist die Nachfrage nach seltenen Erden wie Kobalt, Coltan, Lithium und Tantal und der Wunsch, sich diese Ressourcen zu sichern. In einigen Fällen wird dabei die territoriale Souveränität verletzt – durch den schleichenden Einfluss multinationaler Unternehmen, die im großen Stil Land erwerben, bis hin zu ausländischen militärischen Vorstöße. Die kürzliche Invasion in die an Mineralen reiche Demokratische Republik Kongo durch die von Ruanda unterstützte M23-Rebellengruppe kann damit erklärt werden, dass die Gruppe – und damit Ruanda – sich so den Zugang zu den wertvollen Rohstoffen im Osten Kongos sichert, die für die Produktion von Batterien für Elektrofahrzeuge und Mobiltelefone genutzt werden.
Auch die Konkurrenz um sichere Zugänge zu Nahrungsmitteln wird sich verstärken, weil der Klimawandel weltweit die landwirtschaftlichen Erträge und Anbaupläne beeinflusst. Einige Länder werden neue Quellen für landwirtschaftliche Güter finden müssen, und Länder, die weiterhin Nahrungsmittel produzieren und exportieren können, werden an Einfluss gewinnen. Die russische Invasion der Ukraine kann teilweise als Versuch gelesen werden, politische Verhandlungsmacht durch landwirtschaftliche Vorteile zu erlangen. Jahrzehntelang haben die Sowjetunion und Russland Getreide importiert, aber in den vergangenen beiden Jahrzehnten hat Moskau gezielte und erfolgreiche Anstrengungen unternommen, um die heimische landwirtschaftliche Produktion anzukurbeln. Heute ist Russland nicht nur unabhängig von Importen, sondern der größte Weizenexporteur der Welt. Durch die Aneignung von erstklassigen landwirtschaftlichen Flächen in der Ukraine hat es seine Dominanz auf den Getreideweltmärkten weiter gefestigt. Diese Stellung verleiht Moskau sehr große Macht: Wenn es Exporte an ein Land einstellt, das von Getreideimporten abhängig ist, kann es die Politik dieses Landes destabilisieren und Hunger und sogar Auswanderung auslösen.
Die Kriege der Zukunft
Der Klimawandel wird die Beziehungen zwischen Staaten künftig auf komplexe Weise prägen. Die groben Umrisse dieser Veränderungen sind bereits sichtbar. Schon jetzt wandeln sich Handels- und Rohstoffmärkte, da mächtige Staaten nach Schlüsselressourcen greifen und neue Schifffahrtsrouten verfügbar werden. Menschen wandern bereits in und zwischen Ländern, weil der Klimawandel einige Teile der Erde unbewohnbar und andere attraktiver macht. Wenn diese Trends sich beschleunigen, dann werden sie die Anstrengungen wichtiger Mächte, sich neue Gebiete anzueignen, weiter befeuern.
Obwohl sich nicht sicher vorhersagen lässt, wann und wo Staaten bereit sein werden, Kriege um Land zu führen, deuten die heutigen Umwelttrends auf viele mögliche gewaltsame Konflikte in der Zukunft. China, das vom Klimawandel ernsthaft bedroht ist – von steigendem Meeresspiegel und Extremwetter in den Küstenregionen bis hin zu Überflutungen entlang der großen Flüsse und der Wüstenbildung im Norden des Landes –, könnte versuchen, sich Ressourcen, bewohnbares Land und geostrategische Vorteile dadurch zu sichern, dass es in Südostasien einfällt, Anspruch auf Inselstützpunkte erhebt oder sich sogar Teile des östlichen Russlands oder von Nordkorea aneignet.
Nigeria, das Ende des Jahrhunderts bevölkerungsreicher als China sein dürfte, könnte Zentralafrika in ein Pulverfass verwandeln. Weil der Klimawandel die landwirtschaftliche Produktion unterbricht und Bevölkerungsgruppen vertreibt, könnte Nigeria mehr Ressourcen brauchen, um seine schnell wachsende Bevölkerung zu ernähren – und deshalb ein Auge auf Nachbarländer werfen, um sich diese zu sichern. Russland wiederum könnte sich im Baltikum oder in Norwegen ausbreiten, um sich nördliche Schifffahrtsrouten zu sichern und seinen Meereszugang auszubauen. Es könnte ähnlich in der Antarktis agieren, was den Boden für einen Konflikt mit den anderen dort aktiven großen Mächten bereiten würde. Und die USA, konfrontiert mit Zerstörungen durch den Klimawandel an Orten wie den Küstenregionen Floridas, dem durch Waldbrände gefährdeten Kalifornien und dem von Dürren betroffenen Südwesten könnten ihre territorialen Ambitionen in nördlichen Gebieten ausleben, einschließlich Grönlands oder sogar von Teilen Kanadas.
Mit internationalen Abkommen und Bündnisse, die bereits jetzt angesichts der Großmachtkonkurrenz auseinanderzufallen drohen, werden sich diese Auseinandersetzungen kaum noch einhegen lassen. In einer Welt, in der die Macht das Recht setzt, könnten Länder auf der Suche nach neuen Gebieten nicht zögern, sich diese mit Gewalt zu holen. Die dramatischsten Auswirkungen des Klimawandels liegen noch vor uns, das Rennen um Land hat gerade erst begonnen.
Deutsche Erstveröffentlichung eines Artikels, der unter dem Titel „The Coming Age of Territorial Expansion“ am 4. März auf foreignaffairs.com erschienen ist. Übersetzung: Thomas Greven.
[1] Signe Normand u.a., A Greener Greenland?, in: „Philosophical Transactions oft The Royal Society B“, 19.8.2013.
[2] Josie Garthwaite, Climate change has worsened global economic inequality, sustainability.stanford.edu, 22.4.2019.
[3] Lee Hannah u.a., The environmental consequences of climate-driven agricultural frontiers, journals.plos.org, 12.2.2020.