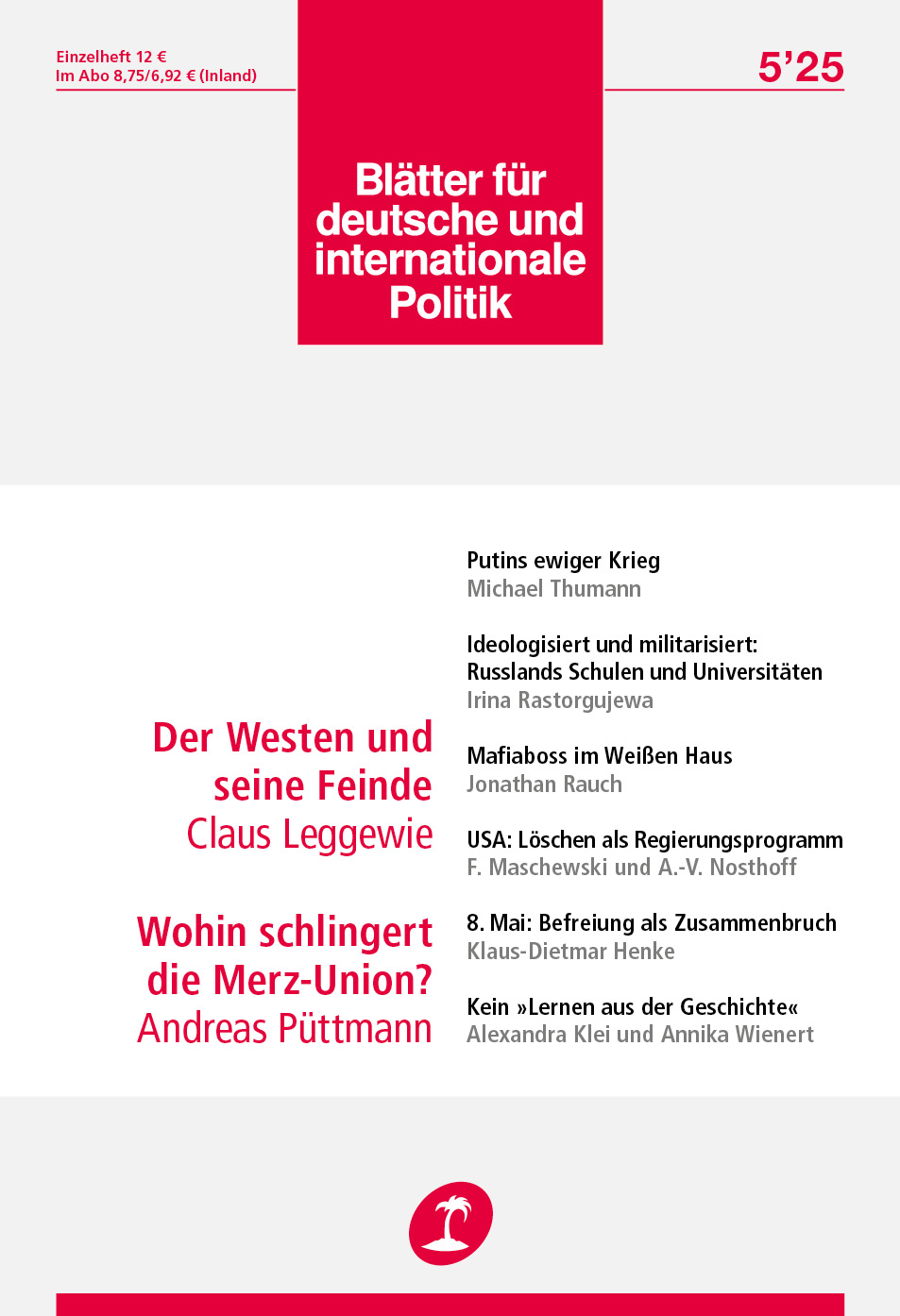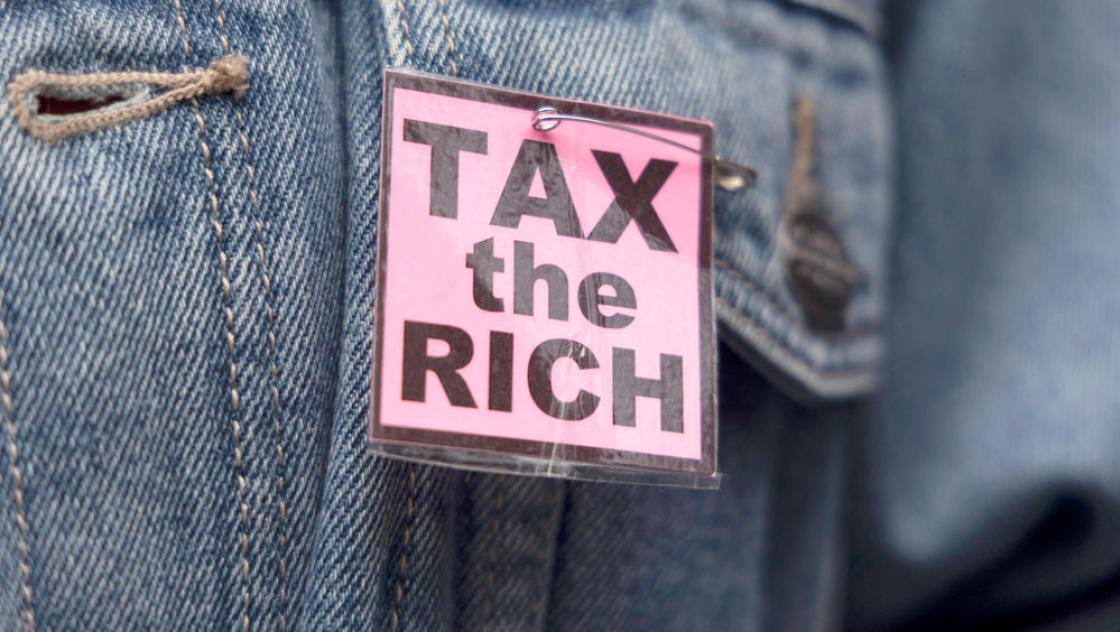
Bild: Tax the Rich (Gina M Randazzo / IMAGO / ZUMA Press Wire)
Schon vor Beginn der Koalitionsverhandlungen hatten sich Union und SPD auf eine zentrale Weichenstellung geeinigt: mehr Schulden. Ein noch vom alten Bundestag gemeinsam mit den Grünen Mitte März beschlossenes Sondervermögen soll Investitionen in Infrastruktur, Digitalisierung, Energie und Bildung ermöglichen. Zusätzlich wird die Schuldenbremse für Verteidigungsausgaben gelockert. Insgesamt sollen jährlich rund hundert Mrd. Euro zusätzlich über Kredite investiert werden. Angesichts der moderaten Staatsverschuldung gilt das als tragfähig. Doch auch tragfähige Schulden müssen langfristig bedient werden – und das wirft unweigerlich die Frage nach einer fairen Lastenverteilung auf.
In demokratischen Gesellschaften wird diese Frage in erster Linie über das Steuersystem verhandelt. Es legt fest, wer welchen Beitrag zum Gemeinwesen leistet, welche Gruppen entlastet und welche stärker in die Pflicht genommen werden. Die Antwort der neuen Koalition auf die Verteilungsfrage fällt jedoch eindeutig aus: Große Vermögen werden nicht an der Krisenbewältigung beteiligt, sehr hohe Vermögenseinkommen werden sogar weiter entlastet. Union und SPD setzen damit die ungerechte Steuerpolitik fort. Dabei wäre ein umfassendes Update des Steuersystems dringlicher denn je.
Zwar finanzieren Steuern und Beiträge das Gemeinwesen und sichern den Wohlstand in Deutschland so verlässlich wie in nur wenigen anderen Ländern. Das Steuersystem sorgt dafür, dass sowohl Menschen mit hohen Arbeitseinkommen als auch kleine und mittelständische Betriebe einen wesentlichen Beitrag leisten. Doch für hohe Vermögenseinkommen gelten zahlreiche Steuerprivilegien. Eigentümer großer Konzerne und von Immobilienvermögen sowie Erben von Milliardenvermögen zahlen, gemessen an ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, häufig viel zu wenig Steuern.
Das war nicht immer so. Doch in den vergangenen Jahrzehnten haben sich viele Staaten dem Druck von Steueroasen und Lobbyorganisationen gebeugt und sich gegenseitig mit Steuersenkungen für Superreiche und große Konzerne unterboten. Mittlerweile zahlen superreiche Unternehmenseigentümer häufig niedrigere Steuer- und Abgabensätze als die Mittelschicht. Auch in Deutschland gilt: Erwerbstätige zahlen fast die Hälfte ihres Einkommens an Steuern und Abgaben. Die effektive Steuerlast Superreicher liegt dagegen oft bei nur 25 bis 30 Prozent – und das inklusive Unternehmenssteuern. Bis Mitte der 1990er Jahre mussten sie noch mehr als doppelt so viel ihres Einkommens an Steuern leisten.
Diese Entwicklung ist das Ergebnis politischer Entscheidungen, sprich: der Aussetzung der Vermögensteuer 1997 sowie Reformen im Unternehmenssteuerrecht. Dazu gehört die schrittweise Halbierung der Unternehmenssteuer auf einbehaltene Gewinne in den 2000er Jahren. Zudem wurde ermöglicht, Unternehmensgewinne steuerlich begünstigt in Beteiligungsgesellschaften anzusparen. Auch höhere Renditen großer Vermögen tragen dazu bei, dass sich diese vor allem in den Händen Weniger konzentrieren. Ungeachtet der Krisen wachsen die größten Privatvermögen in Deutschland stetig weiter an, während die Vermögensverteilung hierzulande extrem ungleich ist: Das reichste Prozent besitzt über 35 Prozent. Die ärmere Hälfte hält hingegen nur rund zwei Prozent und damit, abgesehen von Rentenansprüchen, fast nichts – sie profitiert auch nicht von steigenden Vermögenspreisen.
Allein 2024 sind die deutschen Milliardenvermögen laut dem „Manager Magazin“ um weitere 60 Mrd. Euro gestiegen und haben erstmals die Marke von 1000 Mrd. Euro überschritten. In den vergangenen 20 Jahren haben sie sich mehr als vervierfacht. Trotz dieses enormen Wachstums wurde zu wenig in die Zukunftsfähigkeit des Landes investiert – etwa in öffentliche Infrastruktur, Bildung, Gesundheitsversorgung oder Klimaschutz. Um die gegenwärtigen Herausforderungen zu bewältigen, sind eine gerechtere Verteilung und ein effizienterer Einsatz der vorhandenen Ressourcen nötig. Die breite Arbeitnehmerschaft zahlt in Deutschland bereits hohe Steuern und insbesondere hohe Sozialbeiträge. Zwar stellt die Koalition hier mittelfristig Entlastungen in Aussicht, doch angesichts teurer Steuersenkungen an anderer Stelle erscheint fraglich, ob diese Versprechen eingelöst werden können. Vielmehr ist zu erwarten, dass die Sozialabgaben weiter steigen. Sollen Arbeitseinkommen künftig nicht noch stärker belastet werden, müssen große Vermögen und Vermögenseinkommen endlich angemessen zur Finanzierung des Gemeinwesens beitragen.
Privilegien für Superreiche abbauen
Wie aber sollte ein grundlegendes Update des Steuersystems aussehen? Ein zentraler Schritt wäre die Einführung einer Mindeststeuer für Superreiche. Eine Steuer von zwei Prozent auf Vermögen von über 50 oder 100 Mio. Euro könnte bestehende steuerliche Privilegien bei hohen Vermögenseinkommen ausgleichen. Statt derzeit nur 25 bis 30 Prozent würde eine solche Maßnahme deren Steuerbeitrag in etwa verdoppeln und auf das Niveau des Reichensteuersatzes der Einkommensteuer heben.
Auch in anderen Industriestaaten wurden Vermögen und Vermögenseinkommen steuerlich entlastet, während öffentliche Haushalte und Demokratien zunehmend unter Druck geraten. International wächst angesichts dessen die Einsicht: Niedrige Steuern für Hochvermögende sind nicht mehr Teil der Lösung, sondern Teil des Problems. 2024 einigten sich daher die G20-Staaten erstmals darauf, die Besteuerung von Superreichen wirksam voranzutreiben. Höhere Steuern könnten künftig global koordiniert werden.
Die Erhebung von Vermögensteuern scheitert bislang nicht an juristischen Hürden, sondern am politischen Willen. Das Grundgesetz erlaubt sie ausdrücklich, und die sogenannte Wegzugsteuer wirkt bereits effektiv gegen Steuerflucht. Die SPD hatte die Vermögensteuer auf ihrer Wunschliste für die Koalitionsverhandlungen, doch vereinbart wurde sie nicht, im Gegenteil. Die nun von Union und SPD ab 2028 in Aussicht gestellten pauschalen Unternehmenssteuersenkungen führen letztlich dazu, dass auch der effektive Steuersatz für Superreiche weiter sinkt. Zumal Steuersenkungen mit der Gießkanne – unabhängig davon, ob Gewinne in Deutschland reinvestiert oder nur am Finanzmarkt oder im Ausland angelegt werden – weder wirtschaftlich sinnvoll noch nachhaltig sind. Dass Deutschland mehr investieren muss, um seinen Wohlstand zu sichern, ist unstrittig. Zugleich bescheinigen selbst Auftragsstudien von Wirtschaftsverbänden pauschalen Steuersenkungen nur geringe Effekte auf Investitionen und Wachstum. Zudem führen sie zu erheblichen Steuerausfällen – mit der Folge, dass notwendige öffentliche Investitionen möglicherweise ausbleiben. Profitieren werden vor allem die Vermögenden, die große Unternehmen oder Unternehmensanteile besitzen. Im Übrigen zeigt sich bei den Unternehmenssteuern international ein anderer Trend: Zwischen 2022 und 2024 haben zum ersten Mal seit langer Zeit mehr OECD-Staaten den Steuersatz für ihre Unternehmen erhöht, statt ihn zu senken.
Klar ist: Deutschland steht vor einem Strukturwandel, den die Politik steuerlich gezielt begleiten muss – vor allem durch die Förderung von Investitionen etwa in Infrastruktur, nachhaltige Technologien, Wohnungsbau und das Gesundheitswesen. Das wirksamste Instrument dafür sind zeitlich befristete Sonderabschreibungen in Bereichen mit besonders hohem Investitionsbedarf. Zwar hat die Koalition neben der Steuersatzsenkung auch die Abschreibungsregeln erweitert, allerdings ohne Ausrichtung auf Investitionen, die besonders dringend gebraucht werden.
Dringend reformbedürftig sind auch die Steuerregelungen im Immobilienbereich. Zahlreiche steuerliche Privilegien tragen aktuell dazu bei, dass Immobilieninvestoren ganz ohne Neubauabsichten steuergünstig große Gewinne erwirtschaften können. Das treibt die Preise auf dem überhitzten Wohnungsmarkt zusätzlich in die Höhe und erschwert den Zugang zu Wohneigentum für weite Teile der Bevölkerung. Auch hier ist unter der Großen Koalition keine Wende absehbar.
Würden dagegen die hier vorgeschlagenen Maßnahmen umgesetzt, wäre der Wohlstand in Deutschland gerechter verteilt. Milliardenvermögen würden dabei nicht einmal abgebaut, sondern lediglich langsamer wachsen.
Um zu verhindern, dass Deutschland zunehmend zu einer Erbengesellschaft wird, bedarf es zudem einer Reform der Erbschaft- und Schenkungsteuer, denn die aktuelle Besteuerung weist erhebliche Gerechtigkeitsdefizite auf. Jährlich werden hierzulande 300 bis 400 Mrd. Euro verschenkt oder vererbt, doch das Steueraufkommen daraus ist minimal. Selbst Raucher leisten über die Tabaksteuer einen höheren Beitrag zum Staatshaushalt als Erben – nämlich 15 Mrd. gegenüber neun Mrd. Euro.
Für eine gerechtere Erbschaftsteuer
Hinzu kommt: Auch Erbvermögen sind extrem ungleich verteilt. Die größten Erbschaften werden besonders gering besteuert. So wurden 2023 auf 26 Großvermögen mit einem Gesamtwert von über sechs Mrd. Euro nur 0,1 Prozent Steuern fällig. Der Grund: Unternehmensvermögen profitieren von weitreichenden Steuerbefreiungen und Gestaltungsspielräumen. Das schwächt das Steueraufkommen wie die Umverteilungswirkung der Steuer erheblich. Für eine gerechtere Erbschaftsteuer müssen diese Ausnahmen entfallen. Wenn Unternehmenserben die Steuer über Jahre aus Gewinnen begleichen dürfen, gefährdet dies weder Investitionen noch Arbeitsplätze. Wo nötig, könnte der Staat vorübergehend sogar als stiller Teilhaber einspringen, bis die Steuer bezahlt ist, um Notverkäufe zu vermeiden. Aktuell verzerren die bestehenden Privilegien den Wettbewerb. Während innovative Nichterben Kredite aufnehmen müssen, profitieren Erben unabhängig von Leistung oder Qualifikation.
Zur Erbschaftsteuer schweigt der Koalitionsvertrag allerdings. Die Steuerprivilegien für superreiche Unternehmenserben bleiben damit vorerst unangetastet – zumindest bis das Bundesverfassungsgericht sie möglicherweise noch in diesem Jahr erneut für verfassungswidrig erklärt.
Ein gerechtes Steuersystem erfordert allerdings nicht nur faire Gesetze, sondern auch eine handlungsfähige Finanzverwaltung und Justiz, die sie wirksam durchsetzen. Der Cum-Ex-Skandal hat deren Fehlen in aller Deutlichkeit vor Augen geführt. Über Jahre hinweg ließen sich Finanzakteure Kapitalertragsteuern erstatten, die niemals abgeführt worden waren – ein organisierter Griff in die Staatskasse, dessen vollständige Aufarbeitung bis heute aussteht. Auch die milliardenschweren Cum-Cum-Geschäfte, bei denen sich ausländische Investoren über inländische Banken steuerlich privilegieren ließen, offenbaren strukturelle Schwächen in der Steueraufsicht. Doch unter der neuen Bundesregierung ist keine systematische Aufarbeitung des Betrugs in Sicht, obwohl der geschätzte Gesamtschaden bei fast 30 Mrd. Euro liegt. Immerhin erkennen SPD und Union an, dass Cum-Cum-Geschäfte weiterhin möglich sind –, sie bleiben aber lediglich vage bei der Frage, wie sie künftig unterbunden werden sollen. Eine umfassende Strategie zur Bekämpfung von Steuerhinterziehung wird es wohl auch mit der neuen GroKo nicht geben, ebenso wenig wie eine offizielle Steuerlückenschätzung – die Differenz zwischen tatsächlichen und potenziellen Steuereinnahmen. Hinzu kommen gravierende strukturelle Defizite der Finanzverwaltung: Die Steuerverwaltung wurde über Jahre hinweg personell geschwächt. Gerade in den zentralen Bereichen der Betriebsprüfung und Steuerfahndung fehlt es an spezialisierten Kräften, um komplexe Modelle der Steuervermeidung aufzudecken und konsequent zu verfolgen.
Warum aber tut sich so wenig, obwohl sich die meisten Menschen eine gerechtere Verteilung wünschen? Tatsächlich befürwortet eine Mehrheit der Bevölkerung die Einführung einer Vermögensteuer – selbst unter den Anhängern der CDU liegt die Zustimmung bei 66 Prozent. Dass der politische Druck dennoch gering bleibt, liegt daran, dass trotz ihrer zentralen Rolle für das Gemeinwesen Steuern oft auf Ablehnung oder Desinteresse stoßen. Kaum ein anderes Thema ist so präsent und zugleich so stark von Halbwissen und Mythen geprägt. Viele empfinden die Vermögensverteilung zwar als ungerecht, doch zugleich fällt es schwer, konkrete Reformvorschläge zu formulieren. Höhere Erbschaftsteuern werden oft abgelehnt – aus Sorge, selbst betroffen zu sein, obwohl hohe Freibeträge dies bei der großen Mehrheit ausschließen. Vermögensteuern finden mehr Zustimmung, doch Ängste vor Arbeitsplatzverlust oder Kapitalflucht dämpfen bei vielen den Reformwillen. Lobbyorganisationen von Vermögenden befeuern diese Ängste gezielt. Zudem säen sie Misstrauen gegenüber dem Staat und verknüpfen das gezielt mit ihren Forderungen nach Steuersenkungen. Tragfähige Vorschläge für Einsparungen bleiben sie dabei schuldig. Menschen, die eigentlich von mehr Umverteilung profitieren würden, wählen unter diesem Eindruck Parteien, die genau diese nicht vertreten.
Es bedarf daher dringend einer faktenbasierten Debatte über Steuern und Finanzen, die informierte Entscheidungen ermöglicht. Bürgerräte und zivilgesellschaftliche Dialoge bieten dafür bewährte Formate. Aktuell hat sich eine ungewöhnliche Allianz zusammengefunden: Das Netzwerk Steuergerechtigkeit und der Bund der Steuerzahler organisieren die „Bürgerdebatte Gerechte Steuern und Finanzen“. Dort wird diskutiert, wie ein gerechteres Steuersystem aussehen kann. Solche Beteiligungsformate können helfen, die steuerpolitische Debatte aus der Expertennische zu holen und neue Impulse zu setzen.
Zwar kann das Steuersystem allein nicht alle Herausforderungen unserer Zeit lösen, doch es bleibt das zentrale Werkzeug für mehr Gerechtigkeit und eine zukunftsfähige Wirtschaft. Die Große Koalition hat sich zwar über neue Schulden finanziellen Spielraum verschafft, bleibt jedoch die Antwort auf die Verteilungsfrage schuldig. Es ist Zeit für eine Neuausrichtung der Steuerpolitik – um die Demokratie zu stärken und die dringend notwendige Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft zu ermöglichen.