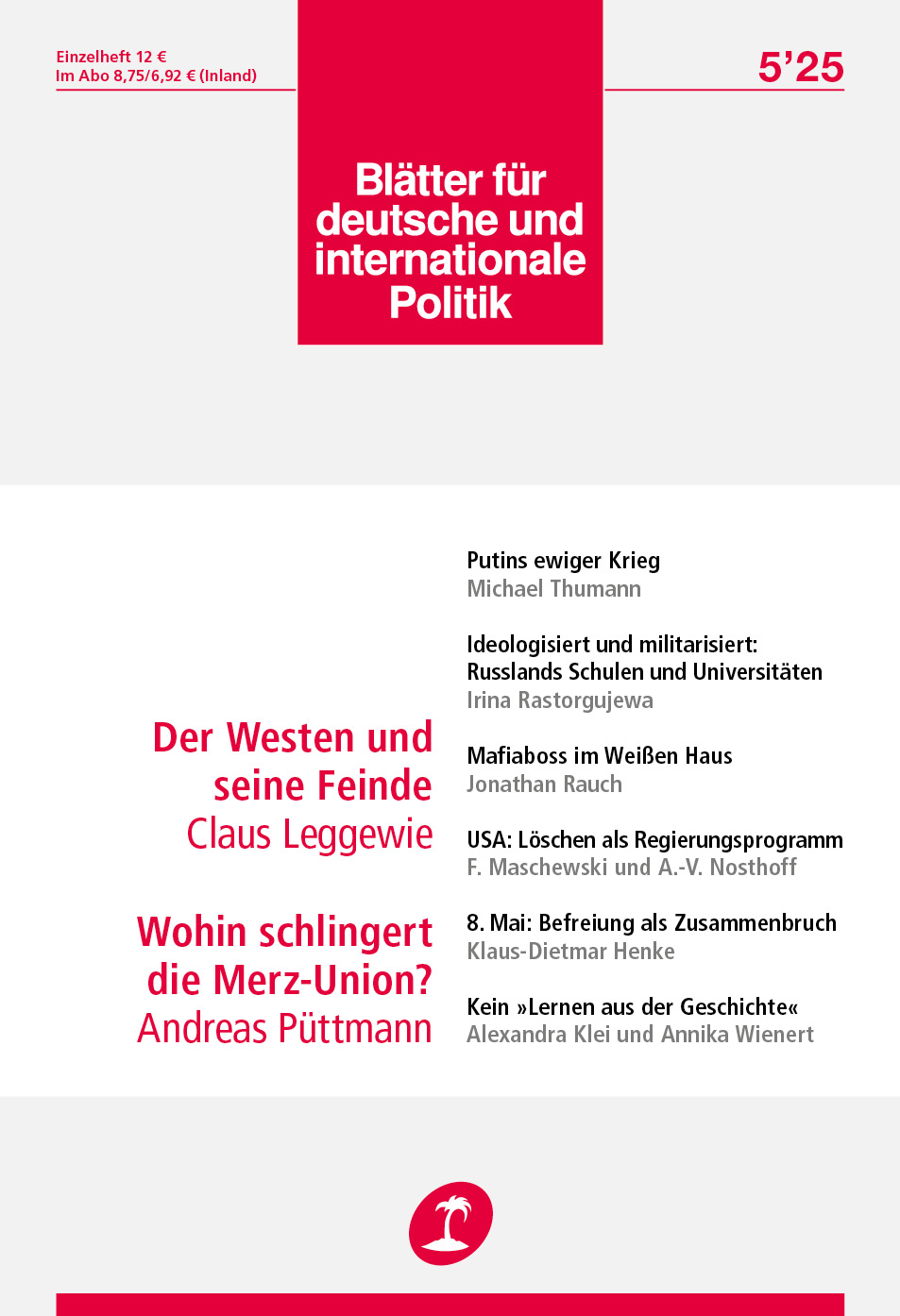Bild: Schlüsselkästen für Ferienwohnungen. Studien zeigen einen Zusammenhang zwischen steigenden Mieten und Vermietungen auf Plattformen wie Airbnb oder Booking (IMAGO / Zoonar.com / Roy Henderson)
Es gibt nicht viele Themen, die in ganz Spanien Menschen auf die Straße bringen. Landesweite Demonstrationen prägen in der Regel den Weltfrauentag am 8. März, ansonsten vereint wenig das heterogene und politisch hochpolarisierte Land. Eine Ausnahme bildet das Thema Wohnraum: Anfang April protestierten in vierzig spanischen Städten Zehntausende gegen die steigenden Mieten. 15 000 waren es nach Behördenangaben in Madrid, 12 000 in Barcelona, jeweils 5000 in Málaga, Sevilla und anderen andalusischen Städten. Von einem „historischen Tag“ sprachen die Veranstalter – weniger wegen der Teilnehmerzahlen (Madrid und Barcelona haben größere Demonstrationen gesehen) als wegen des Erfolgs einer landesweiten Mobilisierung. Aufgerufen zu den Demonstrationen hatten die Sindicatos de Inquilinas, parteiferne „Mieter-Gewerkschaften“, in denen sich in den vergangenen Jahren in vielen spanischen Großstädten Mieterinnen und Mieter zusammengeschlossen haben.
Tatsächlich bestimmt derzeit kaum ein Thema stärker die politische Debatte. Im monatlichen Stimmungsbarometer des staatlichen Meinungsforschungsinstituts CIS belegt die Sorge um erschwinglichen Wohnraum regelmäßig einen der obersten Plätze.1 Laut einer Studie der spanischen Zentralbank sind die Mieterinnen und Mieter des Landes besonders von Armut bedroht.2 Prekär ist die Lage vor allem in touristisch beliebten Großstädten und Ballungsräumen. In Barcelona, eines der beliebtesten Städteziele Europas, stiegen die Mieten in den vergangenen zehn Jahren um fast 70 Prozent, im südspanischen Málaga waren es sogar allein seit der Coronapandemie 40 Prozent. In der katalanischen Hauptstadt geben inzwischen 40 Prozent der Mieter mehr als 40 Prozent ihres Einkommens für die Wohnung aus – im europäischen Durchschnitt sind es 15 Prozent. Diese Entwicklung birgt soziale Sprengkraft: Zwar leben im „Eigentümerland“ Spanien immer noch fast zwei Drittel der Bevölkerung in der eigenen Immobilie, aber die Zahl der Mieter – vor allem junge Familien und Berufsanfänger – wächst seit der Finanzkrise kontinuierlich: von 20,2 Prozent im Jahr 2010 auf fast 25 Prozent im Jahr 2020.3
Preistreiber Ferienwohnung
Dass die Schere zwischen armen Mietern und besser positionierten Eigentümern vor allem in touristisch beliebten Städten immer weiter auseinanderklafft, ist kein Zufall. Mehrere Studien zeigen einen Zusammenhang zwischen steigenden Mieten und Vermietungen auf Plattformen wie Airbnb oder Booking, zumindest im Urlaubsland Spanien. In Barcelona beispielsweise hat das Institut d’Economia de Barcelona bereits 2019 die Preisentwicklung in einzelnen Vierteln untersucht. Demnach stiegen in Innenstadtbezirken mit einer besonders hohen Konzentration von Airbnb-Unterkünften die Mieten um sieben Prozent und die Immobilienpreise um 19 Prozent.4 Das „Ende des Geschäfts mit den Ferienwohnungen“ gehört zu den Kernforderungen der Sindicatos de Inquilinas.
Die Plattformen bestreiten diesen Einfluss und verweisen auf den geringen Anteil von Ferienwohnungen am Gesamtwohnungsmarkt, aber eine rein quantitative Gegenüberstellung wird der komplexen Problematik nicht gerecht: Im Eigentümerland Spanien ist der Anteil an Mietwohnungen am Wohnungsmarkt ohnehin eher gering. In Barcelona etwa werden nur 200 000 der insgesamt 800 000 Wohnungen überhaupt vermietet. Außerdem konzentriert sich das Gros der Airbnbs zumeist in der Altstadt und zentralen Vierteln, die sowohl bei Touristen als auch bei Einheimischen beliebt sind – und die oft von Menschen mit mittlerem bis niedrigem Einkommen bewohnt werden. Der Verknappungseffekt ist also sehr viel größer als ein simpler Zahlenvergleich vermuten lässt.
Airbnb und Co. wurden so ab 2008 zu einem Katalysator für eine rapide Preissteigerung, sagt der Ökonom Josep Lladós: „Wohnungseigentümer haben entdeckt, wie rentabel ihr Besitz in einer touristisch so interessanten Stadt wie Barcelona sein kann und wie schnell sie damit Geld verdienen können. Das hat dazu geführt, dass zunehmend auch Gesellschaften oder professionelle Anbieter auf den Markt drängen, die Wohnungen aufgekauft haben, um sie als Ferienwohnungen zu vermieten.“5
Teils wurden ganze Gebäude aufgekauft und renoviert, nicht nur von Einzelpersonen, sondern auch von professionellen Tourismusunternehmen. Die Hälfte aller auf Airbnb angebotenen Wohnungen in Barcelona liegt in den Händen von 200 Unternehmen, die mehrere Appartements vermarkten. Die Folge: Die steigenden Mieten im Zentrum verdrängten einen Teil der Bevölkerung an die Randbezirke, was auch dort wegen der gestiegenen Nachfrage die Preise in die Höhe trieb. Auch in anderen spanischen Städten folgte die Gentrifizierung diesem Muster, so Lladós.
Kehrtwende in Barcelona
Während beispielsweise Málaga mit einer erst im Januar 2025 eingeführten Quotenregelung für künftige Lizenzen eher zurückhaltend reagiert, hat Barcelona vergangenen Sommer eine radikale Kehrtwende angekündigt: Im November 2028 verlieren alle bestehenden Tourismuslizenzen ihre Gültigkeit, etwa 10 000 bisherige Ferienwohnungen sollen so dem regulären Wohnungsmarkt zugeführt werden. „Für uns überwiegt das Recht auf Wohnraum das Recht auf wirtschaftlicher Nutzung des Wohnraums“, so der sozialistische Bürgermeister Jaume Collboni kurz nach der Ankündigung in einem Radiointerview.6
Der Verband der Ferienappartement-Betreiber APARTUR reagierte mit massiven Protesten, der konservative Partido Popular rief wegen einer angeblichen Verletzung des Privateigentums das Verfassungsgericht an. Doch dieses lehnte die Beschwerde ab: Eine reguläre Vermietung sei weiter möglich und das „Recht auf Wohnraum“ von der Verfassung geschützt.7 Auch wenn Barcelonas Pläne juristische Rückendeckung erhalten haben, bleibt offen, ob sie tatsächlich den gewünschten Effekt erzielen. „Es gibt bisher keine Garantie, dass diese Wohnungen tatsächlich vermietet werden“, warnt Lladós. „Die Eigentümer könnten sie stattdessen auch einfach leer stehen lassen.“ Um die Wohnungsnot zu lindern, müsse man die strukturellen Probleme des Wohnungsmarkts angehen, in erster Linie das fehlende Angebot an Mietwohnungen.
Dazu trägt ganz erheblich der geringe Anteil von öffentlich gefördertem Wohnraum am Gesamtbestand bei. Nur 3,3 Prozent aller Wohnungen sind Sozialwohnungen, der europäische Durchschnitt liegt laut Eurostat bei acht Prozent.8 Das resultiert auch aus der langen Förderung von Wohneigentum. „Die Politik hat jahrzehntelang versucht, Spanien zu einem Land von Eigentümern zu machen“, sagt der Politologe Eduardo González de Molina.9
Bis 2013 wurde der Erwerb von Wohneigentum nicht nur steuerlich begünstigt, sondern war letztlich auch Ziel der staatlichen Wohnungsbaupolitik. Über die Hälfte der in den 1980er Jahren in Spanien gebauten Wohnungen waren von der öffentlichen Hand (ko-)finanzierte Sozialwohnungen, die zu gesetzlich geregelten Preisen an Familien mit geringem Einkommen verkauft wurden. Nach Ablauf einer fünf- bis 15-jährigen Frist konnten diese Wohnungen zu regulären Preisen auf dem freien Markt weiterverkauft werden. Das trieb nicht nur die Preise in die Höhe, sondern hielt auch den öffentlichen Wohnungsbestand über die Jahrzehnte verhältnismäßig klein. „Wären von den in Spanien bisher gebauten 6,5 Millionen Sozialwohnungen keine verkauft worden, hätten wir einen Anteil an öffentlichem Wohnraum von 20 Prozent – ähnlich wie Dänemark oder die Niederlande“, so González de Molina.
Die regierende Linkskoalition aus Sozialisten und der linken Sumar versucht gegenzusteuern: Durch Neubau und Umwidmung der Apartments aus dem Besitz der Bad Bank Sareb enstanden in den vergangenen fünf Jahren etwa 165 000 Wohnungen in öffentlicher Hand, weitere Bauprojekte sind angekündigt – für Miet- wie für Eigentumswohnungen. Vermietete Sozialwohnungen sollen künftig über eine neu geschaffene staatliche Einrichtung dauerhaft in öffentlicher Hand bleiben, verkaufte Sozialwohnungen sollen nicht mehr auf dem freien Markt gehandelt werden dürfen. Solche Bau- und Umwidmungsprojekte mindern zwar mittel- und langfristig das strukturelle Wohnungsdefizit, unmittelbare Abhilfe schaffen sie aber nicht.
Zweites Standbein der Wohnraumpolitik der Regierung von Pedro Sánchez ist das bereits 2023 reformierte Wohnraumgesetz.10 Es soll Mieterrechte stärken und die Preisentwicklung auf dem Mietmarkt stoppen. Bei laufenden Verträgen darf die Miete um nicht mehr als drei Prozent jährlich erhöht werden. In Gebieten mit stark angespanntem Wohnraumangebot – in Großstädten und an weiten Teilen der Mittelmeerküste – gilt eine Mietpreisbremse. Als „Meilenstein der Demokratie“ feierte Sánchez die Reform.
Modell Katalonien
Das Problem: Wichtige Bestimmungen werden bisher nicht angewandt. Denn in Spanien sind im Wesentlichen die autonomen Regionen für den Wohnungsbau zuständig. Und dort stellen überwiegend die Konservativen die Regierung, teils mit Unterstützung der rechtsextremen Vox. Und Spaniens Rechte verfolgt eine grundsätzlich andere Wohnraumpolitik als die Linke.
Die Rechte erklärt den Mangel an Wohnraum mit juristischer Unsicherheit, die viele Eigentümer davon abhalte, ihre Wohnung auf dem regulären Mietmarkt anzubieten und warnt vor „Besetzungen“ der Wohnungen durch säumige Mieter sowie vor Besetzungen von fremden Wohnungen, die im Fall sozialer Bedürftigkeit nach geltendem Recht nur durch ein Gerichtsverfahren beendet werden dürfen. Etwa 15 300 Anzeigen wegen illegaler Besetzung von fremdem Wohneigentum liegen landesweit derzeit bei Gericht, das Gros davon betrifft dauerhaft leerstehende Wohnungen.11Das Phänomen sorgt medial für große Aufmerksamkeit und dient der rechten Opposition als Rechtfertigung für eine Totalabsage an die Wohnraumpolitik der Linkskoalition. Die Konsequenz: Nur fünf der 17 Regionalregierungen haben bisher Vorschriften erlassen, die einer Liberalisierung von Sozialwohnungen einen Riegel vorschieben. Die Mietpreisbremse wird bisher nur in einer Kommune im Baskenland und rund 140 katalanischen Orten angewandt, darunter Barcelona.
In Katalonien scheint die Preisregulierung tatsächlich zu greifen. Um 6,4 Prozent sind die Mieten in der Mittelmeermetropole gesunken, um durchschnittlich 3,7 Prozent in allen katalanischen Gemeinden. Allerdings ist auch die Zahl der neu abgeschlossenen Mietverträge zurückgegangen, in Barcelona um 17 Prozent. Kritiker des Wohnraumgesetzes sehen darin den Beweis, dass die Preisregulierung Eigentümer vom Vermieten abschrecke. Allerdings könnte der Rückgang bei den abgeschlossenen Verträgen auch an einer gestiegenen Stabilität auf dem Mietmarkt liegen: 2019 wurde die Laufzeit von Mietverträgen von bisher drei Jahren auf fünf Jahre heraufgesetzt, die letzten Drei-Jahres-Verträge liefen 2022 aus.
Woran kein Zweifel besteht: Um die Mietpreisbremse zu umgehen, versuchen immer mehr Eigentümer, ihren Wohnraum monatsweise zu vermieten, für einen Zeitraum zwischen einem und zwölf Monaten, überwiegend an gutverdienende „Digital Nomads“. Diese Art der Kurzzeitmiete verspricht maximale Rentabilität und ist in gewisser Weise die Nachfolgerin der in Barcelona geschassten Ferienapartments. Kontrollmechanismen dafür gibt es noch nicht, die Stadtverwaltung will ein Register einführen.
Eine neue Empörtenbewegung?
Welche Sprengkraft besitzt Spaniens Wohnraumbewegung über punktuelle Aktionen oder die Demonstrationen von Anfang April hinaus? Aktivistinnen und Aktivisten der Sindicatos de Inquilinas und anderer Wohnraumkollektive betonen immer wieder ihre Distanz zu klassischen Institutionen. Statt den Schulterschluss mit Parteien zu suchen, setzen sie auf Selbstorganisation; in Städten wie Málaga wurden Nachbarschaftsräte gegründet, in denen Anwohnerinnen und Anwohner sich austauschen können.
Das erinnert an die Empörtenbewegung von 2011, als auf dem Höhepunkt der Finanzkrise tausende junge Menschen öffentliche Plätze besetzten und das traditionelle Parteiensystem ins Wanken brachten. Doch da enden nach Ansicht vieler Politologen die Parallelen. „Während damals eine ganze Generation gut ausgebildeter Spanierinnen und Spanier praktisch chancenlos einen Job suchte und das ganze System strauchelte, sind die makroökonomischen Daten heute viel bessere“, sagt Eduardo Bayón von der Universität von Nebrija.
Neue Parteien wie damals die linksalternative Podemos oder politische Karrieren wie die von Ada Colau, der aus der Aktivistenszene stammenden ehemaligen Bürgermeisterin von Barcelona, schließt er aus. An der existenziellen Tragweite des Problems ändert das allerdings nichts. Das Thema Wohnraum wird Spaniens Politik noch weiter beschäftigen.
1 CIS, Estudio 3502 Barómetro de Marzo 2025, S. 6.
2 Dmitry Khametshin, David López Rodríguez und Luis Pérez García: El mercado del alquiler de vivienda residencial en Espana. Documentos Ocasionales 2434.
3 Estudio sociodemográfico de los inquilinos en España, Observatorio del alquiler, observatoriodelalquiler.org, 26.11.2024.
4 Miquel-Àngel García López u.a., Do short-term rental platforms affect housing markets? Evidence from Airbnb in Barcelona, IEB Working Paper 2021/05.
5 Vgl. Preistreiber Airbnb: Wie die Plattform die Wohnungskrise in Spaniens Städten befördert. Interview mit Josep Lladós auf riffreporter.de, 9.3.2025.
6 Jaume Collboni im Interview mit Àngels Barceló, Cadena Ser, 5.7.2024.
7 Sentencia del Tribunal Constitucional, STC 798-2024, 13.3.2025.
8 Die Daten zu Spanien stammen aus: Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, Boletín especial Vivienda Social 2024, Januar 2025.
9 Interview geführt von der Autorin, Oktober 2024.
10 Ley de Arrendamientos Urbanos, aktualisierte Version 25.5.2023 (Ley 29/1994).
11 Denisse López und Nuria Morcillo, La paradoja de la okupación: cuando el miedo gana a la estadística, in: „El País“, 15.3.2025.