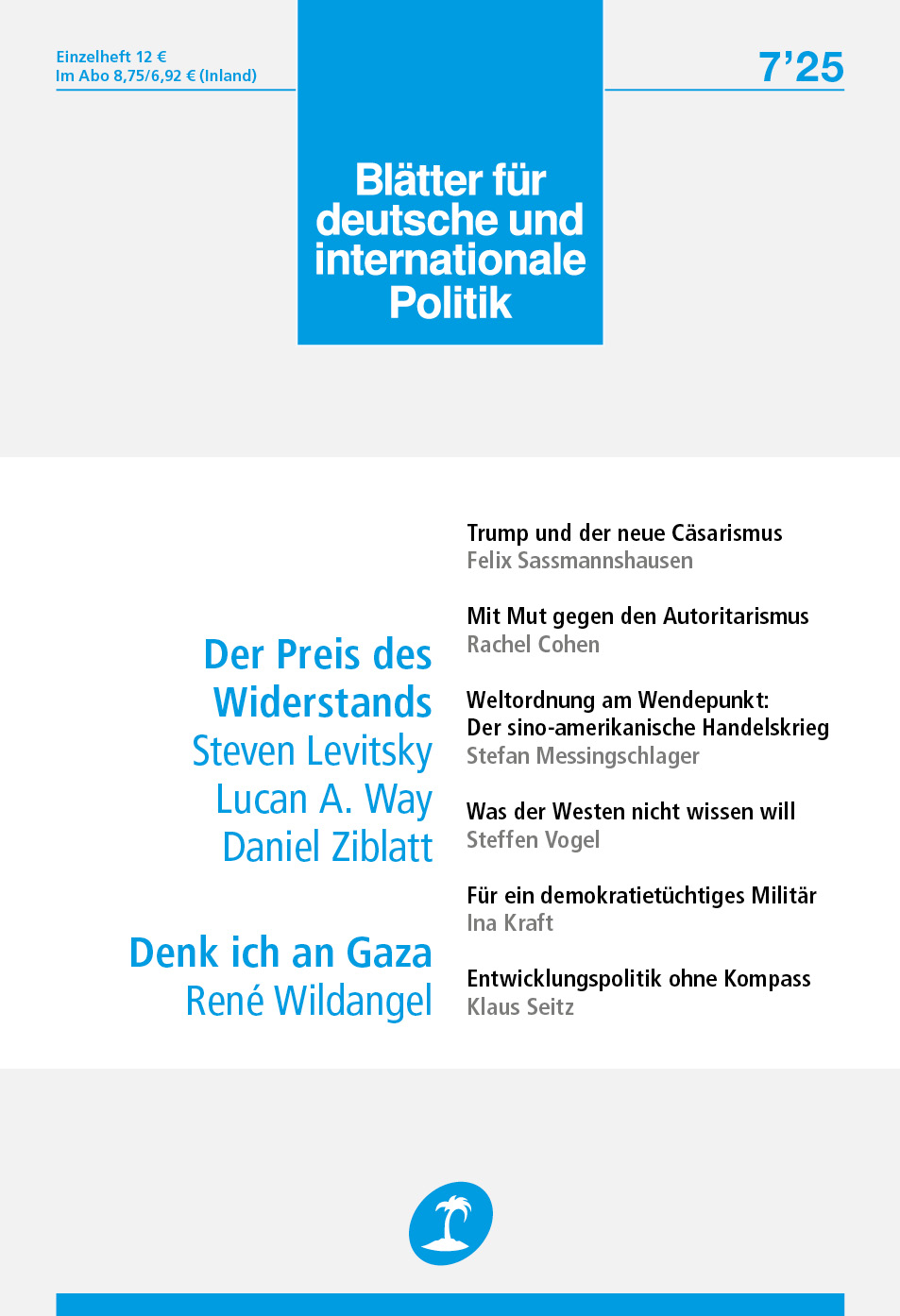Wie Entwicklungspolitik ihren Kompass verliert

Bild: Solaranlage in Namibia. Auch das BMZ engagiert sich für »saubere und sichere Energieversorgung«. Gleichzeitig behindert Deutschland durch die Auslagerung der Folgekosten unseres Produktions- und Konsumniveaus eine nachhaltige Entwicklung in anderen Ländern. (IMAGO / photothek)
Mit großer Erleichterung reagierten die entwicklungspolitisch Engagierten im In- und Ausland auf die Ressortverteilung, die CDU/CSU und SPD im April 2025 auf der vorletzten Seite ihres Koalitionsvertrags vorlegten: Ein Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) wird es vorerst weiterhin geben. Im Verlauf der Koalitionsverhandlungen hatte die Union noch darauf gedrängt, dass das BMZ abgeschafft und seine Aufgaben vom Auswärtigen Amt übernommen werden sollten. Bereits bei den Verhandlungen der Ampelkoalitionäre vor vier Jahren stand die Fortführung eines eigenständigen Entwicklungsressorts auf der Kippe. Inzwischen ist die Leitung des BMZ neu besetzt, mit Reem Alabali-Radovan (SPD), der mit 35 Jahren jüngsten Ministerin im Kabinett – und als Tochter irakischer Geflüchteter der einzigen mit Migrationsgeschichte –, die frischen Wind und neue Perspektiven in ihr Haus bringen dürfte.
Doch die Besorgnis, dass die Entwicklungspolitik in der neuen Legislaturperiode einen weiteren Bedeutungsverlust erleiden könnte, ist mit der Beibehaltung des BMZ noch nicht vom Tisch. Der Fortbestand des Ministeriums gilt nach Darstellung des CDU-Abgeordneten Peter Beyer nur „auf Bewährung“.[1] Zugleich kündigt der Koalitionsvertrag erhebliche Mittelkürzungen für die Entwicklungszusammenarbeit (EZ) an sowie sinkende Beiträge für internationale Organisationen. Ausdrücklich distanzieren sich die Koalitionäre von der UN-Vereinbarung, mindestens 0,7 Prozent des Bruttonationaleinkommens für Entwicklungsaufgaben und humanitäre Hilfe einzusetzen. Deutschland hat diese Quote bereits 2024, erstmals seit 2020, unterschritten. Neben den angekündigten finanziellen Schrumpfungen ist es vor allem die im Koalitionsvertrag vereinbarte strategische Neuorientierung, die die Zukunftsfähigkeit des Politikfelds gefährdet. Die Absicht, Entwicklungspolitik zukünftig entlang der außen-, sicherheits- und wirtschaftspolitischen Interessen Deutschlands auszurichten, rüttelt an dem Wertekonsens, der die deutsche Entwicklungspolitik über Jahrzehnte geprägt hat.
In ihrer mehr als sechs Dekaden umfassenden Geschichte stand die Entwicklungspolitik immer wieder unter Rechtfertigungsdruck. So alt wie die staatliche EZ ist auch die Kritik an ihr. Schon kurz nach Gründung des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit[2] im Jahr 1961 sah sich der damalige deutsche Exekutivdirektor bei der Weltbank, Otto Donner, genötigt, einem allgemeinen „Unbehagen über die Entwicklungshilfe“[3] entgegentreten zu müssen. Und der erste Entwicklungsminister, Walter Scheel (FDP), war erst wenige Monate im Amt, da geisterte bereits die Meldung durch den Blätterwald, die Ehefrau eines ghanaischen Regierungsmitglieds habe sich mit deutschen Entwicklungsgeldern ein goldenes Bett zugelegt. „Da taucht also die Entwicklungshilfe wieder auf, die wir uns vom Munde absparen“, schimpfte die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ (FAZ) im April 1962. Obwohl der Verdacht seinerzeit schnell widerlegt werden konnte, begleitete die giftige Assoziation mit „goldenen Betten“ die Entwicklungspolitik über Jahrzehnte, um heute vom Verweis auf „Fahrradwege in Peru“ als Mantra populistischer Entwicklungshilfekritik abgelöst zu werden.
Der Vorwurf, staatliche Entwicklungsgelder wären nutzlos oder würden missbräuchlich verwendet, markiert nur einen Strang der Kritik. Sehr viel grundsätzlicher ist der verstärkt geäußerte Zweifel, inwieweit wir überhaupt dazu verpflichtet sein sollten, Menschen in anderen Ländern Unterstützung zu gewähren. So begründete etwa FDP-Vize Wolfgang Kubicki seine Forderung nach einer drastischen Kürzung der deutschen Entwicklungsleistungen mit der Beobachtung eines vermeintlich weit verbreiteten Gefühls, „dass der Staat immer Geld für andere hat, aber nicht für die eigenen Bürger“.[4]
Die Frage, ob Entwicklungszusammenarbeit wirksam ist und ihre Ziele erreicht, muss mit empirischen Argumenten beantwortet werden. Die kontinuierliche Prüfung dieser Frage, durch Evaluationen, Finanzaudits oder Wirkungsstudien gehört zum Alltagsgeschäft entwicklungspolitischer Organisationen. Die EZ zählt zu den am stärksten evaluierten Bereichen öffentlicher Finanzierung. Von der empirischen Frage zu unterscheiden ist die normative Frage, inwieweit es für die Regierung eines wohlhabenden Landes geboten ist, die Anliegen von Staaten des Globalen Südens zu unterstützen und Menschen in Not beizustehen. Dabei handelt es sich um eine Problemstellung, die auf eine ethische Begründung verweist. Davon soll hier die Rede sein. Denn hinter dem politischen Streit um Nutzen, finanzielle Ausstattung und institutionelle Aufstellung der staatlichen Entwicklungszusammenarbeit kommt eine normative Legitimationskrise der Entwicklungspolitik zum Vorschein.
Der jahrzehntelange Konsens, dass ein entwicklungspolitisches Engagement unseres Landes relevant und geboten sei, ist brüchig geworden. Dieser Trend lässt sich nicht nur in Deutschland beobachten. Auch die jüngsten drastischen Kürzungen der Entwicklungsetats in den Niederlanden, in Großbritannien oder in den USA lassen sich nicht mehr als vorübergehende konjunkturelle Schwankungen erklären, sondern sind Anzeichen für eine Erschütterung der Grundlagen der Entwicklungspolitik in weiten Teilen des „Westens.“ Die Mittelkürzungen gehen einher mit der Demontage entwicklungspolitischer Institutionen und einer Umwidmung des entwicklungspolitischen Auftrags, der nunmehr auf den Nutzen für nationale Eigeninteressen der Geberstaaten begrenzt werden soll. Oder der – im Falle der Entwicklungspolitik der EU – den wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Interessen der EU dienen soll, wie dies der zuständige Kommissar Jozef Síkela vertritt. Friedrich Merz erklärte in seiner außenpolitischen Grundsatzrede bei der Körber-Stiftung im Januar 2025: „Entwicklungszusammenarbeit muss integraler Bestandteil einer vor allem von unseren Interessen geleiteten Außen- und Wirtschaftspolitik werden.“[5] Von diesem instrumentellen Verständnis, das die EZ als ein Mittel zur Durchsetzung nationaler Interessen begreift, ist der Schritt nicht mehr weit, ein eigenes Politikfeld „Entwicklungspolitik“ als überflüssig zu erachten.
Weltweit schwindender Rückhalt für Entwicklungszusammenarbeit
Infolge der Coronapandemie, des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine und des Aufschwungs rechtspopulistischer Kräfte hat die EZ in Parlament und Gesellschaft erheblich an Rückhalt verloren. Auch seitens der deutschen Öffentlichkeit ist nur wenig Protest gegen das Zurückfahren des entwicklungspolitischen Engagements zu erwarten. Der letzte Meinungsmonitor des Deutschen Evaluierungsinstituts der Entwicklungszusammenarbeit[6] stellt eine rückläufige Unterstützung fest. So habe sich der Bevölkerungsanteil, der Kürzungen der deutschen Entwicklungsleistungen für erforderlich hält, seit Januar 2022 verdoppelt, auf nunmehr 44 Prozent der Befragten. Eine „moralische Verpflichtung“ für internationale Hilfe sehen nur 29 Prozent der Bevölkerung in Deutschland. Nach einer Studie des Meinungsforschungsinstituts Pollytix von 2024[7] stimmen zwei Drittel der Deutschen der Aussage zu, Deutschland solle mehr für die eigene Bevölkerung tun, statt den Entwicklungsländern unter die Arme zu greifen. Allein innerhalb des Jahres 2023 ist der Anteil der Befragten, die sich dafür aussprechen, dass sich die Bundesrepublik nur dann in der Entwicklungspolitik engagieren soll, wenn sie selbst davon profitiert, um sieben Prozent auf nunmehr 38 Prozent gestiegen.
Auch in der Vergangenheit kam es vor, dass Repräsentanten staatlicher Entwicklungspolitik eine ethische Begründung der Entwicklungspolitik bestritten haben. So ließ das BMZ in seinem Jahresbericht 1985 verlauten: „Wir leisten Entwicklungshilfe nicht aus Tributpflicht. Entwicklungspolitik ist keine Politik des schlechten Gewissens.“ Minister Dirk Niebel (FDP), bekräftigte ein Vierteljahrhundert später, dass sein Ministerium schließlich kein „Weltsozialamt“ sei. Aber dies waren eher punktuelle Episoden, während wir es heute mit einem grenzüberschreitenden Trend zu tun haben, der darauf zielt, jeden ethischen Kern der Entwicklungspolitik auszuhöhlen, indem die Bedienung nationaler Eigeninteressen der Geberstaaten als deren wesentliche Leitorientierung vorausgesetzt wird. Im Mittelpunkt stehen dabei meist – so auch im aktuellen Koalitionsvertrag – drei Interessenssphären: Entwicklungszusammenarbeit soll der eigenen Wirtschaft nutzen, die nationale Sicherheit erhöhen und dazu beitragen, irreguläre Migration einzudämmen.
Kalkulierter Eigennutz
Auch in der Entwicklungsforschung werden Stimmen laut, die zur Betonung von Eigeninteressen in der Entwicklungspolitik raten und einen ethischen Begründungsbedarf bezweifeln. Sie tun dies vielfach in der Absicht, der unter Druck geratenen Entwicklungspolitik den Rücken zu stärken. So schreibt der ehemalige Chef des German Institute for Global and Area Studies, Robert Kappel: „Moral darf in der Begründungslogik staatlicher EZ keine Rolle spielen. Karitative Ansätze lassen sich problemlos mit Blick auf freiwillig agierende Privatpersonen legitimieren. Staatliche EZ aber kann sich nur an Interessen orientieren.“[8] Auch Stefan Klingebiel vom German Institute of Development and Sustainability hält eine humanitäre Begründung der EZ für nicht mehr zeitgemäß: „Entwicklungspolitik gilt oft als rein altruistisch und humanitär, wobei sie jedoch vielmehr als Soft-Power-Instrument zu verstehen ist. Ein solches Verständnis könnte helfen, sich vom einengenden Diskurs über Werte und Interessen zu lösen.“[9] Bedeutet dies, dass wertorientierte Motive nur für NGOs und Kirchen relevant sind, in der staatlichen Entwicklungspolitik aber nichts verloren haben?
Das BMZ kündigte den 17. Entwicklungspolitischen Bericht der Bundesregierung im vergangenen Herbst mit folgenden Worten an: „Entwicklungspolitik ist nicht nur ein Gebot von Menschlichkeit und Anstand, sondern liegt auch in Deutschlands ureigenstem Interesse. Der Wohlstand unserer Exportnation und unsere Sicherheit bauen auf starken internationalen Partnerschaften auf.“[10] Mit dem Verweis auf Menschlichkeit und Anstand wird hier durchaus ein ethisches Argument bemüht. Doch was trägt der Verweis auf das Eigeninteresse zur Begründung der Entwicklungspolitik bei? Es ist bezeichnend, dass vom BMZ der Beitrag zum „Wohlstand unserer Exportnation“ hervorgehoben wird. In der Vergangenheit war des Öfteren von einem „wohlverstandenen Eigeninteresse“ die Rede, welches über ein egoistisches Eigeninteresse hinausgeht und auf ein gemeinsames Anliegen zielt, aus dem alle Beteiligten Nutzen ziehen können. Aber da hier mit Verweis auf Deutschlands Exportinteressen ausdrücklich ein „ureigenstes“ Interesse betont wird, ist nicht ein gemeinschaftliches Wohl gemeint, sondern ein eigennütziges Interesse, dessen Verfolgung im Zweifel auf Kosten anderer eingelöst wird. Damit wäre das Argument als ein ethisches disqualifiziert, insofern Ethik immer etwas damit zu tun hat, Positionen zu dezentrieren, also ihre Legitimität im Lichte der Positionen anderer intersubjektiv darzulegen und abzugleichen.
Die Illusion harmonischer Win-win-Lösungen
In der Politikwissenschaft wird unter „Interesse“ eine selbstbezogene, kalkulierte Handlungsorientierung verstanden, die darauf abzielt, die eigene Position zu verbessern. Ihr gegenüber steht eine prosoziale, an moralischen Prinzipien, Werten oder an einer Verpflichtung orientierte uneigennützige Handlungsmotivation.[11] Der Versuch, mit dem Begriff eines aufgeklärten oder wohlverstandenen Eigeninteresses zwischen beiden Polen zu vermitteln, verschleiert, dass die Weltgesellschaft von einer Vielzahl konkurrierender Interessenkonstellationen geprägt ist, die schwerlich in einem „gemeinsamen“ Interesse aufgelöst werden können. Die Überwindung der dramatischen sozialen Ungleichheit oder die Einhaltung der planetaren Grenzen wird mit dem Verlust von Privilegien der bisher Privilegierten einhergehen müssen, was gewiss nicht in deren unmittelbarem „Interesse“ liegt. Es wird nicht für alle globalen Herausforderungen harmonische Win-win-Lösungen geben. Eine wichtige Aufgabe der Entwicklungspolitik besteht nicht zuletzt darin, die Interessen der unterprivilegierten Anderen, die nicht im eigenen Interessenkalkül Berücksichtigung finden, zur Geltung zu bringen.
Der Verweis auf das Eigeninteresse hat im zitierten Beispiel aus dem BMZ-Bericht eher die Funktion einer Output-Legitimation der Entwicklungspolitik: Es nützt uns, wenn wir die Verhältnisse in anderen Ländern verbessern helfen, weil wir dadurch neue Absatzmärkte für unsere Wirtschaft erschließen. Dafür gibt es im genannten Fall durchaus empirische Evidenz.[12] Doch dergleichen Legitimationsstrategien können sich als Bumerang erweisen, wenn sich die Versprechen des Nutzens für uns nicht einlösen lassen. Man denke nur an das Argument, EZ würde Fluchtursachen bekämpfen und dadurch den Migrationsdruck mindern, oder an den Versuch, Entwicklungspolitik nach den Anschlägen vom 11. September 2001 als Terrorismusprävention anpreisen zu wollen.[13] Mit dem instrumentellen Eigennutzargument, das die öffentliche Akzeptanz erhöhen soll, erweisen sich die Verteidiger der Entwicklungspolitik einen Bärendienst, zumal sie jeden Anspruch einer funktionalen Autonomie der Entwicklungspolitik preisgeben.
Ähnliches trifft auf Versuche zu, der EZ Erfolge zuschreiben zu wollen, die sie nicht wirklich für sich verbuchen kann. Wenn darauf verwiesen wird, dass die Reduzierung des Anteils der Menschen, die unter extremer Armut leiden müssen, der EZ zu verdanken sei, so führt das in die Irre. Die makroökonomischen Fortschritte der einst besonders von Armut betroffenen bevölkerungsreichen Länder haben andere Ursachen. Die EZ sollte sich davor hüten, in die selbst aufgestellte Omnipotenzfalle zu tappen. Der Umfang der Transfers, die im Rahmen der EZ fließen, ist, verglichen mit den Mitteln, die für entwicklungsschädliche Maßnahmen ausgegeben werden, zu marginal, um eine Hebelwirkung für die gesamte südliche Hemisphäre auslösen zu können. So beliefen sich allein die weltweiten Rüstungsausgaben im Jahr 2024 laut SIPRI auf 2,7 Bill. US-Dollar und lagen damit über dem Zwölffachen der Entwicklungsausgaben (ODA), die im selben Jahr 212 Mrd. US-Dollar betrugen. Dabei nimmt das Missverhältnis weiter zu: Während die staatlichen Entwicklungsleistungen 2024 um 7,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr geschrumpft sind, wurden für Rüstung 9,4 Prozent mehr ausgegeben.
Entgegen allen Absichtserklärungen steigen nach wie vor auch die Ausgaben für die Subventionierung klimaschädlicher Energien. Allein die G7-Staaten steckten, so eine Studie des Forums Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft[14], 2023 über 1,36 Bill. US-Dollar in die Subventionierung fossiler Brennstoffe, 15 Prozent mehr als noch 2016. Dergleichen Subventionen befeuern die Klimakrise, die die Lebensverhältnisse vor allem in den vulnerablen Ländern massiv verschlechtert. Auch andere Effekte der Handels- und Finanzbeziehungen, die von den Industrieländern ausgehen, sind für den Globalen Süden nachteilig. Dies wirft ein schlechtes Licht auf die scheinbaren Entwicklungserfolge der wohlhabenden Länder. So liegt Deutschland im Ranking bei der Erreichung der Sustainable Development Goals (SDG), der Ziele für nachhaltige Entwicklung, im Inland auf einem stolzen 4. Platz, hinsichtlich unserer sogenannten Spillover-Effekte finden wir uns allerdings nur auf Platz 146 (von 166) wieder.[15] Das bedeutet: Wir behindern durch die Auslagerung der Folgekosten unseres Produktions- und Konsumniveaus eine nachhaltige Entwicklung in anderen Ländern. Zu all diesen schädlichen Einflüssen kommt noch hinzu, dass die Transfers von Nord nach Süd vom Umfang der Rückflüsse erheblich übertroffen werden. Viele Entwicklungsländer verlieren durch Gewinnrückflüsse, Zins- und Kreditzahlungen und illegale Finanztransfers mehr Geld an Industrieländer, als sie durch Investitionen, Entwicklungsgelder und Kredite erhalten.[16]
Jean Ziegler hatte angesichts solcher Asymmetrien bereits 2007 den Schluss gezogen: „Es kommt nicht darauf an, den Menschen der Dritten Welt mehr zu geben, sondern ihnen weniger zu stehlen.“[17] Das schließt keinesfalls aus, dass ein „mehr Geben“ nach wie vor gefordert sein mag. Es nützt freilich wenig, wenn den zerstörerischen Auswirkungen einer imperialen Wirtschafts- und Lebensweise kein Einhalt geboten wird. „Do no harm“ ist, neben der Verpflichtung auf den solidarischen Beistand in Notlagen, ein zweites grundlegendes Gebot jeder internationalen Kooperation. Die grenzüberschreitende Unterstützung im Falle humanitärer Katastrophen gehört zum Mandat der humanitären Hilfe. Es ist weitgehend unstrittig, dass diese uneigennützig zu erfolgen hat.
Internationale Kooperation als wertebasierte Weltinnenpolitik
„Do no harm“ wiederum bezieht sich nicht nur auf die Vermeidung unbeabsichtigter negativer Folgen humanitärer Maßnahmen, sondern bedeutet aus entwicklungspolitischer Sicht auch, darauf hinzuwirken, dass eine normative Kohärenz aller Politikfelder, die sich auf Menschen in anderen Ländern auswirken, hergestellt wird. Es sollte selbstverständlich sein, dass Entscheidungen der Landwirtschafts- oder Verkehrspolitik ebenso wenig auf Kosten Dritter gehen wie die Gestaltung unserer weltumspannenden Lieferketten. Idealerweise sollte unsere Art des Wirtschaftens entwicklungsförderliche Effekte für andere Gesellschaften und für das globale Gemeinwohl haben. Das Verständnis von Entwicklungspolitik als Beitrag zu einer „Globalen Strukturpolitik“ hat dies aufgegriffen.[18] Letztlich sollte sich kein Politikfeld einer weltinnenpolitischen Verantwortung entziehen können, insofern als alle Politik vereinbar sein muss mit dem Schutz der planetaren Lebensgrundlagen zum einen und dem Wohlergehen aller Menschen zum anderen.
Doch was ist dann das Proprium der Entwicklungspolitik, ihr funktionsspezifisches Mandat, das auch ein eigenständiges Ministerium für diese Zuständigkeit rechtfertigen kann? Sie hat vor allem die Funktion, die Perspektiven des Globalen Südens in die Gesamtpolitik hineinzuvermitteln und die Umsetzung der eigenen Anliegen dieser Länder kooperativ zu unterstützen. Mit der Entwicklungspolitischen Konzeption von 1971 wurde unter Minister Erhard Eppler (SPD) erstmals eine eigenständige Strategie vorgelegt, die die westdeutsche Entwicklungspolitik von den Fesseln außen- und wirtschaftspolitischer Eigeninteressen emanzipierte. In ihr wurde „die Förderung des wirtschaftlichen und sozialen Fortschritts der Entwicklungsländer in einem System weltweiter Partnerschaft, um die Lebensbedingungen der Bevölkerung in diesen Ländern zu verbessern“, als Kernanliegen benannt.[19] Das entspricht auch heute noch dem Verständnis der Entwicklungszusammenarbeit, das auch der Definition der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für die Official Development Assistance (ODA) zugrunde liegt. Inzwischen mehren sich allerdings die Zweifel, ob eine Begrenzung auf „Entwicklungsländer“ noch angemessen ist – und daran ändert sich wenig, wenn man vom „Globalen Süden“ spricht. Mit der Agenda 2030 der Vereinten Nationen wurde eine Universalisierung der Entwicklungsagenda vorangebracht, die im Lichte der Anforderungen an eine nachhaltige Entwicklung alle Länder als fehlentwickelt begreift. Auch wenn die EZ-Institutionen heute gerne davon sprechen, dass man die Lebensverhältnisse der Menschen „weltweit“ verbessern möchte, so tun sie sich doch schwer damit, dieser universellen Perspektive Rechnung zu tragen – auch angesichts der überkommenen ODA-Kriterien der OECD. Dazu kommt der historische Ballast eines hegemonialen Entwicklungsverständnisses, mit dem dieses Ressort begrifflich verstrickt ist.[20]
Ein Politikfeld wie die Entwicklungspolitik, das auf internationale Kooperation bei der Bewältigung der globalen Zukunftsfragen zielt, ist in der heutigen Weltlage gleichwohl notwendiger denn je. Es wird sich allerdings neu aufstellen müssen. Vorschläge, das Ressort zukünftig vom fragwürdigen Entwicklungsparadigma zu lösen und stattdessen als „Ministerium für internationale Zusammenarbeit“ zu begreifen, antworten auf diese Herausforderung. Sie sind jedenfalls eher zukunftsweisend als ebenfalls kursierende Positionen, die eine Verengung auf die wirtschaftliche Zusammenarbeit anraten. Die Konzentration auf grenzüberschreitende Kooperation und auf die Finanzierung globaler öffentlicher Güter wäre auch anschlussfähig an völkerrechtliche Normen. Erstaunlich unterbelichtet blieb zuletzt in der deutschen Diskussion, dass die internationale Solidarität und die Verpflichtung des wechselseitigen Beistands zwischen den Staaten auch eine völkerrechtlich verbindliche Grundlage haben. So bekennen sich die Unterzeichnerstaaten der Charta der Vereinten Nationen zur Zielsetzung, „eine internationale Zusammenarbeit herbeizuführen, um internationale Probleme wirtschaftlicher, sozialer, kultureller und humanitärer Art zu lösen und die Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten für alle zu fördern“. Und der Internationale Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte aus dem Jahr 1966 verpflichtet die Vertragsstaaten in Artikel 2.(1) „einzeln und durch internationale Hilfe und Zusammenarbeit unter Ausschöpfung aller seiner Möglichkeiten Maßnahmen zu treffen, um die volle Verwirklichung der in diesem Pakt anerkannten Rechte zu erreichen“. Mit der Anerkennung der Menschenrechtspakte gehen auch die Staatenpflichten einher, diese Menschenrechte aktiv zu respektieren, zu schützen und zu gewährleisten – und dies nicht nur national, sondern auch exterritorial.
Eine menschenrechtlich fundierte kooperative Friedensordnung, von der wir freilich noch weit entfernt sind, würde gewiss auch im Interesse Deutschlands liegen. In einer eng verflochtenen und zugleich gefährdeten Welt ist unser eigenes Wohlergehen mehr denn je vom Wohlergehen aller abhängig. Seine Legitimation gewinnt der Einsatz für eine wertebasierte weltgesellschaftliche Ordnung jedoch nicht durch die Aufrechnung von Interessen, sondern aus dem Nachweis, dass eine solche Ordnung völkerrechtlich anerkannt, dass sie aus ethischen Gründen geboten und regellosen und von Gewalt beherrschten Weltverhältnissen vorzuziehen ist. Politik kommt ohne einen ethischen Kompass nicht aus. Das gilt erst recht für die Entwicklungspolitik, die auf dem schwierigen Gelände weltweiter Beziehungen agiert.
[1] Christopher Ziedler, Entwicklungsministerium auf Bewährung: Ist die neue Chefin die richtige, um es in die Zukunft zu retten?, tagesspiegel.de, 10.5.2025.
[2] Den heutigen Namen „Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung“ führt das BMZ erst seit 1993.
[3] Otto Donner, Zum Unbehagen über die Entwicklungshilfe, Berlin 1962.
[4] „Projekte vollständig auf Prüfstand“: Kubicki will bei Entwicklungshilfe drastisch sparen, tagesspiegel.de, 23.12.2023.
[5] Außenpolitische Grundsatzrede, Körber Global Leaders Dialogue, cducsu.de, 23.1.2025.
[6] Deutsches Evaluierungsinstitut der Entwicklungszusammenarbeit (Hg.), Meinungsmonitor Entwicklungspolitik 2024. Öffentliche Unterstützung und Kritik im Kontext multipler Krisen und neuer Leitbilder, Bonn 2024.
[7] Pollytix Strategic Research GmbH (Hg.), Perspektiven auf Entwicklungspolitik, Berlin 2024.
[8] Thomas Bonschab und Roland Kappel, Nach den Etatkürzungen. Welche Entwicklungszusammenarbeit will Deutschland?, In: Thomas Bonschab, Roland Kappel und Stefan Klingebiel (Hg.), Deutsche Entwicklungspolitik in der Diskussion, Berlin, Bonn und Frankfurt a. M. 2025, S. 28.
[9] Stefan Klingebiel, „Offene strategische Autonomie“: Eine entwicklungspolitische Standortbestimmung und Positionierung für die deutsche Entwicklungspolitik, IDOS Policy Brief, 26/2024, Bonn 2024.
[10] 17. Entwicklungspolitischer Bericht, bmz.de, 11.12.2024.
[11] Vgl. Ulrich Willems. Entwicklung, Interesse und Moral. Die Entwicklungspolitik der Evangelischen Kirche in Deutschland, Opladen 1998.
[12] Vgl. Neue Studie: Ausgaben für Entwicklungszusammenarbeit schaffen Wohlstand und Arbeitsplätze in Deutschland, KfW Entwicklungsbank, kfw.de, 30.10.2024.
[13] Vgl. Klaus Hirsch und Klaus Seitz (Hg.), Zwischen Sicherheitskalkül, Interesse und Moral. Beiträge zur Ethik der Entwicklungspolitik. Frankfurt a. M. 2007.
[14] FÖS, Leere Versprechungen, Eine Studie im Auftrag von Greenpeace, Berlin 2025, foes.de.
[15] Spillover Rankings. The spillover performance of all 193 UN Member States, Sustainable Development Report, dashboards.sdgindex.org/rankings/spillovers.
[16] Vgl. Trade-Related Illicit Financial Flows in 134 Developing Countries 2009-2018, gfintegrity.org, 16.12.2021; erlassjahr.de und Misereor (Hg.), Schuldenreport 2025, Düsseldorf und Aachen 2025.
[17] Jean Ziegler, Das Imperium der Schande, München 2007.
[18] Vgl. Heidemarie Wiezcorek-Zeul, Nachhaltige Entwicklung durch Globale Strukturpolitik, in: „Vereinte Nationen“, 3/1999, S. 100-103.
[19] Entwicklungspolitische Konzeption der Bundesrepublik Deutschland für die Zweite Entwicklungsdekade, Bulletin Nr. 25, 17.2.1971, S. 264.
[20] Vgl. Wolfgang Sachs, Die Ära der Entwicklung: Das Ende eines Mythos, in: „Blätter“, 8/2020, S. 79-89.