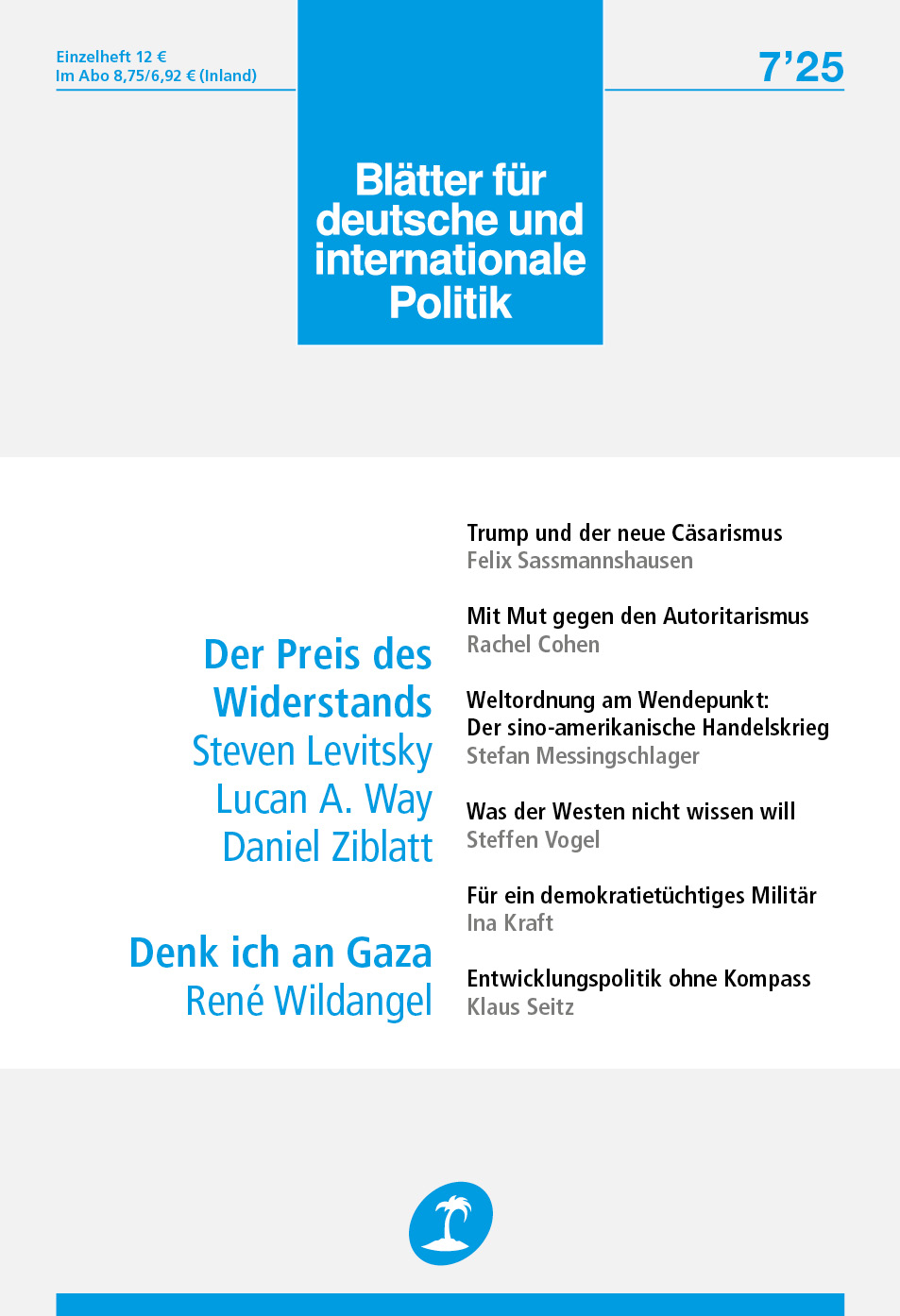Bild: Ghana ist der weltweit zweitgrößte Kakaoproduzent. Doch Extremwetter und Schädlingsbefall setzen den Plantagen zu. Foto aus Suhum, Ghana, 11.1.2024 (IMAGO / Joerg Boethling)
Nicht erst zu Ostern dürften es deutsche Verbraucher gespürt haben: Der Preis für Kakao befindet sich derzeit auf einem Rekordhoch. Eine Tafel Ritter Sport Schokolade beispielsweise kostet mittlerweile oft zwei Euro; durchschnittlich ist der Preis für Schokolade gegenüber dem Vorjahr um 15 Prozent gestiegen.[1] Die Gründe dafür sind vielschichtig: So sind höhere Produktionskosten in Europa für den Anstieg verantwortlich, vor allem aber geht dieser auf eine sinkende Kakaoproduktion in den Hauptanbauländern zurück. Das zeigt sich speziell in Ghana, dem weltweit zweitgrößten Kakaoproduzenten (nach der Elfenbeinküste). Die Frucht ist tief in der Kultur des westafrikanischen Landes verwurzelt, ihre Bohne findet sich in Liedern und Sprichwörtern, ist auf Münzen geprägt und in Denkmälern verewigt. Mit rund 60 Prozent macht Kakao den Löwenanteil der ghanaischen Agrarexporte aus und trägt etwa 20 Prozent zu den Exporterlösen bei. 2023 erwirtschafteten die ghanaischen Kakaoexporte rund 2,2 Mrd. US Dollar. Doch nach einem Rekord im Jahr 2021 mit mehr als einer Million Tonnen befindet sich Ghanas Kakaoproduktion im Sinkflug. Schätzungen gehen davon aus, dass die diesjährige Ernte um ein Drittel geringer ausfallen wird als üblich.
Extremwetter, Schädlingsbefall und Krankheiten setzen den Plantagen zu. Gleichzeitig wird der Beruf des Kakaobauern immer unattraktiver. Als 2024 die Preise für Kakao durch die Decke schossen, kam davon bei den Bauern in Ghana wenig an. Während auf dem Weltmarkt der Preis pro Tonne auf mehr als 11 500 Euro stieg, zahlte Ghanas staatliche Kakaobehörde Cocobod ihren Bauern lediglich 3150 Euro pro Tonne aus. Grund dafür ist die gesetzliche Regelung, der zufolge die Preise bereits vor der Saison von der Behörde festgelegt werden.
Sollte dieses Vorgehen den Herstellern eigentlich Stabilität garantieren und die Bauern vor den Schwankungen des Weltmarktpreises schützen, verhindert es nun, dass diese von dem enormen Preisanstieg profitieren. Vielmehr ist der Kakaoanbau angesichts von Inflation für die Bauern mittlerweile zu einem Verlustgeschäft geworden. Stattdessen profitieren vor allem große Schokoladenproduzenten in Europa von den planbaren und günstigen Rohstoffpreisen.
Gerade große Hersteller wie Mondelez, Nestlé und Ferrero sichern sich oft mit langfristigen Verträgen ab und lagern große Vorräte an Kakao ein, um starke Preisschwankungen an den Märkten abzufedern. Zudem findet der gewinnbringende Teil der Kette – die Verarbeitung der Rohware – größtenteils in Europa statt. Bei den Bauern, die den Rohstoff in Jahren harter Arbeit produzieren, kommt davon nur wenig an. Laut dem entwicklungspolitischen Netzwerk Inkota verdienen Kakaobauern in Ghana und der Elfenbeinküste an einer handelsüblichen Vollmilchschokolade durchschnittlich nur rund acht Cent und erwirtschaften keinen Gewinn. Eine Existenzsicherung ist damit nicht möglich.
Es überrascht daher wenig, dass mittlerweile immer mehr Bauern die Arbeit in den Kakaoplantagen aufgeben und sich dem Goldschürfen widmen. Denn während ein Tag als landwirtschaftlicher Helfer auf einer Kakaoplantage nur etwa 100 Ghana Cedi (rund 6,50 Euro) an Tageslohn einbringt, verspricht die Goldförderung bis zu 600 Cedi (etwa 40 Euro) täglich. Eine enorme Differenz, die angesichts von hoher Inflation und wirtschaftlicher Unsicherheit entscheidend ist.
Verseuchte Böden und Gewässer
Der schnelle Profit aus dem Goldabbau erscheint vielen Bauern als einziger Ausweg aus der Armut. Das gilt umso mehr, als das Land seit 2022 in einer schweren Wirtschaftskrise steckt. Ausgelöst durch hohe Verschuldung, Inflation und externe Schocks wie die Coronapandemie sind die Lebenshaltungskosten hoch und gut bezahlte Arbeitsstellen dünn gesät.
Doch der Goldabbau findet oft illegal statt und wird zunehmend zu einer Belastungsprobe für Mensch und Natur. Immer mehr unregulierte Goldminen entstehen im ganzen Land, denn Ghanas Erde ist reich an dem Edelmetall. Mit rudimentären Mitteln – und unter Verwendung hochgiftiger Substanzen wie Quecksilber – waschen vornehmlich junge Männer die Erde aus, um winzige Goldpartikel zu sammeln. Es ist ein finanziell sehr lukratives Geschäft, doch die Folgen für Menschen und Umwelt sind katastrophal. Zurück bleiben abgeholzte und verseuchte Landstriche, denn wo Galamsey[2], wie der illegale Goldabbau auch genannt wird, betrieben wurde, ist der landwirtschaftliche Anbau in der Regel nicht mehr möglich.
Besonders betroffen davon ist Ghanas Kakaosektor. Denn die verseuchten Böden und verschmutzten Gewässer gefährden auch jene landwirtschaftlichen Flächen, auf denen Kakaobäume gedeihen. Ghana steht also vor einer doppelten Herausforderung: Einerseits werden wertvolle Anbauflächen durch den illegalen Bergbau zerstört, andererseits ziehen vor allem junge Menschen die schnellen Gewinne des Goldabbaus zunehmend der mühsamen Kakaoproduktion vor.
Hinzu kommt, dass die verseuchten Böden und verschmutzten Gewässer auch die Trinkwasserversorgung gefährden: Als Ghanas staatlicher Trinkwasserhersteller, die Ghana Water Company Limited, im August 2024 bekannt gab, aufgrund der hohen Verschmutzung des Flusses Pra die Städte Cape Coast und Elmina nicht mehr mit Trinkwasser versorgen zu können, zogen in der Hauptstadt Accra zutiefst gefrustete Bürgerinnen und Bürger durch die Straßen. Es war der Protest gegen eine Krise, die seit langem bekannt ist und absehbar war. „Etwa 60 Prozent des Einzugsgebiets sind aufgrund des illegalen Bergbaus verschlammt, was die Wasserqualität beeinträchtigt“, hieß es in der Pressemitteilung der Wassergesellschaft.[3]
Die Umweltverschmutzung infolge des Goldabbaus wirkt sich auch auf die Gesundheit der Menschen aus: Während umfassende medizinische Studien noch rar sind, berichten Ärzte in den betroffenen Regionen von einer drastischen Zunahme von Krebserkrankungen, Nierenschäden und Fehlbildungen bei Neugeborenen.
Die Entwicklungen in Ghana lassen sich nicht losgelöst von den wirtschaftlichen Interessen europäischer Unternehmen betrachten. Während internationale Schokoladenkonzerne von der Kakaopreisregelung in Ghana profitieren, wird die Goldnachfrage durch die Finanzmärkte in London, New York und Zürich gesteuert. Der weltweite Goldpreis erreichte Ende 2024 ein Rekordhoch von fast 3000 US-Dollar je Feinunze. Getrieben wird der Preis durch eine Kombination aus Inflation und politischer Unsicherheit. Vor allem Donald Trumps protektionistische Handelspolitik und die Sorge vor einem internationalen Handelskrieg haben dafür gesorgt, dass der Goldpreis weiter auf einem Rekordhoch bleibt – ein entscheidender Faktor für die sprunghafte Zunahme illegaler Minen in Ghana. Gemeinsam mit Südafrika ist das Land eines der größten Goldproduzenten Afrikas. Doch ein erheblicher Teil des Goldes verlässt den Küstenstaat über irreguläre Kanäle. Laut einem 2024 veröffentlichten Bericht der Schweizer Organisation Swissaid wurden allein 2022 mehr als 435 Tonnen Gold im Wert von über 30 Mrd. US-Dollar aus Afrika geschmuggelt. Die wichtigsten Zielländer: die Vereinigten Arabischen Emirate, die Türkei und die Schweiz.
Wie gravierend die Auswirkungen der unregulierten Suche nach dem wertvollen Metall sind, machte vielen Ghanaerinnen und Ghanaern die Ankündigung der Ghana Water Company Limited klar. Der Engpass bei der Trinkwasserversorgung holte die Bevölkerung auf die Straßen, auch Künstler griffen das Thema auf. Der ghanaische Künstler Israel Derrick Apeti nutzte das braune, chemisch verunreinigte Wasser des Pra-Flusses sogar, um damit ein Gemälde zu malen. Ein Sinnbild für die enormen Umweltschäden und ein Protest, der in den Sozialen Medien viral ging. Für kurze Zeit standen vor den Präsidentschafts- und Parlamentswahlen im Dezember 2024 neben Wirtschafts- auch Umweltfragen im Fokus – zwei Themen, die eng miteinander verwoben sind.
Doch es war vor allem die schwache wirtschaftliche Bilanz von Präsident Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, die letztlich den Ausgang der Wahl bestimmte. Während der ehemalige Vizepräsident Mahamudu Bawumia von der Regierungspartei New Patriotic Party (NPP) mit 41 Prozent abgestraft wurde, entschied Oppositionspolitiker John Dramani Mahama vom National Democratic Congress (NDC) das Rennen mit 57 Prozent klar für sich. Nach acht Jahren an der Macht stand die NPP für viele Wählerinnen und Wähler vor allem für wirtschaftliche Misere, Korruptionsskandale und ein politisches Establishment, das die Lebensrealität der Bevölkerung aus den Augen verloren hatte. „Hauptsache keine NPP“, war in vielen Regionen des Landes zu hören.
Der neue Präsident ist indes kein Unbekannter. John Dramani Mahama führte das Land bereits von 2012 bis 2017, bevor er nach nur einer Amtszeit von Akufo-Addo abgelöst wurde. Auch seine Regierungszeit war geprägt von wirtschaftlichen Schwierigkeiten und Korruptionsskandalen. Dass er nun mit deutlicher Mehrheit wiedergewählt wurde, zeigt vor allem eines: Die Unzufriedenheit mit der NPP wog schwerer als die Bedenken gegenüber Mahamas Vergangenheit.
Kaum Regulierung, hohe Gewinne
Die eskalierende Wasserkrise kann der neue Präsident indes nicht ignorieren: Als Reaktion rief Mahama im März daher die Blue Water Initiative ins Leben. Im Rahmen des Programms sollen 2000 sogenannte Water Guards rekrutiert werden, um die Gewässer vor illegalem Bergbau zu schützen. Rund 400 neue „Wasser-Wächter“ durchlaufen derzeit bereits eine Spezialausbildung der ghanaischen Marine. Kritiker befürchten jedoch, dass militärischer Druck gegen Galamsey scheitern wird, da die strukturellen Ursachen des Problems weiterhin bestehen bleiben. Immer wieder gibt es in Ghanas Goldsektor zudem Hinweise auf Korruption und politische Verstrickungen, sei es durch die Vergabe von Konzessionen oder den Verleih und Verkauf von Baumaschinen. Wer zu rigoros gegen die Goldschürfer vorgeht, riskiert außerdem den Verlust von Wählerstimmen, vor allem in den ländlichen Gebieten. Gerade die informelle Goldförderung sichert derzeit hunderttausende Arbeitsplätze. Regierungsmaßnahmen, die sich gegen Galamsey richten, sind in der Vergangenheit daher häufig abgemildert oder nicht konsequent durchgesetzt worden. Entsprechend skeptisch reagierte die ghanaische Öffentlichkeit auf die Ankündigung der neuen Regierung.
Für faire Löhne und Umweltschutz
Dass das Problem angegangen werden muss, steht jedoch fest. Denn die zurückgehende Kakaoproduktion und das Verschwinden ganzer Plantagen haben erhebliche Folgen auch für Ghanas Wirtschaft. Während bislang mehr als 60 Prozent des weltweiten Kakaos aus Westafrika stammten, verschiebt sich die Produktion der Bohnen immer mehr nach Südamerika.
Netzwerke wie Inkota kritisieren schon lange, dass die Schokoladenherstellung Teil eines globalen Systems ist, in dem wirtschaftliche Interessen oft stärker wiegen als Umwelt- und Sozialstandards. Entsprechend plädiert das Netzwerk für faire Löhne, transparente Lieferketten und mehr Mitsprache von ghanaischen Kakaobauern. Der 2020 von Ghana und der Elfenbeinküste eingeführte Kakaopreisaufschlag (Living Income Differential) wird dabei als Schritt in die richtige Richtung gesehen. Dieser soll sicherstellen, dass Bauern ein existenzsicherndes Einkommen ausgezahlt wird. Doch eine gemeinsame Untersuchung[4] des Cocobod und der Schweizer Plattform für nachhaltigen Kakao hat ergeben, dass in der Praxis immer noch 91 Prozent der befragten Haushalte von Kakaobauern weniger als das Existenzminimum verdienen. Trotz eines Anstiegs der Preise und der Schaffung zahlreicher rechtlicher Rahmenbedingungen im Kakaosektor leben viele der Familien in Armut.
Anders dagegen verhält es sich beim Goldabbau, der in weiten Teilen noch von fehlenden Regulierungen profitiert. Maßnahmen wie die europäische Entwaldungsverordnung (EUDR) sollen zwar sicherstellen, dass Produkte, die auf den EU-Markt gelangen, nicht zur Entwaldung und Waldschädigung beitragen, doch greifen die strengen Regeln bislang nur für Kakao, Holz, Gummi und weitere Rohstoffe. Gold ist von der Verordnung bislang ausgenommen. Ein Umstand, den Umweltorganisationen immer wieder kritisieren. Einer der Gründe dafür ist die starke Lobby, die sich gegen eine Regulierung des Handels mit dem Edelmetall stellt. Vor allem Länder mit großen Edelmetall-Raffinerien wie die Schweiz oder die Vereinigten Arabischen Emirate profitieren von der aktuellen Rechtslage, die es ermöglicht, Gold aus intransparenten Quellen in den globalen Handel zu bringen.
Angesichts der massiven Entwaldung, die dem Goldabbau vorausgeht, wäre eine Aufnahme von Gold in die EUDR jedoch von großer Bedeutung. Auch das Lieferkettengesetz der Europäischen Union wird als Schritt in die richtige Richtung gesehen, doch die Maßnahmen konzentrieren sich vor allem auf den Schutz vor Kinderarbeit und Umweltzerstörung im Agrarsektor. Auch hier ist der Goldabbau weitgehend ausgenommen.
Neben der stärkeren Regulierung der Goldproduktion sind auch im Kakaosektor dringend Reformen nötig, um den Anbau attraktiver zu machen. Denn solange sich mit dem Abbau von Gold mehr verdienen lässt als mit dem Anbau von Kakao, wird der Druck auf Ghanas Umwelt und Menschen weiter steigen – mit Folgen, die bereits jetzt weit über Westafrika hinausreichen.
[1] Statistisches Bundesamt, Verbraucherpreisindex April 2025, destatis.de.
[2] Der Begriff leitet sich von der englischen Redewendung „gather them and sell“ ab.
[3] GWCL attributes water supply challenges to galamsey activities, gbcghanaonline.com, 31.8.2024.
[4] Gemeinsame Studie mit dem Ghana Cocoa Board (COCOBOD) über die Einkommen von Kakaobauernfamilien, kakaoplattform.ch.