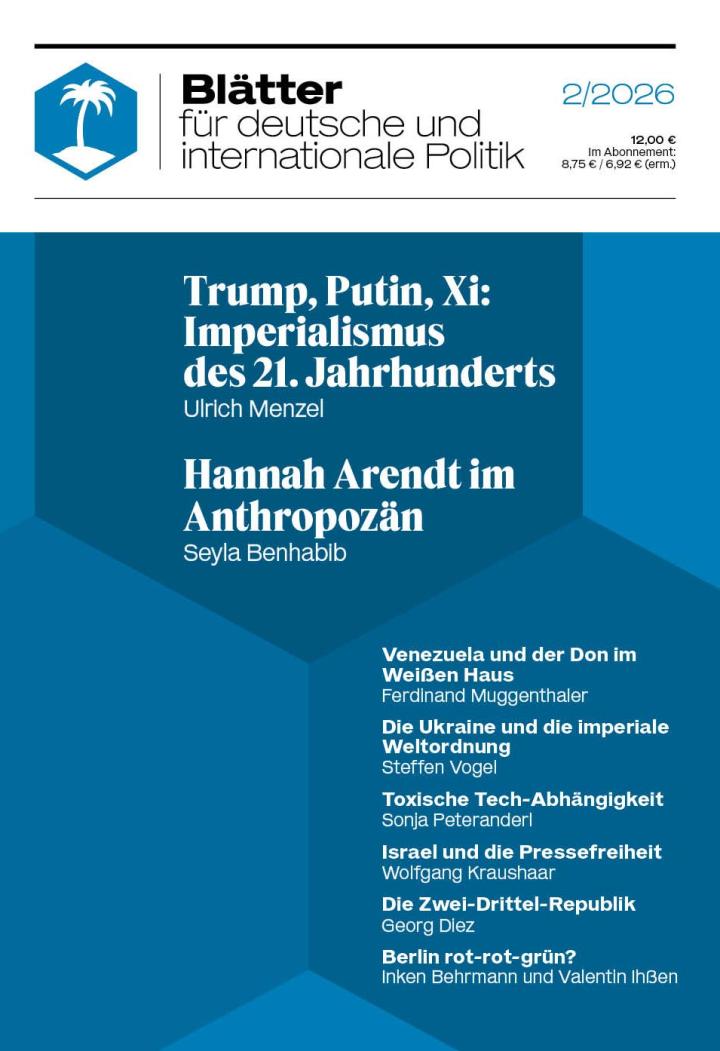Plädoyer für eine Massenbewegung gegen Trump

Bild: Bei »No Kings«-Protesten in New York am 18.10.2025 (IMAGO / ZUMA Press Wire)
Scheinbar unaufhaltsam treibt Donald Trump den autoritären Umbau der USA voran. Die demokratischen Kräfte haben bisher keine wirksame Gegenstrategie gefunden. Um die amerikanische Demokratie zu retten, fehlt eine Massenbewegung mit einer überzeugenden Zukunftsvision. Eine solche Bewegung sollte sich ein Vorbild nehmen an der Zusammenarbeit von Progressiven und Populisten in den 1880er Jahren.
Andere Völker haben sich erhoben. Sie haben sich erhoben, um ihre Rechte, ihre Würde und ihre Demokratie zu verteidigen. In den vergangenen 50 Jahren ist dies in Polen, Südafrika, Libanon, Südkorea, der Ukraine, Osttimor, Serbien, Madagaskar, Nepal und anderswo geschehen. Als in den frühen 1970er Jahren der demokratisch gewählte Präsident der Philippinen, Ferdinand Marcos, versuchte, alle Macht auf sich zu vereinen, gingen die Studenten des Landes auf die Barrikaden. Bei einem Zusammenstoß mit der Polizei verloren sechs ihr Leben. In der Folge traten die Transportarbeiter in den Streik und es kam zu gemeinsamen Demonstrationen von Studenten und Arbeitern. Marcos reagierte mit der Verhängung des Kriegsrechts. Daraufhin gingen auch die Katholiken des Landes, angeführt vom Erzbischof von Manila, Kardinal Jaime Sin, in den Widerstand. 1983 wurde Benigno Aquino, Marcos‘ wichtigster Gegenspieler, ermordet. Marcos verbot die Fernsehübertragung von Aquinos Beerdigung. Dennoch erschienen zwei Millionen Menschen zur Trauerfeier, die sich zu einer elfstündigen Kundgebung gegen das Regime entwickelte. Die Mittelschicht schloss sich der Protestbewegung an, die Geschäftswelt Manilas veranstaltete wöchentliche Protestaktionen. Im Jahr darauf folgte ein Generalstreik. Nachdem Marcos sich durch Betrug den Sieg bei der nächsten Wahl gesichert Hhatte, meuterten Teile der Streitkräfte – und Millionen Bürger standen ihnen bei. Die US-Regierung unter Ronald Reagan drohte, Hilfsgelder zu streichen. Anfang 1986 erschien die Lage für Marcos und seine Familie ausweglos, sie floh. Es dauerte über ein Jahrzehnt, aber das Volk hatte den Autokraten besiegt.
Solche Volksaufstände sind keine Seltenheit. Für ihr 2011 erschienenes Buch »Why Civil Resistance Works« (deutsch: »Die strategische Logik des gewaltfreien Konflikts«) untersuchten die Politikwissenschaftlerinnen Erica Chenoweth und Maria Stephan 323 Widerstandsbewegungen in den Jahren von 1900 bis 2006, darunter mehr als 100 gewaltfreie Bewegungen. Sie zeigen, dass Staatsbürger keineswegs machtlos sind, sondern über verschiedene Mittel verfügen, um die Demokratie zu verteidigen.
Der schleichende Übergang zur Diktatur
Für die Vereinigten Staaten lautet die entscheidende Frage des Jahrzehnts: Wieso hat sich hierzulande bisher keine Widerstandsbewegung gebildet? Die zweite Trump-Regierung hat laut »Washington Post« jedes dritte gegen sie ergangene Gerichtsurteil missachtet. Sie handelt wie eine Erpresserbande und missbraucht bundesstaatliche Befugnisse, um über interne Angelegenheiten von Universitäten, Anwaltskanzleien und Unternehmen zu entscheiden. Sie hat das Justizministerium grundlegend politisiert, es führt inzwischen eine ganze Reihe von Verfahren gegen politische Gegner. Die Einwanderungsbehörde ICE hat sie in eine riesige paramilitärische Organisation mit offenbar unbeschränkten Vollmachten verwandelt. Der Verfassung begegnet die Regierung mit Verachtung, sie greift demokratische Normen an und schränkt Freiheiten ein. Gleichzeitig schickt sie Soldaten und Militärfahrzeuge auf die Straßen der Hauptstadt und in andere Großstädte. Sie bedient sich faschistischer Symbolik und stellt ihre autokratischen Ambitionen offen zu Schau.
Ich gehöre nicht zu denjenigen, die glauben, dass Donald Trump die USA bereits in eine Diktatur verwandelt hat. Doch der Übergang von der freiheitlichen Ordnung zum Autoritarismus muss nicht in einem einzelnen dramatischen Ereignis geschehen, er kann auch die Form einer langsamen Aushöhlung der Institutionen annehmen – und diese Aushöhlung ist bereits in vollem Gange. 250 Jahre lang lautete das Grundprinzip der amerikanischen Demokratie, inspiriert von verschiedenen Denkern bis zurück zu Cicero und Cato: Niemand steht über dem Gesetz, und oberste Pflicht jeder Person, die ein öffentliches Amt bekleidet, ist es, das Gesetz über die eigenen egoistischen Impulse zu stellen. Dieses Konzept ist Trump jedoch fremd.
Trumps Maßnahmen in den verschiedenen Politikfeldern mögen zusammenhangslos wirken, sie sind aber Teil eines einzigen Vorhabens: Einen erbarmungslosen Kampf aller gegen alle zu entfachen und dann die Präsidentschaft zu nutzen, um sich zu bereichern und die eigene Macht zu vergrößern. Der Trumpismus lässt sich auch als einen mehrgleisigen Versuch betrachten, die edleren Eigenschaften des menschlichen Geistes wie Wissbegier, Mitgefühl und Gerechtigkeitssinn durch niedere Instinkte wie Habsucht, Vergeltung und Egoismus zu verdrängen; als Versuch, die Welt in einen Spielplatz für die Reichen und Skrupellosen zu verwandeln. Daher arbeitet er daran, die moralischen und rechtlichen Fesseln zu lösen, die ein ziviles Miteinander erst ermöglichen.
Wenn Sie glauben, dass der Trumpismus in drei Jahren einfach vorbei sein wird, sind Sie naiv. Wenn ihm niemand Widerstand leistet, könnte ein globaler Populismus nach Art des Trumpismus eine ganze Generation lang dominieren. Diese Dominanz könnte für den Rest unseres Lebens und womöglich auch des Lebens unserer Kinder andauern. Warum tun wir also so wenig dagegen? Wollen wir wirklich tatenlos zusehen, wie unsere Demokratie zerbricht? Spätestens im Frühling dieses Jahres nahmen Trumps Handlungen so ungeheuerliche Formen an, dass ich meinte, die Zeit eines breiten zivilgesellschaftlichen Aufstandes sei gekommen. Am 17. April schrieb ich in einem Kommentar für die »New York Times«, Menschen aus allen Sektoren der amerikanischen Gesellschaft müssten sich in einer breiten Widerstandskoalition zusammenfinden.
Die Trump-Regierung handelt wie eine Erpresserbande.
Dieser Text erfuhr viel Aufmerksamkeit und Zuspruch. Für einen Moment dachte ich, der von mir erhoffte zivile Aufstand stünde kurz bevor. Wo ist er geblieben? Ja, es gab die (sehr guten) »No Kings«-Proteste. Und ja, Gruppen wie Indivisible mobilisieren weiterhin das traditionelle progressive Lager. Doch im Großen und Ganzen scheint sich ein Schleier der Passivität über die Anti-Trump-Lager gelegt zu haben. Eine Institution nach der anderen schließt Deals mit der Erpressungsmaschinerie der Trump-Regierung. Hinter verschlossenen Türen beklagen sich Firmenchefs und Unternehmensmanager über den Schaden, den Trump anrichtet – doch in der Öffentlichkeit halten sie sich zurück. Die Führungen von Universitäten im ganzen Land zeigten sich zunächst ermutigt von Harvards Entscheidung, sich zu wehren. Doch inzwischen haben sich viele Hochschulen (möglicherweise einschließlich Harvard) entschieden, das praktisch obligatorische Bestechungsgeld an die Trump-Regierung zu zahlen.
Wie Unterwerfung zur Gewohnheit wird
Wir alle können den wichtigsten Grund verstehen, warum viele Menschen und Institutionen schweigen: Einschüchterung. Führungskräfte sagen sich, »wenn ich die Stimme erhebe, wird das meine Organisation Millionen kosten«, und es erscheint ihnen klug, gegenüber der Regierung einzulenken.
So entwickelt sich keine Massenbewegung, sondern wir müssen zusehen, wie jede Institution für sich ihre jeweilige Selbsterhaltungsstrategie verfolgt. In Abwesenheit einer breiten sozialen Bewegung, die sie unterstützen und schützen könnte, sehen sich alle Führungskräfte dem gleichen Kollektivdilemma gegenüber: Stehe ich allein da, werde ich zermalmt.
Das Problem an diesem Verhalten ist, dass Bullying so zur Gewohnheit wird. Bullies, die keine Gegenwehr erfahren, verlangen weiter Unterwerfung. Und so wird auch die Unterwerfung zur Gewohnheit. Um festzustellen, ob wir in einer Autokratie leben, können wir uns die folgende Frage stellen: Fühlen sich die Menschen frei, ihre abweichende Meinung zu äußern?
Überall erlebe ich Führungspersönlichkeiten, die nicht sagen, was sie tatsächlich denken. Und mit der Zeit kann diese Selbstzensur zu einem inneren geistigen und moralischen Zusammenbruch führen. Als Trump vor einem Jahrzehnt das Establishment der Republikanischen Partei besiegte, fügten sich die Besiegten nur widerwillig und behielten die Fähigkeit, ihn insgeheim zu verachten. Aber im Laufe der Jahre scheint die Zustimmung in ihr Inneres eingesickert zu sein – und schon bald waren sie auch innerlich erobert. Sie sind zu genau den Menschen geworden, die sie vor nicht allzu langer Zeit noch zu verachten vorgaben. Ein weiterer Grund für diese stille Unterwerfung besteht darin, dass diese Leute nicht verstehen, in welchem Kampf wir uns befinden. Sie stecken in alten politischen Denkweisen fest.
Doch in dieser Krise geht es nicht um einzelne Wahlzyklen. Es geht um historische Zyklen. Von Zeit zu Zeit erfasst eine politisch-kulturell-soziale Strömung die Welt und hinterlässt sie völlig neu geordnet. Vor 250 Jahren schwappte eine Welle demokratischer Gesinnung über die westliche Welt, entfachte die amerikanische und französische Revolution und schließlich die demokratischen Aufstände von 1848. Die totalitäre Welle der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts führte zu den Revolutionen und Machtergreifungen in Russland, Deutschland und China. Die 1960er Jahre schenkten uns eine Welle der Befreiung, die zu dekolonialen Bewegungen, der Bürgerrechtsbewegung und der feministischen Bewegung führte. Die neoliberale Revolution der 1980er und 1990er Jahre brachte Ronald Reagan und Margaret Thatcher im Westen und Deng Xiaoping und Michail Gorbatschow im Osten hervor.
Die Welle des globalen Populismus
Seit etwa 2019 schwillt die Welle des globalen Populismus an. Sie hat uns nicht nur Trump, sondern auch Viktor Orbán, Narendra Modi, Xi Jinping, einen revanchistischen Wladimir Putin und den Brexit beschert. Die traditionellen Parteien und Politiker, deren Zeithorizont nicht über den nächsten Wahlzyklus hinauszugehen scheint, drohen in dieser historischen Flut hilflos unterzugehen. Politiker der alten Schule haben weder die Macht noch die Vision, um diese historischen Weichenstellungen umzukehren. Ein Chuck Schumer[1] wird uns nicht retten.
Der Trumpismus ist wie jeder Populismus mehr als nur eine Aneinanderreihung politischer Maßnahmen – er ist eine Kultur. Trump bietet den Menschen ein Gefühl der Zugehörigkeit, eine Identität, Status, Selbstachtung und eine umfassende politische Werteorientierung. Populisten geht es nicht darum, dieses oder jenes Gesetz zu verabschieden, sie wollen den Zeitgeist verändern. Glaubt die Demokratische Partei wirklich, sie könnte dem begegnen, indem sie ein paar Steuergutschriften anbietet?
Um eine soziale Bewegung zu besiegen, muss man eine Gegenbewegung aufbauen. Und dafür braucht man eine andere Erzählung darüber, wo wir stehen und wohin wir gehen sollten, andere Werte, die bestimmen, was bewundernswert und was schändlich ist. Wenn es uns nicht gelingt, eine solche Bewegung auf die Beine zu stellen, werden autoritäre Machthaber unseren Globus auf unbestimmte Zeit dominieren. Werden sich genügend US-Amerikaner erheben, um den populistischen Autoritarismus zurückzuschlagen? Die Filipinos haben es gegen Marcos geschafft. Eines Morgens wachten die Autokraten auf und hatten nicht mehr die Kontrolle, die Demonstranten hatten sie übernommen. Das muss nun in den USA passieren.
Denken wir an soziale Bewegungen, kommen uns Kundgebungen, Demonstrationen und Proteste in den Sinn. Doch diese sind erst der letzte Schritt im Aufbau einer Bewegung. Kundgebungen und Demonstrationen sind sinnlos, wenn sie nicht einem übergreifenden Ideal dienen. Die historischen Gezeiten verschieben sich, wenn sich gesellschaftliche Werte verschieben. Eine Gruppe von Vordenkern entwickelt eine neue soziale Vision, und schließlich bildet sich um diese Vision herum eine soziale und politische Bewegung. John Locke und andere Köpfe der Aufklärung entwickelten die Ideen, welche die Unabhängigkeitserklärung inspirierten und somit auch die Revolution möglich machten. Im Jahr 1848 schufen Karl Marx und Friedrich Engels die intellektuelle Grundlage für die kommunistischen Revolutionen des frühen 20. Jahrhunderts. Friedrich Hayek, Milton Friedman, William F. Buckley Jr. und andere entwarfen die Vision für das, was später als die Reagan-Revolution bekannt wurde.
Was sich zum heutigen trumpistischen Populismus entwickelte, griff auf ältere Bewegungen zurück – darunter die einwanderungsfeindliche Know-Nothing Party des 19. Jahrhunderts und die isolationistischen America Firsters des 20. Jahrhunderts. Seine Ideen verdichten sich über die letzten acht Jahrzehnte hinweg in den Schriften von Autoren wie Albert Jay Nock, James Burnham, Sam Francis, Pat Buchanan und Christopher Lasch. Laschs 1995 erschienenes Buch »The Revolt of the Elites and the Betrayal of Democracy« (deutsch: »Die blinde Elite. Macht ohne Verantwortung«) ist für MAGA das, was Marx für Lenin war. Fast alles, was Trump und JD Vance heute sagen, wurde vor 30 Jahren zuerst von Lasch gesagt: Das Establishment habe das Volk verraten und eine Kultur geschaffen, in der sich die Arbeiter im eigenen Land wie Fremde fühlen.
Die Schwächen von MAGA nutzen
Vor etwa einem Jahrzehnt ging ich am Schreibtisch eines jungen Mannes namens James Hitchcock vorbei, der damals mein brillanter und insgesamt wunderbarer Redaktionsassistent bei der »New York Times« war. Vor ihm lag ein Exemplar von Laschs Buch. Wie merkwürdig, dachte ich mir, dass James ein 20 Jahre altes Werk der Gesellschaftskritik liest. Das Warnsignal, das darin lag, erkannte ich nicht. Heute ist James Redenschreiber für JD Vance. Der Vizepräsident verleiht Lasch heute, 30 Jahre später, eine Stimme, sodass dessen Kritik bei Millionen unserer Mitbürger Anklang findet, die von dem verstorbenen Historiker nie gehört haben.
Mit seinem genialen Gespür dafür, was Gemüter erhitzt und die Gesellschaft spaltet, hat Trump Laschs Kritik noch verschärft, indem er behauptet, die Demokratie sei von einer festgefügten herrschenden Bildungselite vollständig gekapert worden. Tagtäglich versucht er, den Leuten aufs Neue zu beweisen, er kämpfe in ihrem Namen einen existenziellen Klassenkampf gegen die Eliten: Trump gegen Harvard, Trump gegen die Washingtoner Bürokraten, Trump gegen die Anwaltskanzleien, Trump gegen die Mainstreammedien. Dieses Narrativ konnte Millionen von Amerikanern überzeugen. Seit Trump sich 2015 erstmals zum Präsidentschaftskandidaten ausrief, haben sich die politischen Mehrheiten in etwa 1400 Bezirken zugunsten der Republikaner verschoben, aber in nur weniger als 60 zugunsten der Demokraten. Trump nutzte diese Erzählung, um eine multiethnische Koalition der Arbeiterklasse aufzubauen; ein Fünftel aller Trumpwähler in 2024 waren People of Color.
Wie können diejenigen, die sich gegen den Trumpismus stellen, eine sowohl präzise als auch glaubwürdige Gegenerzählung entwerfen? Die erste Aufgabe besteht darin, die Schwächen im Kern der MAGA-Erzählung zu nutzen. Seit 250 Jahren besteht die amerikanische Idee zumindest teilweise darin, dass wir uns von den durch Klassenspaltungen geprägten europäischen Staaten unterscheiden. Demnach hätten unsere Vorfahren dieses Erbe hinter sich gelassen, um ein Land zu schaffen, in dem alle Menschen eine faire Chance haben. Wir lehnten die Politik des Klassenkonflikts ab und schufen ein Land rund um das Ideal der sozialen Mobilität – der Idee, dass das arme Kind von heute morgen ein reicher Manager sein kann.
»Es war ein geistiger Wind, der die Amerikaner von Anfang an unwiderstehlich vorantrieb«, bemerkte der italienische Schriftsteller Luigi Barzini Jr., und Abraham Lincoln erklärte: »Ich bin der Ansicht, dass der Wert des Lebens darin besteht, die eigenen Lebensumstände zu verbessern.« Dieses Evangelium der sozialen Mobilität gibt den Amerikanern ein Gefühl von Sinn und Richtung. Soziale Mobilität verringert auch die Klassenkonflikte, denn wo man heute steht, muss nicht unbedingt auch der Ort sein, an dem man morgen stehen wird.
Die traditionelle amerikanische Erzählung gründet auf Hoffnung und Möglichkeiten. Die MAGA-Erzählung basiert auf Drohung und Angst. Die traditionelle amerikanische Geschichte begrüßt Risiken. Die MAGA-Geschichte klammert sich an Sicherheit. Für die meisten Amerikaner lag die Utopie stets in der Zukunft – für die trumpistischen Populisten liegt sie in der Vergangenheit. Die traditionelle amerikanische Denkweise beruhte auf der Vorstellung grenzenlosen Wachstums, das allen zugutekommen kann; für das populistische Denken ist hingegen alles ein Nullsummenspiel.
Die von Trump erzählte Geschichte ist nahezu unamerikanisch und gleicht eher jener russischer Nationalisten: »Die anständigen Leute des ländlichen Kernlands, des ›Heartland‹[2], werden bedroht von Ausländern und urbanen Modernisierern. Ich werde sie beschützen.« Waren die ikonischen Bilder Amerikas einst der Planwagen oder das Auto, dann ist das repräsentative Bild für die MAGA-Bewegung eine Mauer.
Für eine Allianz von Populisten und Progressiven
Die Amerikaner werden MAGA früher oder später zurückweisen. Nicht nur, weil es einem Fremdkörper im Gemeinwesen gleicht, sondern auch, weil mit der Zeit immer ersichtlicher werden wird, dass Trump die wirklichen Probleme seiner Anhänger aus der Arbeiterklasse nicht angeht: schlechte Gesundheitsversorgung, minderwertige Bildung, geringes Sozialkapital, geringe Investitionen in ihre Wohngegenden und schwaches Wirtschaftswachstum.
Die Trumpisten konzentrieren sich auf ihren Bürgerkrieg gegen die Eliten: Harvard schädigen, USAID zerstören, das National Institute of Health schwächen. Dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk den Geldhahn abzudrehen, um den Liberalen eins auszuwischen, mag emotional befriedigend sein, aber wie verbessert sich dadurch die Lage der Arbeiterklasse? Trumps größte gesetzgeberische Tat ist eine Steuersenkung für die Reichen. Was hilft das der Arbeiterklasse?
Die zweite Aufgabe besteht darin, eine Vision für Amerika zu entwerfen, die inspirierender ist als diejenige von MAGA. Vor etwa 125 Jahren, als die Unabhängigkeitserklärung halb so alt war wie heute, kämpfte Amerika mit den Verwerfungen der industriellen Revolution. Die 1880er Jahre waren geprägt von der schwerwiegenden Depression von 1882 bis 1885, massiver politischer Korruption, einer atemberaubenden Konzentration wirtschaftlicher Macht, enormer Ungleichheit sowie Lynchmorden und anderer rassistischer Gewalt. Als Antwort aus der Zivilgesellschaft entstand die populistisch-progressive Bewegung.
Heute stehen Populisten und Progressive in der Regel auf entgegengesetzten Seiten des politischen Spektrums. Doch wie Richard Hofstadter in seinem Klassiker »The Age of Reform« festhielt, bildeten Populisten und Progressive an der Wende zum 20. Jahrhundert ein Bündnis. Die Progressiven fanden sich damals – wie heute – vor allem in den hochgebildeten Schichten der Großstädte. Die Populisten waren – wie heute – in den kleineren Städten des Mittleren Westens und des Südens konzentriert. Aber sowohl die Progressiven als auch die Populisten wollten jenen helfen, die unter der Industrialisierung zu leiden hatten. Beide betonten den Wert von Moral, persönliche Verantwortung und Charakterbildung. Beide glaubten daran, die Regierung als Instrument nutzen zu können, um Ungleichheit zu verringern und Chancen zu vergrößern. Populisten und Progressive arbeiteten hart daran, das Aufbegehren auf dem Land und in den Städten in Einklang zu bringen. Gemeinsam schufen sie Großes – die Antitrust-Bewegung, die Lebensmittelaufsicht (FDA), die nationale Forstverwaltung, die Zentralbank.
Populisten und Progressive brauchten einander – und sie brauchen sich auch heute noch. Ohne die Populisten drohen sich die Progressiven in eine Gruppe wohlhabender, realitätsferner Stadtbewohner zu verwandeln, die wenig mit den Durchschnittsamerikanern gemein hat. Ohne die Progressiven drohen die Populisten als antiintellektuelle, paranoide Fanatiker zu enden. Arbeiten sie zusammen, dann wird die progressive Wertschätzung der Vielfalt mit der Betonung des kulturellen Zusammenhalts durch die Populisten ausbalanciert.
Vom Industrie- zum Informationszeitalter
Die Amerikaner der populistisch-progressiven Ära hatten Mühe, mit den Auswirkungen des Industriezeitalters zurechtzukommen. Heute ringen wir mit den Umbrüchen des Informationszeitalters. Damals wie heute versuchen wir, die traditionellen amerikanischen Ideale an neue Bedingungen anzupassen. Die Einsichten, die Populisten und Progressive damals antrieben, können auch heute als wertvolle Orientierung dienen. Die populistisch-progressive Bewegung machte die soziale Mobilität – den amerikanischen Traum – zum Kern ihrer Vision und startete einen Kreuzzug gegen die Konzentration wirtschaftlicher Macht, die ökonomische und soziale Mobilität zunichte machte. Die Progressiven und Populisten jener Zeit ahnten bereits, was die psychologische Forschung erst Jahrzehnte später bestätigen sollte: Wenn Menschen sich entfalten und produktive Risiken eingehen sollen, brauchen sie einen sicheren Ausgangspunkt. Populisten verstehen sich darauf, darüber nachzudenken, wie man einen sicheren Rahmen schafft – eine stabile Familie, sichere Nachbarschaften, starke nationale Grenzen und geteilte moralische Werte. Progressive sind gut darin, den Staat zu nutzen, um Handlungsspielräume zu erweitern – indem sie Bildungszugänge ausbauen, mittels Industriepolitik in benachteiligte Gebiete investieren und Wohnraum schaffen, damit Menschen von einem Ort zum anderen ziehen können. Sowohl Populisten als auch Progressive wollen jene Institutionen reformieren, die das Vertrauen der US-Bürger verloren haben – Universitäten, den Kongress, Unternehmen, die Meritokratie, die Technokratie des Silicon Valley.
Das alte populistisch-progressive Bündnis war ökonomisch links, kulturell gemäßigt rechts und entschlossen, Reformen durchzuführen. Eine aktuelle Version dieser Allianz würde wahrscheinlich genauso aussehen. Dies hätte den Vorteil, die überholten Kategorien von links und rechts aus dem 20. Jahrhundert durcheinanderzuwirbeln, und könnte die Überzeugung stärken, dass wir eine Nation sind, die kulturell zusammenhängt, aber wirtschaftlich und demografisch vielfältig ist. Sie weist die trumpistische Vorstellung zurück, wir seien zu einem endlosen Klassen- oder Kulturkampf verdammt.
Das Meinungsklima drehen
Die dritte Aufgabe besteht selbstverständlich darin, die Bewegung um diese Vision herum tatsächlich aufzubauen. Soziale Bewegungen sind größer als politische Parteien und verfolgen größere Ziele, als nur Gesetze durch den Kongress zu bringen. Sie drängen gleichzeitig auf Veränderungen im zivilgesellschaftlichen, kulturellen, institutionellen und legislativen Bereich. Sie verändern den Zeitgeist. Erfolgreiche soziale Bewegungen finden Wege, zivilgesellschaftliche Macht aufzubauen. Autoritäre Kräfte versuchen, ihre Gegner zu spalten und zu isolieren, kollektives Handeln zu verhindern – weshalb bereits der bloße Akt der Bündnisbildung Macht verleiht. Einzelne mögen machtlos sein, doch Gruppen sind es nicht.
Erfolgreiche Bewegungen sind Mikrokosmen jener Gesellschaft, die sie zu erschaffen hoffen. Eine Anti-MAGA-Bewegung müsste eine klassenübergreifende Bewegung sein, die Mitglieder der gebildeten Schichten mit Angehörigen der Arbeiterklasse zusammenbringt und so jene sozialen Gräben überbrückt, die den Populismus überhaupt erst groß werden ließen. Erfolgreiche Bewegungen mobilisieren gleichgesinnte Menschen, aber konzentrieren sich darauf, jene zu überzeugen, die noch nicht auf ihrer Seite stehen.
Hin und wieder hört man demokratische Politiker versprechen, dass sie für ihre Seite »kämpfen« werden. Meistens bedeutet das lediglich, dass der Politiker wiederholt, was seine Basis bereits glaubt – nur mit lauterer Stimme. Das ist meist nutzlos. Große Anti-Trump-Kundgebungen, an denen ausschließlich das Publikum progressiver Medien aus liberalen Großstädten teilnimmt, lässt die Wähler auf dem Land kalt. Erfolgreiche Bewegungen erzeugen zivilgesellschaftliche Macht, indem sie soziale Spannungen steigern.
Durch Märsche, Busboykotte und Sit-ins erzeugte die Bürgerrechtsbewegung Spannungen, die Sand ins Getriebe der weißen Vorherrschaft streuten. Der einflussreiche Community Organizer Saul Alinsky betonte stets, dass die eigene Macht so groß sei, wie die Gegenseite glaubt, dass sie sei. In den 2010er Jahren erhöhte die Tea-Party-Bewegung, obwohl zahlenmäßig klein, den Druck auf das republikanische Establishment soweit, dass dieses glaubte, es sei politisch sehr kostspielig, sich den Anliegen der Tea Party zu widersetzen.
Erfolgreiche soziale Bewegungen sind Mikrokosmen jener Gesellschaft, die sie zu erschaffen hoffen.
Eine erfolgreiche Anti-MAGA-Bewegung muss damit beginnen, erreichbare, konkrete Erfolge zu erzielen – etwa indem sie diesen einen Angriff auf die Demokratie stoppt oder jene spezifische Trump-Maßname aufhält. Sie muss die Menschen aus der Angst und Lähmung holen und ihnen Hoffnung und neuen Schwung geben. Das Hauptziel einer sozialen Bewegung besteht darin, zu ändern, was die Menschen bewundernswert finden und was sie verabscheuen. Das lässt sich weniger durch Argumente als durch Geschichten erreichen. Gegenwärtig dominiert Trump die Sphäre der Narrative. Während seiner Zeit bei »The Apprentice« lernte er – wie die Journalistin Tina Brown anmerkt –, dass die Aufmerksamkeitsspanne des amerikanischen Publikums höchstens zwei Wochen beträgt. Um im Zentrum der Debatte zu stehen, müsse man daher eine Abfolge zweiwöchiger Minidramen inszenieren, die jeweils mit hochkarätigen Konflikten und Überraschungen gespickt sind.
Um dieser Strategie entgegenzuwirken, muss eine antipopulistische soziale Bewegung dem eine eigene Kaskade aus Minidramen entgegensetzen. Die Trump-Regierung liefert am laufenden Band Material für solche Dramen. So erfuhren wir im Juli etwa, dass die Regierung 500 Tonnen Nahrungsmittelhilfe verbrennen wollte, weil sie zu mitleidlos und inkompetent war, diese an hungernde Menschen zu verteilen. Eine wirksame soziale Bewegung würde diese Geschichte allen immer wieder vor Augen führen.
Erfolgreiche soziale Bewegungen schaffen Helden. Die Anführer der Bürgerrechtsbewegung erkannten, dass Rosa Parks das ideale Gesicht für den Busboykott in Montgomery darstellte. Sie war zierlich, fromm, sanft im Auftreten und in ihrer Community hoch angesehen. Doch soziale Bewegungen brauchen ebenso Antipoden. Für die amerikanischen Gründerväter war das König Georg III. Für die Bürgerrechtsbewegung waren es Gestalten wie Bull Connor, Orval Faubus und George Wallace. Die letzte von Alinskys 13 »Regeln für Radikale« lautet: Wähle ein Ziel, fixiere es, personalisiere es und polarisiere. Eine andere (die fünfte) lautet: Spott ist die effektivste Waffe.
Die wirksamste Kommunikationsform sozialer Bewegungen sind Taten. Sie schaffen Ereignisse, die Geschichten erzählen. Der Politikwissenschaftler Gene Sharp, der gewaltfreien Widerstand erforschte, erstellte eine Liste von 198 verschiedenen Aktionsformen, mit denen soziale Bewegungen das Bewusstsein schärfen können – darunter Boykotte, Walkouts, Streiks, Demonstrationen, Straßentheater, ziviler Ungehorsam und Massenpetitionen. In den Vereinigten Staaten haben sich bereits lokale Gruppen gebildet, die Migranten unterstützen, Abschiebungen dokumentieren und jedes dieser Ereignisse in ein gesellschaftliches Minidrama verwandeln.
Wird für Amerikaner jemals der Zeitpunkt kommen, an dem sie wie ihre Vorfahren in den 1770er Jahren gegen ein despotisches und ungerechtes Regime zu den Waffen greifen?
Die Kraft des gewaltfreien Protests
Das ist ein unrealistisches Szenario und nicht der Diskussion wert. Laut den Forschungen von Chenoweth und Stephan sind gewaltfreie Aufstände doppelt so erfolgversprechend wie gewaltsame. Friedliche Aufstände verschaffen sich moralische Autorität und entziehen diese dem Regime. Wenn Demonstrierende der Staatsmacht gewaltfrei gegenübertreten, wirken sie mutig, selbstdiszipliniert und würdevoll. Reagieren Regime auf gewaltfreie Proteste mit Wasserwerfern, Gummigeschossen oder Tränengas, wirken sie hingegen skrupellos und bösartig.
So bringen gewaltfreie Proteste autoritäre Regime in eine Zwickmühle: Entweder sie überlassen den Demonstranten die Straße oder sie greifen in einer Weise durch, die ihre eigene Legitimität untergräbt. Ist eine Bewegung nur darauf aus, die eigene Radikalität unter Beweis zu stellen, scheitert sie. Wenn sie mit ihren Aktionen versucht, die Erzählung zu ändern und die Mehrheit der Bevölkerung zu überzeugen, hat sie gute Erfolgsaussichten.
Vor 250 Jahren verliehen die Unterzeichner der Unabhängigkeitserklärung dem »American Spirit« einen politischen Ausdruck. Walt Whitman hat diesen Spirit womöglich am eindrücklichsten formuliert, indem er schrieb, die amerikanische Demokratie sei eine »Turnhalle des Lebens«, die »Athleten der Freiheit« hervorbringe. Was Whitman fürchtete, waren »Trägheit und Versteinerung«, dass Amerika stagnieren, sich nach außen abschotten oder innere Mauern errichten könnte, die das Volk spalten würden. Er bewunderte Tatendrang. »Mit Freude begrüße ich die ozeanische, vielgestaltige, intensive praktische Energie, das Verlangen nach Fakten, ja selbst das materielle Streben der Gegenwart«, schrieb er in »Democratic Vistas«.
Wir haben uns weit von Whitmans Hymnen auf Tatkraft und Hoffnung entfernt. Aber der Spirit dieses Landes, auch wenn er vielleicht schlummert, lebt noch immer. Der Trumpismus ist derzeit auf dem Vormarsch, aber die Geschichte zeigt, dass Amerika Zyklen aus Disruption und Wiederaufbau, Leiden und Neuerfindung durchläuft. Dieser Prozess folgt einem vertrauten Muster: Zuerst kommt eine kulturelle und intellektuelle Veränderung – eine neue Vision. Danach entstehen soziale Bewegungen. Am Schluss vollzieht sich ein politischer Wandel.
(c) 2025 The Atlantic Monthly Group, Inc. All rights reserved. Distributed by Tribune Content Agency. This article originally appeared on theatlantic.com and has been translated from English and reprinted with permission from The Atlantic. The Atlantic has not endorsed or sponsored this translated version of the article. Please find the original text here.