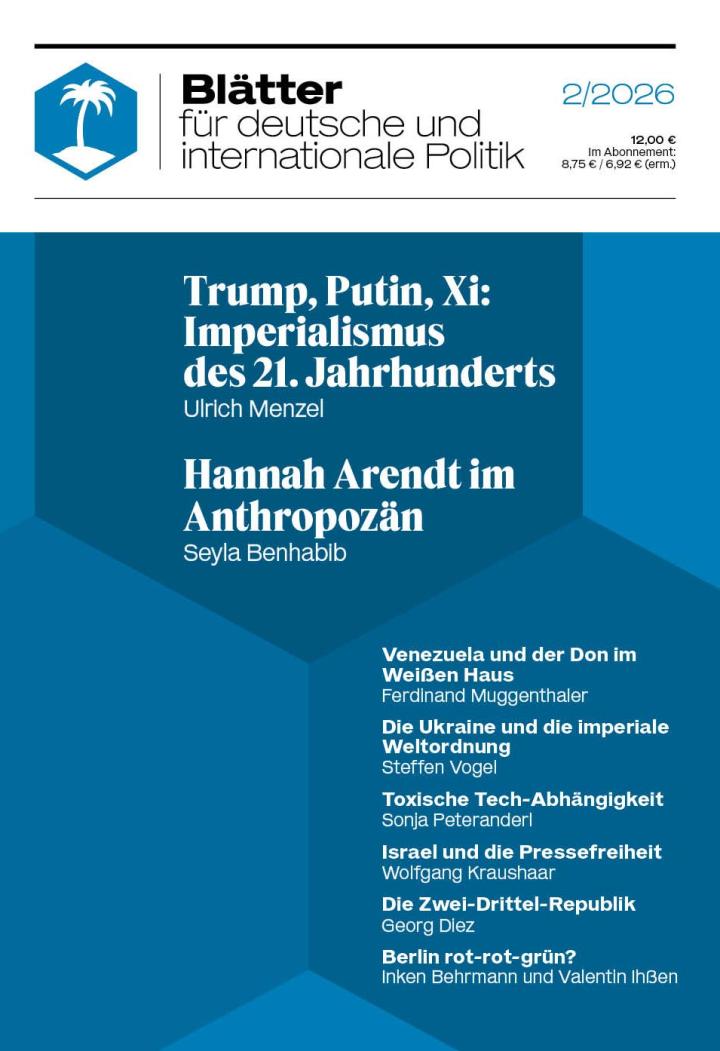Feministische Ambivalenzen der Gegenwart – und eine Replik auf Bascha Mika
Deutschland die Frauenquote braucht“, titelte jüngst „Der Spiegel“.[1] Die Quote, dieser vermeintlich „alte Hut“? Es bewegt sich also doch etwas im Lande, hoffte die feministische Leserin.
Ausgangspunkt der Debatte war – wieder einmal – ein Streit zwischen Bundesarbeits- und Sozialministerin Ursula von der Leyen und Kristina Schröder, Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Von der Leyen hatte angekündigt, eine gesetzliche Regelung über einen Mindestanteil von Frauen in Führungspositionen von Unternehmen nicht mehr ausschließen zu wollen – „angesichts der nur mit der Lupe erkennbaren Fortschritte der vergangenen zehn Jahre“, wie sie erklärte.[2] Mit der Quote wollte sie binnen Fünfjahresfrist auf mindestens 25 bis 30 Prozent Frauenanteil in Führungspositionen kommen. Dagegen hält die eigentlich qua Ressort für Gleichberechtigung zuständige Schröder eine „gesetzliche Pflicht zur Selbstverpflichtung“ in dieser Frage immer noch für ausreichend.
Dabei überraschte einmal mehr die Naivität, die die promovierte Politikwissenschaftlerin Schröder an den Tag legte. Einmal abgesehen von der Frage, wie die Ministerin „Unternehmen ab einer gewissen Größe gesetzlich verpflichten [will], individuell für sich eine selbst bestimmte Frauenquote festzulegen und zu veröffentlichen“[3] – eine solche Selbstverpflichtung, wenn auch noch nicht gesetzlich verankert, gibt es längst.