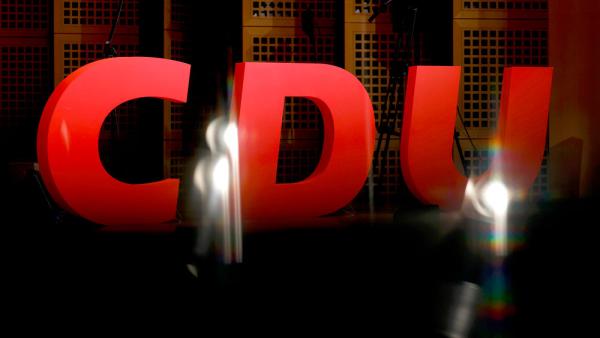Bild: Public Domain
Ich komme aus einer Zeit, zu der es selbstverständlich war, Probleme mit der Schönheit zu haben. Zumal in Verbindung mit Kunst stand sie unter dem Verdacht, Missstände zu verharmlosen oder zu vertuschen und damit letztlich repressiv zu sein. Zumindest aber galt es als bieder, Schönheit zu reklamieren. „Die nicht mehr schönen Künste“ war die – genau im Jahr 1968 – zum Buchtitel gewordene Formel für mehr als nur eine Generation.[1] In dem „nicht mehr“ lag keinerlei kulturpessimistisches Bedauern, sondern viel eher die Genugtuung und Überzeugung, es handle sich um einen Fortschritt, endlich jegliche Fixierung auf Schönheit überwunden zu haben.
Als ich während meines Studiums zusammen mit einer Gaststudentin aus New York über ein Jahr hinweg – 1989/90 – Martin Heideggers Aufsatz „Der Ursprung des Kunstwerkes“ las und dabei herausgefordert war, der Nicht-Deutschen semantische Zwischentöne der Diktion sowie ideengeschichtliche Zusammenhänge zu erklären, diskutierten wir auch lange über die einzige Passage des Textes, in der es – zu meinem damaligen Missfallen sehr emphatisch – um Schönheit geht. Diese sei, so Heidegger, „eine Weise, wie Wahrheit als Unverborgenheit west“.[2] In Gestalt eines Kunstwerks erzeugt Schönheit also eine Evidenz, der sich niemand entziehen kann.