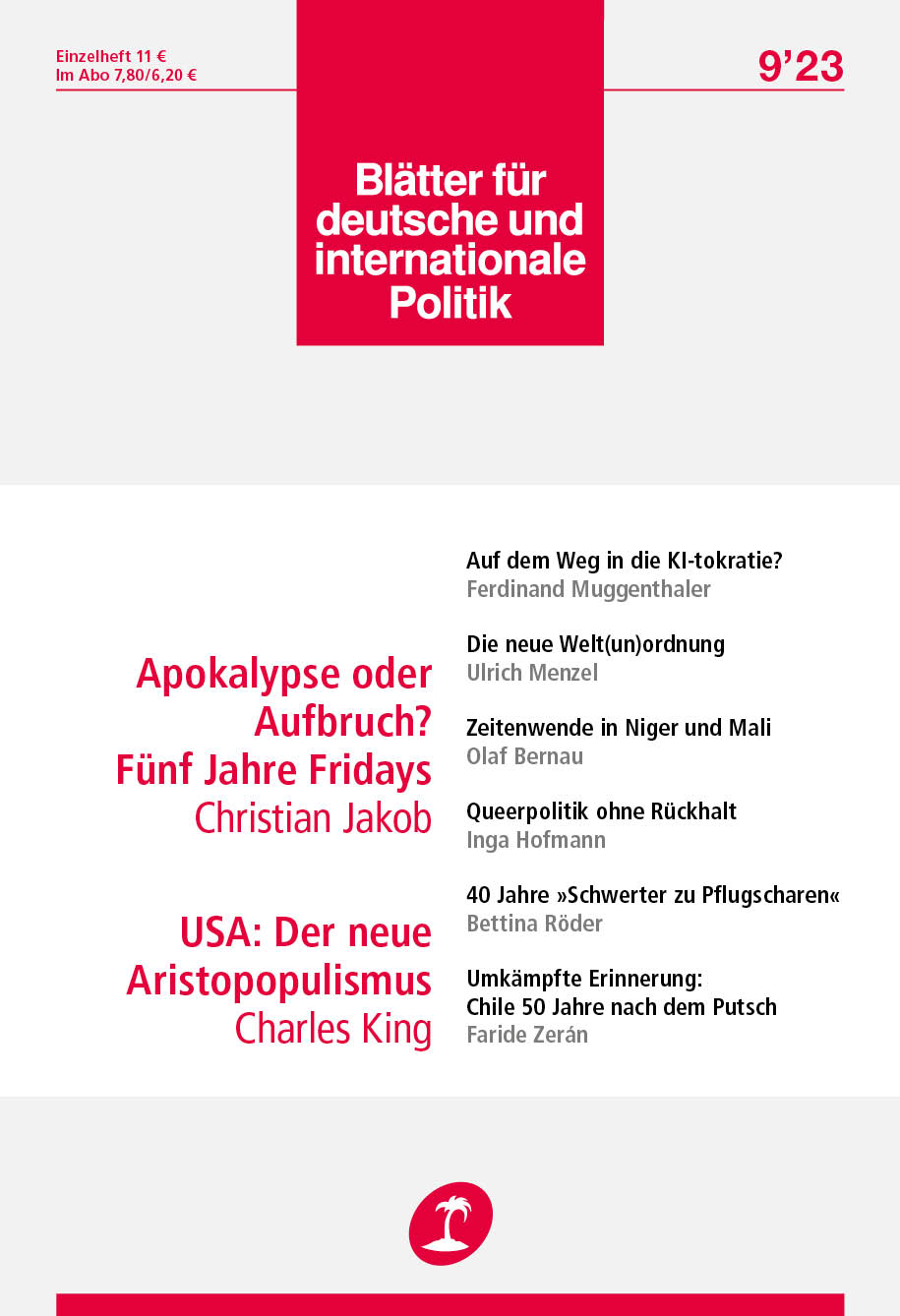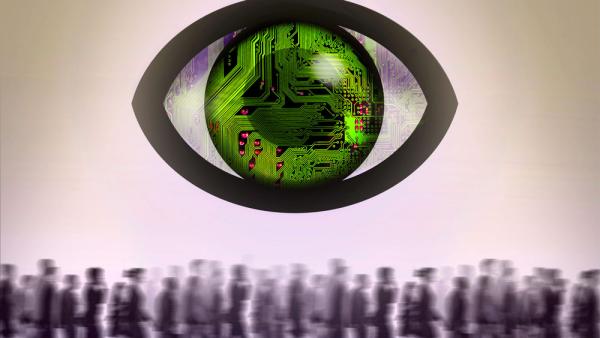Künstliche Intelligenz und die autoritäre Gefahr

Bild: Kameras im öffentlichen Raum in Shenzhen, China. Die chinesische Regierung hat die Entwicklung von Überwachungstechnik auf der Basis von Künstlicher Intelligenz vorangetrieben. 8.1.2023 (IMAGO / NurPhoto / Vernon Yuen)
Mit ChatGPT ist Künstliche Intelligenz (KI) im Alltag angekommen. Hört man sich ein wenig um, ist es offensichtlich: Eine Studentin lässt sich die Einleitung ihrer Hausarbeit von dem Chatbot schreiben; ein Unternehmensberater seine Präsentationen gestalten; eine Ausbildungssuchende den Entwurf für ein Bewerbungsschreiben erstellen. Auch in der Berichterstattung über KI hat sich der Schwerpunkt Richtung Alltag verschoben. Nachdem Branchengrößen und Wissenschaftler:innen im März auf Gefahren einer fast allmächtigen KI hingewiesen und ein Moratorium für die Weiterentwicklung der selbstlernenden Systeme gefordert hatten, ging es in der medialen Debatte vor allem um die künftigen Gefahren durch KI. Der offene Brief[1] behauptete, heutige KI-Systeme seien schon auf dem Weg, auch bei allgemeinen Aufgaben mit dem Menschen konkurrenzfähig zu werden – bei speziellen sind sie ohnehin schon besser – und malte in Frageform ein apokalyptisches Szenario an die Wand: „Sollten wir alle Jobs automatisieren, auch die erfüllenden? Sollten wir nichtmenschliche Intelligenzen entwickeln, die uns irgendwann zahlenmäßig überlegen sind, uns überlisten, überflüssig machen und ersetzen könnten? Sollen wir den Verlust der Kontrolle über unsere Zivilisation riskieren?“ Solche Entscheidungen dürften nicht an die Chefs von Tech-Unternehmen delegiert werden. Wenn es kein freiwilliges Moratorium gebe, müssten daher die Staaten eingreifen.