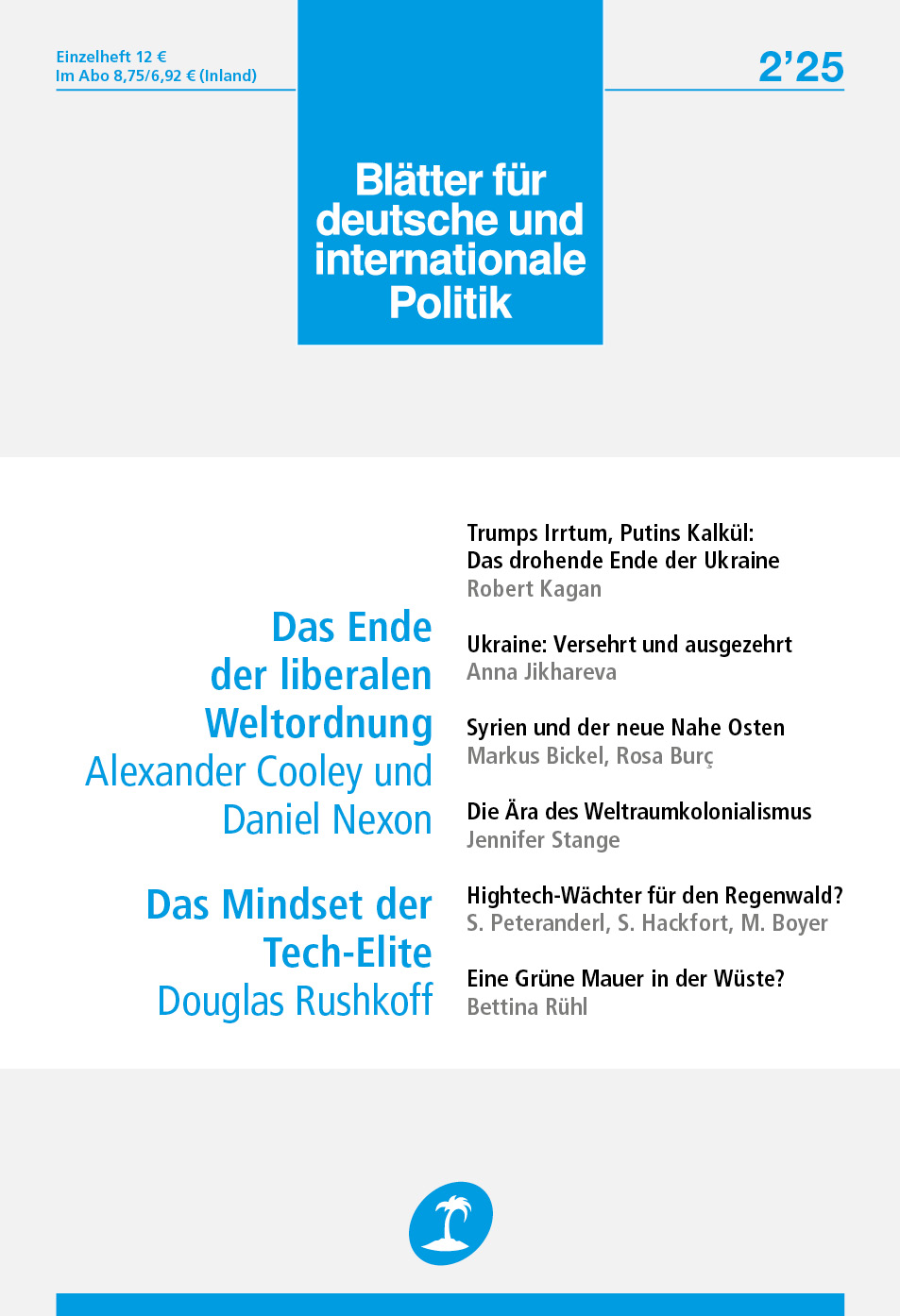Wie die Sahelstaaten auf die Klimakrise reagieren

Bild: Eine Frau pflanzt einen Baum am Stadtrand von Khartoum, Sudan, 12.1.2017 (Mohamed Babiker / IMAGO / Xinhua)
Seit einigen Jahren nehmen auf dem afrikanischen Kontinent, vor allem in den Trockengebieten rund um den Äquator, die Konflikte in erschreckendem Tempo zu. Angeheizt werden sie vor allem durch die Klimakrise: Lebenswichtige Rohstoffe wie Wasser, fruchtbare Ackerflächen und Weideland werden immer knapper, der Kampf darum härter.
So weit hätte es nach dem Willen der Afrikanischen Union (AU) und der Vereinten Nationen (UNO) niemals kommen sollen: 2007 brachte die AU ein geradezu tollkühnes Projekt auf den Weg, sie wollte ein „neues Weltwunder“ schaffen. Ein Baumgürtel von 15 Kilometern Breite und fast 8000 Kilometern Länge sollte entstehen, der sich von der senegalesischen Hauptstadt Dakar ganz im Westen über elf Länder des Sahel bis nach Dschibuti im Osten des Kontinents erstrecken würde. Der Baumgürtel namens „The Great Green Wall“ wäre vom All aus sichtbar gewesen und sollte bis 2030 eine Fläche von 100 Mio. Hektar bedecken. Der Sahel ist die Übergangszone zwischen Wüste und Trockensavanne am Südrand der Wüste Sahara. Die Temperaturen sind ganzjährig hoch, die Niederschlagsmengen gering. Abdoulaye Wade, damals Präsident des Senegal, war von der „Großen Grünen Mauer“ von Anfang an zutiefst überzeugt. Er erklärte 2007: „Die Wüste ist wie eine Krebserkrankung, die sich im Körper ausbreitet. Wir müssen gegen sie kämpfen. Deshalb schließen wir uns diesem Projekt an.