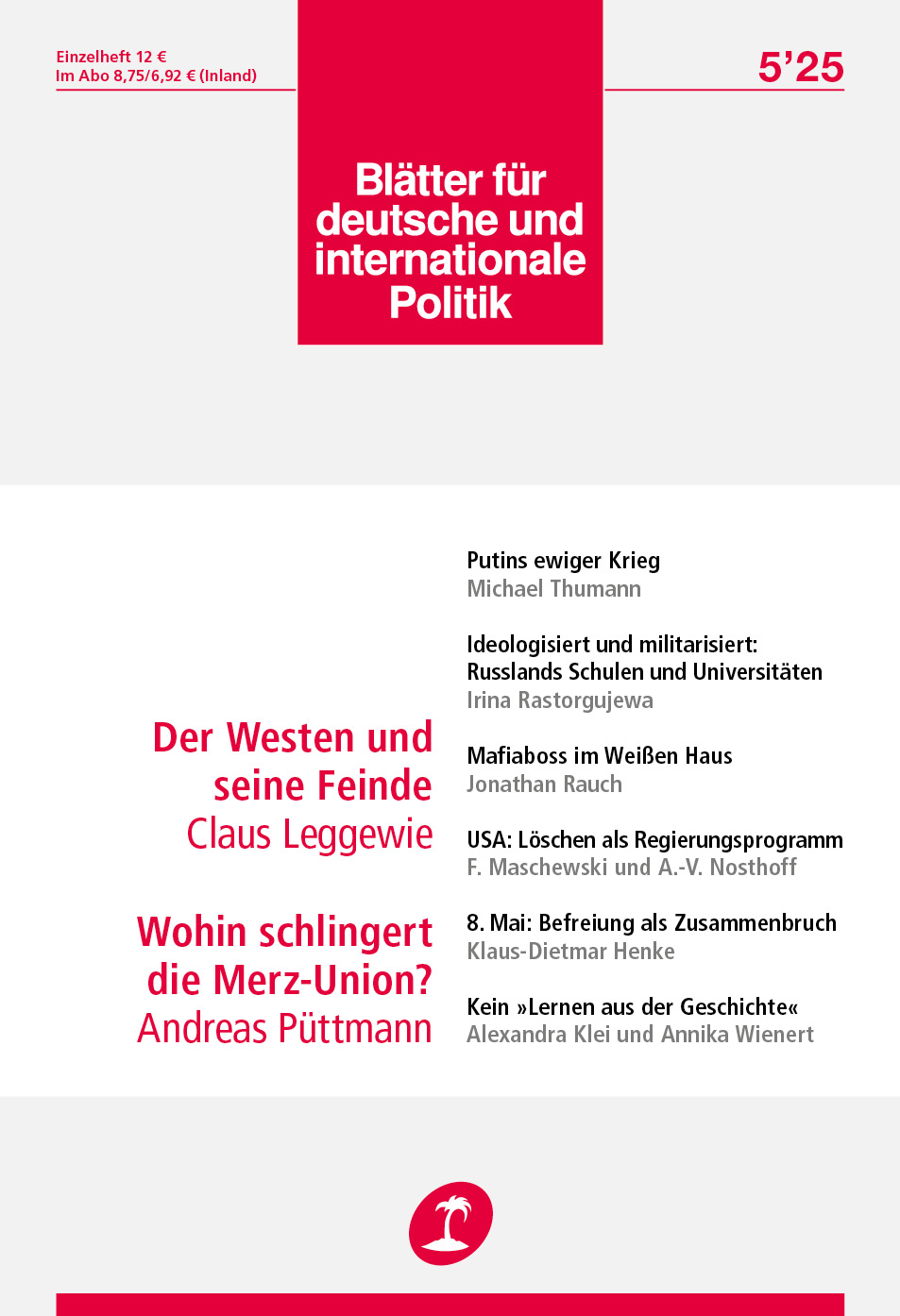Der 8. Mai und das Wiedererstarken des Antisemitismus

Bild: Angriffe, die sich gezielt gegen Gedenkstätten und Denkmäler für die jüdischen Opfer des Nationalsozialismus richten, häufen sich. Es werden etwa Stolpersteine beschmiert oder zerstört (IMAGO / imagebroker)
Wofür steht der 8. Mai 1945 in der deutschen Erinnerungskultur? Bereits zum 70. und zum 75. Jahrestags beschäftigten wir uns ausführlich mit dieser Frage. Ist dem jetzt, am 80. Jahrestag, etwas Neues hinzuzufügen?
Auf den ersten Blick, nein. Der 8. Mai ist weiterhin ein in mehrfacher Hinsicht uneindeutiger Gedenktag, und die Vorbehalte gegen seine Verknüpfung mit dem Begriff der „Befreiung“ bleiben, vor allem in Bezug auf Deutschland, bestehen: Das Ereignis, auf das er sich bezieht, die bedingungslose Kapitulation der Wehrmacht, die militärische Niederlage des nationalsozialistischen Deutschlands, fand an zwei Tagen und an zwei Orten statt. In Deutschland und Europa markiert der Tag das Ende des Zweiten Weltkriegs. Tatsächlich war dieser allerdings noch nicht beendet, die Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki fielen rund drei Monate später.
In Ostmitteleuropa hingegen, also in der Region, in der die meisten Menschen durch die Hand der Deutschen und ihrer Helfer zu Tode gekommen waren, hatte die sowjetische Armee der nationalsozialistischen Herrschaft und ihrem Mordprogramm bereits Monate vor dem 8. Mai 1945 ein Ende gesetzt. Dort spielt das Datum daher eine eher untergeordnete Rolle. Minsk wurde zum Beispiel am 3. Juli 1944 befreit; Lublin, und damit auch das Konzentrations- und Vernichtungslager Majdanek, am 24. Juli 1944. In Majdanek wurde bereits im November eine Gedenkstätte institutionalisiert.