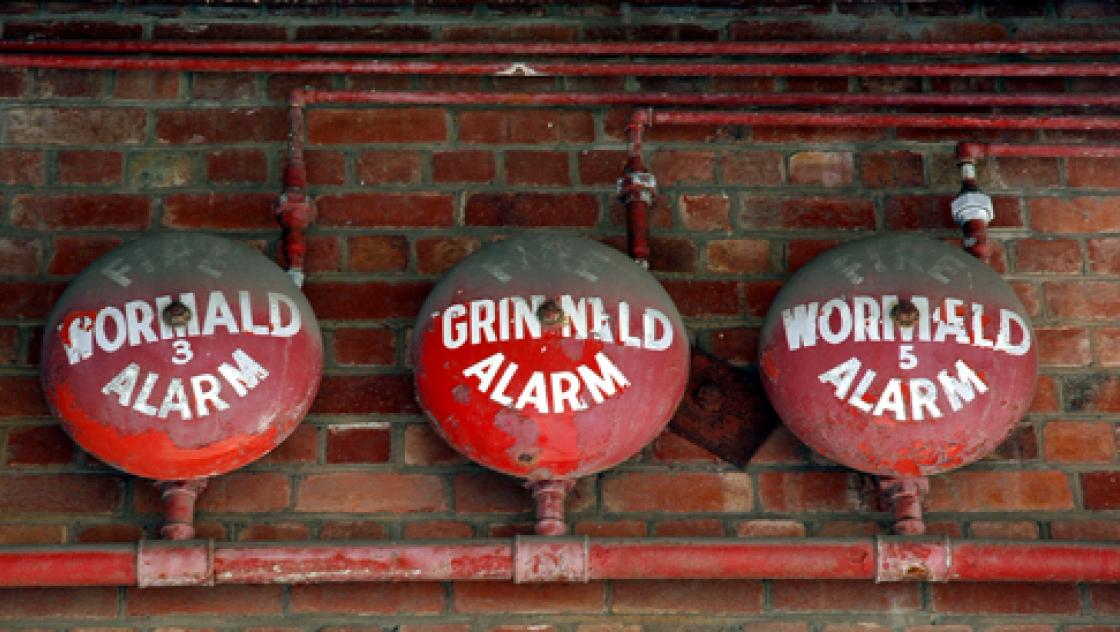Was lebt und was ist tot an der sozialen Demokratie?
Die Amerikaner hätten es gerne besser. Umfragen der letzten Jahre zufolge wünscht jedermann seinem Kind, dass es von Geburt an bessere Lebensbedingungen vorfindet. Man würde es vorziehen, wenn Frau oder Tochter bei einer Geburt die gleichen Überlebenschancen hätte wie die Frauen in anderen fortgeschrittenen Ländern. Eine umfassende und weniger kostspielige medizinische Versorgung würden die Amerikaner ebenso begrüßen wie eine längere Lebenserwartung, besser funktionierende öffentliche Dienstleistungen und weniger Kriminalität.
Wenn man ihnen jedoch sagt, dass es all dies in Österreich, Skandinavien oder den Niederlanden gibt, aber verbunden mit höheren Steuern und einem „interventionistischen” Staat, antworten die gleichen Amerikaner oft: „Aber das ist ja Sozialismus! Wir möchten nicht, dass der Staat sich in unsere Angelegenheiten einmischt. Und vor allem wollen wir keine höheren Steuern.“
Diese seltsame kognitive Dissonanz hat eine lange Geschichte. Vor 100 Jahren stellte der deutsche Soziologe Werner Sombart die berühmte Frage: Warum gibt es in den Vereinigten Staaten keinen Sozialismus? Darauf gibt es viele Antworten. Manche haben mit der schieren Größe des Landes zu tun: Gemeinschaftliche Ziele und Zwecke lassen sich in einem imperialen Maßstab nur schwer verwirklichen und durchhalten.