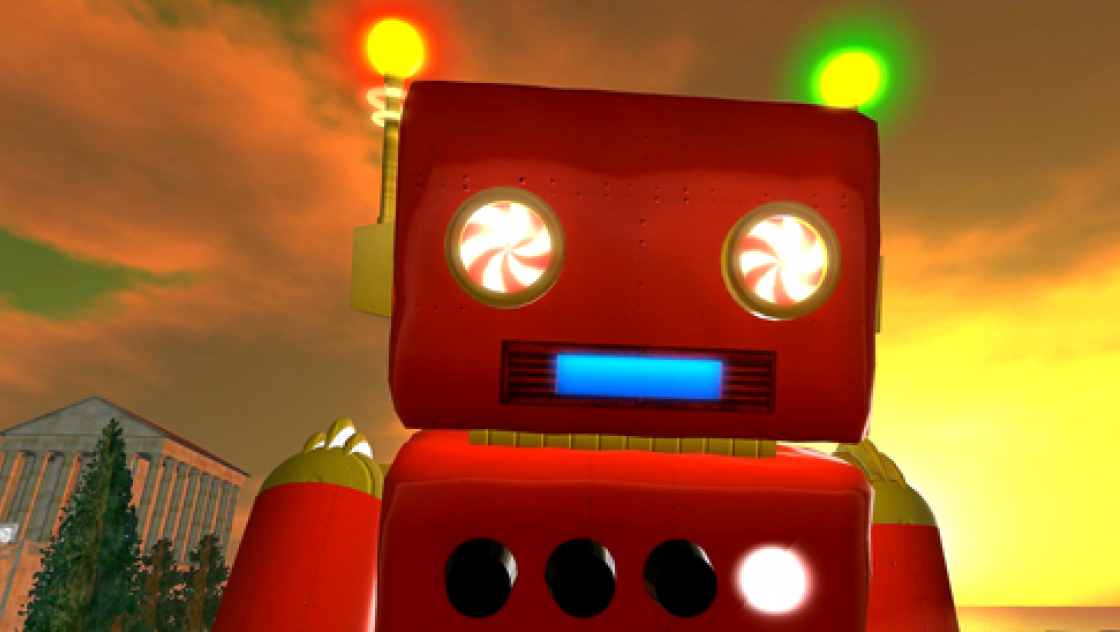Googles Ankündigung, den neuen Dienst Street View bereits bis zum Ende dieses Jahres auch hierzulande einzuführen, entzündete eine hitzige Debatte um den Schutz der Privatsphäre.
Das weit verbreitete Unbehagen gegenüber dem neuen Angebot ist dabei durchaus nachvollziehbar. Schließlich steht der Global Player Google nun buchstäblich auf den Fußmatten auch derer, die sich dem Zugriff des datenhungrigen Konzerns bislang erfolgreich entziehen konnten. Erst nach heftigen Protesten räumte Google schließlich allen Betroffenen die Möglichkeit ein, der Online-Veröffentlichung der hauseigenen Fassade zu widersprechen.
Indes begründeten viele ihren Einwand damit, dass durch den Dienst ihr Privates öffentlich zugänglich würde. Eine solche „Privatstraßenmentalität“
(Gustav Seibt) verkennt freilich, dass die Straße Teil des öffentlichen Raums ist. Die Häuserfassaden bilden somit auch nur dessen Außengrenze: Gerade die abfotografierten Spitzengardinen dienen ja eigens dazu, den Blick ins Innere der privaten vier Wände abzuhalten.
Regelrecht unter umgekehrten Vorzeichen gehen derweil einige „Netzaktivisten“ zur Sache: Sie fordern die kompromisslose „Veröffentlichung des Öffentlichen“.
So will der Blogger Jens Best die „freie Zugänglichkeit“ des „digitalen öffentlichen Raums“ standhaft und mit Kamera in der Hand verteidigen. Er ruft freiwillige Mitstreiter dazu auf, all jene Häuserfronten zu fotografieren, deren Besitzer bei Google Einspruch eingelegt haben. Diese Abbildungen sollen dann von Hand beim kommerziellen Google-Dienst nachgepflegt werden.
Seine Aktion versteht Best als „einen weiteren Schritt zu mehr öffentlich verfügbarem Raum im Digitalen.“ Für diese Überzeugung sei er sogar „bereit, ins Gefängnis zu gehen“, tönte der IT-Berater gegenüber „Spiegel Online“. Dieser feierte Googles Knappen prompt als einen, der „gegen den Strom“ schwimme.
Dem Bürgerschreck Best sprang auf Carta.info der ehemalige FAZ-Blogger Michael Seemann zur Seite – und belegte damit zugleich, mit welch selbstgefälliger Anmaßung ein solcher Gratismut einhergeht. Seemann bezeichnet Google Street View wortgewaltig wie gleichsam verharmlosend als den „Einschlag des digitalen Zeitalters direkt vor die Füße des analogen Menschen.“ Mit anderen Worten: Der deutsche Michel müsse endlich mit einem ordentlichen Schuss vor den Bug aufgeschreckt werden. In völliger Verkennung der Tragweite Googlescher Geschäftspolitik sieht Seemann die Bringschuld allein bei den Bürgern. An die rasanten Veränderungen nun auch seiner analogen Lebensumgebung müsse auch dieser sich gefälligst anpassen. Der Blogger schließt süffisant: „Der Sprung ins kalte Wasser wird niemandem erspart bleiben, so oder so. [...] Willkommen in unserer Welt.“ Kurz: Friss, oder stirb! Das klingt wie digitaler Darwinismus – und ist auch so gemeint.
Welche Folgen aber hat Google Street View nun tatsächlich auf die unterschiedlichen Sphären? Es ist eben nicht einfach so, dass das Private durch den neuen Dienst nun öffentlich würde. Genauso wenig wird das Öffentliche einer Allgemeinheit zugänglich gemacht, wie manche Blogger gerne glauben möchten. Das genaue Gegenteil ist der Fall. Google eignet sich nun auch noch in einem nie gekannten Ausmaß den öffentlichen Raum an – kurzum: Der Konzern privatisiert die Öffentlichkeit. Auf diese Tatsache aber muss man erst einmal kommen.