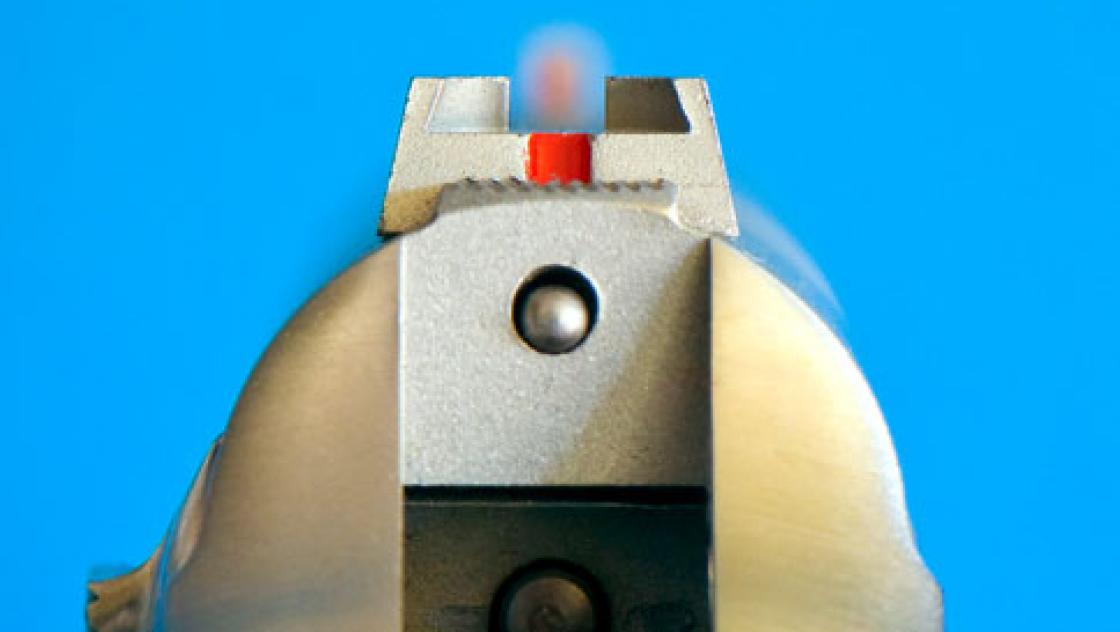Der Buback-Prozess und die Rolle des Geheimdienstes
Auch ein Nicht-Ergebnis kann ein Ergebnis sein. Wenn eine Straftat nicht aufgeklärt wird, sieht man im besten Falle, warum dies so ist. Insofern liegt der Wert des Prozesses gegen Verena Becker vor dem Oberlandesgericht Stuttgart nicht primär im Strafrechtlichen, sondern im Politischen. Und zwar gerade nicht, weil es sich um einen politischen Prozess gehandelt hätte, im Gegenteil: Wenn es nach den Staatsschutzorganen gegangen wäre, hätte er gar nicht stattfinden sollen. Der Prozess, der keiner war, erteilte insofern eine Lektion, wie die Bundesrepublik Deutschland funktioniert.
Am 30. September 2010 begann die Hauptverhandlung gegen Verena Becker wegen der tödlichen Schüsse auf Generalbundesanwalt Siegfried Buback und seine beiden Begleiter Wolfgang Göbel und Georg Wurster vom 7. April 1977. Nach vielen Jahren sollte wieder ein RAF-Prozess stattfinden, das öffentliche Interesse war groß. Doch was sich im Gerichtssaal entfaltete, war alles andere als ein „RAF-Prozess“ der bekannten Art: keine Schreiereien, Beleidigungen, Ausschlüsse. Das Medieninteresse ließ folglich bald nach, Berichterstattung fand kaum noch statt. Was tatsächlich in diesem Prozess vor sich ging, entzog sich so weitgehend der öffentlichen Wahrnehmung. Lediglich wenn frühere RAF-Mitglieder als Zeugen geladen waren, tauchte auch der übliche Pressetross auf.