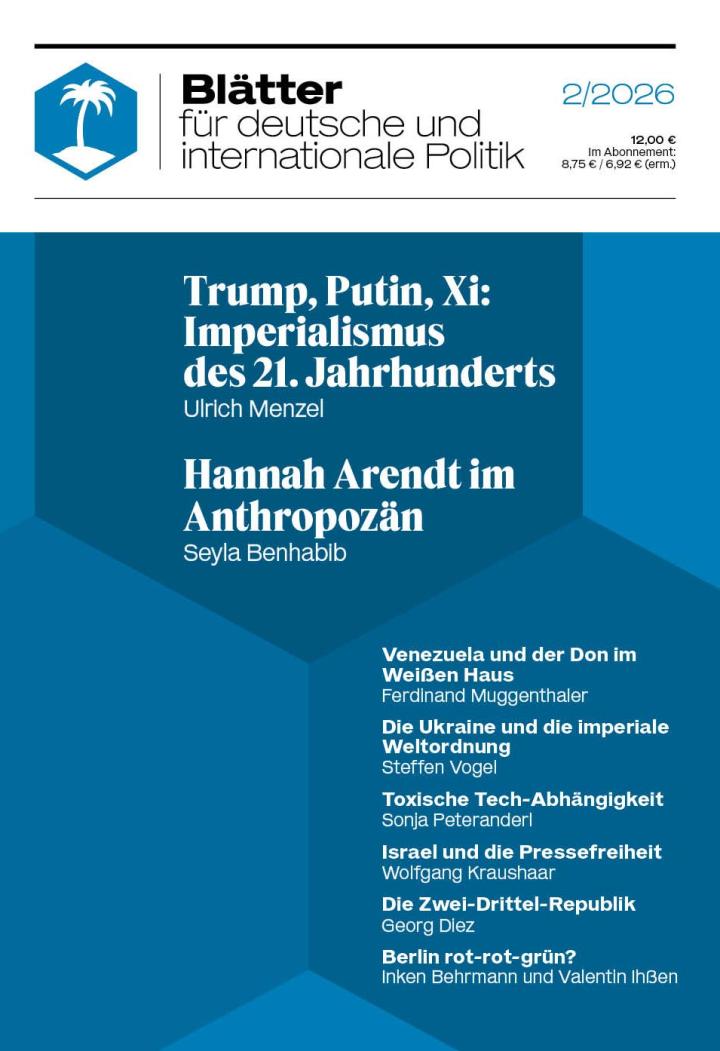Der Brexit war ein Weckruf, doch nicht alle haben ihn vernommen. Jean-Claude Juncker etwa erklärte kurz nach dem historischen 23. Juni, das umkämpfte Freihandelsabkommen mit Kanada könne ohne Zustimmung der nationalen Parlamente in Kraft treten. Zwar konnte der Alleingang in Sachen CETA abgewendet werden, aber der Vorstoß des EU-Kommissionspräsidenten bleibt symptomatisch: Viele Briten demonstrierten bei ihrem Austrittsvotum ein gewachsenes Misstrauen gegenüber den fernen Eliten in Brüssel, und das nicht zuletzt wegen solch wenig demokratischer Praktiken. Noch stärker aber speist sich die bedrohliche Legitimationskrise der EU aus einer langjährigen Politik zu Lasten der Unter- und Mittelschichten: Wie auch in England und Wales wenden sich vielerorts gerade Arbeiter und Arbeitslose von Europa ab.
Wenn es aber um Antworten auf diese Legitimationskrise geht, treten die unterschiedlichen Interessen zwischen Ländern und zwischen Klassen so deutlich wie lange nicht zu Tage. Ob zwischen ihnen ein Ausgleich hergestellt werden kann, wird über Gestalt und Zukunft der EU entscheiden.
Mit Großbritannien haben die Verfechter einer marktliberalen, institutionell schwachen EU einen wichtigen Verbündeten verloren. Auch deshalb verwahrten sich Bundeskanzlerin Angela Merkel und der niederländische Premierminister Mark Rutte umgehend gegen weitreichende Reformen. Finanzminister Wolfgang Schäuble erklärte gar, künftig sollten einzelne Nationalstaaten enger zusammenarbeiten und dabei nötigenfalls auch die Brüsseler Institutionen übergehen.
Dieser Ansatz klingt pragmatisch, schreibt aber nur fest, was in der EU seit sechs Jahren gängige Praxis ist: die intergouvernementale Zusammenarbeit. In der Eurokrise drängten die nationalen Regierungen alsbald EU-Kommission und Europaparlament an den Rand und verlagerten die entscheidende Krisenbekämpfung in den Europäischen Rat, also zu den Premierministern und Präsidenten. Die großen Staaten können so ihre ökonomische Stärke ausspielen. Gerade Berlin hat dieses Prozedere stets genutzt, um jeglichen Interessenausgleich zu Lasten der Bundesrepublik abzuwehren: Das gilt für Eurobonds oder Schuldenschnitte, aber ebenso für die enormen deutschen Handelsbilanzüberschüsse.
Dieser ökonomische Nationalismus geht nicht zuletzt auf Kosten traditioneller Verbündeter wie Frankreich und Italien – und er hat den politischen Nationalismus massiv befeuert. Denn all die Brüsseler Gipfel zur Rettung des Euro vermitteln seit Jahren das fatale Bild, jeder Regierungschef streite primär für die Belange seines Nationalstaates, anstatt ein europäisches Gesamtinteresse zu verfolgen.
Zerstörerische Nationenkonkurrenz
Ein solches zeigt sich schon eher hinter den Wortmeldungen von Linken und Liberalen: Griechenlands Premierminister Alexis Tsipras und sein italienischer Amtskollege Matteo Renzi plädierten kurz nach dem britischen Referendum erneut für ein Ende der Austerität; ähnlich äußerte sich Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel. Sein Parteigenosse Martin Schulz wagte sogar den großen Wurf, als er für eine EU-Regierung und eine zweite Kammer im von ihm geleiteten Europaparlament eintrat. Bei diesen und weiteren Vorstößen, etwa von der französischen Regierung, geht es um zweierlei: Kurzfristig soll ein größerer Spielraum gegenüber den EU-Budgetvorgaben erstritten werden, mit denen derzeit Spanien und Portugal auf den zerstörerischen Austeritätskurs gezwungen werden sollen. Und mittelfristig wollen die Beteiligten das Momentum nutzen, um europaweite sozialstaatliche Standards und eine Umverteilung zwischen den EU-Mitgliedern zu etablieren.
Diesem richtigen Ansatz stehen jedoch enorme Hürden im Weg: In Nord- und Osteuropa ist eine enge Kooperation oft unbeliebt; dort würden einige Staaten zumindest vorerst nicht mitziehen wollen. Schwerer wiegt noch, dass die Neoliberalen in Berlin oder Den Haag die nach dem Brexit gewachsene Macht der Südeuropäer fürchten und deswegen Blockaden errichten könnten: Frankreich, Italien und Spanien sind vergleichsweise starke Volkswirtschaften und obendrein bevölkerungsreiche Länder mit entsprechendem Gewicht im Europaparlament.
Dialektik des Ausgleichs
Daraus ergibt sich eine regelrecht dialektische Spannung: Ein solcherart demokratisiertes Europa wäre zwar ein besserer Garant für einen Interessenausgleich. Aber schon das Entstehen dieses Europas setzt einen solchen voraus. Dies ist gegenwärtig nahezu undenkbar – solange Berlin nicht bereit ist, sein enggefasstes nationales Interesse zugunsten genuin europäischer Lösungen aufzugeben. Deutschland müsste dafür nicht nur seine Handelsbilanzüberschüsse reduzieren, sondern auch jene Rolle einnehmen, die etwa den reicheren US-Bundesstaaten zukommt – und für eine Einheit zahlen, von der es seit langem profitiert.
Gewiss, momentan sind solche Schritte höchst unpopulär und dürften daher mindestens bis nach der Bundestagswahl 2017 nicht zur Debatte stehen.
Dennoch gibt es gute Gründe, warum Berlin sich längerfristig auf solche Reformen einlassen könnte: Wer, wenn nicht die Bundesrepublik, hat ein – nicht zuletzt ökonomisches – Kerninteresse am Erhalt der Europäischen Union? Deren Fortbestand aber – daran erinnert der Brexit – ist keineswegs gesichert. Den nötigen neuen Rückhalt wird die EU jedoch nur dann erfahren, wenn die Europäer im gemeinsamen Interesse kooperieren – und die enormen ökonomischen Spaltungen in und zwischen den Mitgliedsländern überwinden. Andernfalls droht die endgültige Delegitimierung der EU, und darauf würde die dauerhafte Rückkehr zur zerstörerischen Nationenkonkurrenz folgen.
Grundsätzlich gilt, dass Entscheidungen von europäischer Tragweite erheblich an Legitimität gewinnen, wenn sie von europäischen Institutionen wie einer EU-Regierung und einem gestärkten Europaparlament getroffen werden: In diesem Moment lassen sie das klassische Muster zwischenstaatlicher Diplomatie hinter sich. Bereits heute ist das Europaparlament ganz in diesem Sinne ein Ort, an dem nicht Deutsche mit Franzosen streiten, sondern europäische Sozialisten mit europäischen Konservativen.
Die Idee einer solchen transnationalen Demokratie hat sich nach dem Brexit keinesfalls erledigt, wie Jürgen Habermas treffend bemerkt: „Ein Versuch, den man gar nicht erst unternimmt, kann nicht gescheitert sein.“[1] Eher ist die Verwirklichung dieser Vision nach dem Votum der Briten noch zwingender geworden: Schritte in diese Richtung zu unternehmen, ist allemal realitätstauglicher als starr auf jenem Kurs zu bleiben, der Europa seit Jahren auseinandertreibt.
[1] Vgl. „Die Zeit“, 7.7.2016.