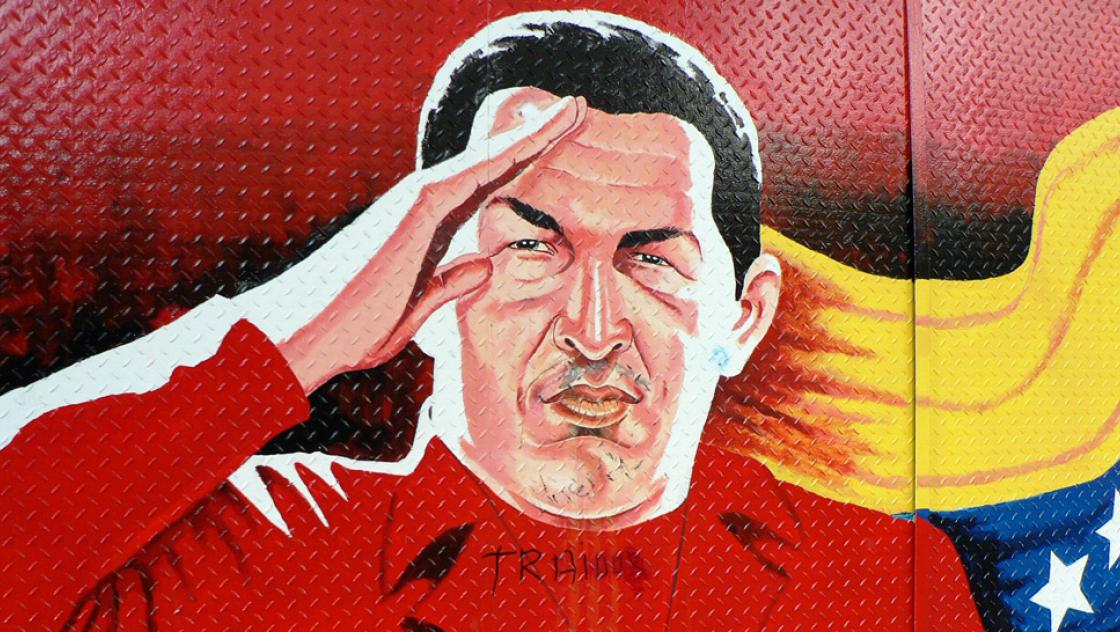In der August-Ausgabe der »Blätter« warf der Politikwissenschaftler Dieter Boris seinem Kollegen Jan-Werner Müller (Schatten der Repräsentation: Der Aufstieg des Populismus, »Blätter«, 4/2016) eine »Populismuskritik ohne Tiefgang« vor. Darauf erwidert der kritisierte Jan-Werner Müller.
Dieter Boris wirft mir zweierlei vor: ein „reduktionistisches Demokratieverständnis” und die Unfähigkeit, etwas Gehaltvolles über die Entstehungsbedingungen von Populismus zu sagen. Ein wirkliches Argument gegen meine Charakterisierung von Populismus wird dagegen nicht vorgebracht, was ja auch möglich gewesen wäre (nach dem Motto: Populismus ist etwas völlig anderes, als mein Beitrag behauptet).
Ich gehe hier kurz auf die zwei Hauptpunkte ein, weil sie auch in anderen kritischen (allerdings auch konstruktiveren und weniger Ressentiment-geladenen) Bemerkungen zu meinem neuen Buch „Was ist Populismus?“ aufgetaucht sind und zumindest teilweise auf Missverständnissen beruhen.
Erstens: Auf grenzwertige Weise wird hier aus einer historischen Analyse auf die normative Position des Autors geschlossen. Der von Boris zitierte Satz „Das Ideal der Volkssouveränität sollte so weit wie möglich heruntergedimmt werden“, ist keine Forderung von mir, sondern beschreibt die Haltung maßgeblicher Eliten im Nachkriegseuropa.