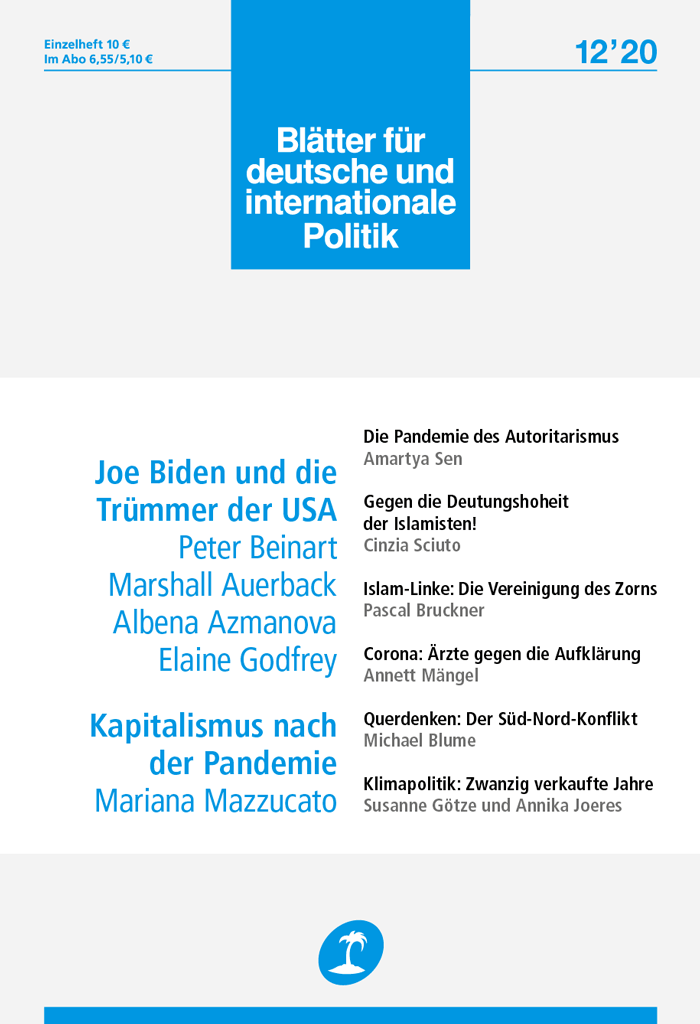Bild: imago images / Pacific Press Agency
Westafrika befindet sich im Wahlmarathon: Zwischen Mitte Oktober und Ende Dezember werden in Guinea, der Elfenbeinküste, Burkina Faso, Ghana und Niger neue Staatschefs gewählt, in den drei letzteren Ländern zudem neue Parlamente. Mit Benin folgt Anfang 2021 eine weitere Präsidentschaftswahl in der Region. Eine Stärkung der Demokratie in Westafrika bedeuten diese Wahlen jedoch nicht, im Gegenteil. Fast überall sind die Urnengänge von großer Unsicherheit geprägt; vor allem im Sahel verschlechtert sich die Sicherheitslage durch Terrorismus, Banden und organisiertes Verbrechen zusehends. In den Küstenstaaten gehen zudem Militär und Polizei zunehmend brutal gegen Oppositionelle vor. Daneben begünstigen Verfassungsänderungen in Guinea und der Elfenbeinküste die Rückkehr zur vergangen geglaubten Ära der Langzeitherrscher. Dabei galt die Entwicklung hin zu mehr Demokratie in Westafrika in den vergangenen Jahren als beispielhaft. Die 16 Länder umfassende Region war mit Ausnahme von Togo seine Dauerpräsidenten losgeworden und hatte fast überall die Amtszeiten der Präsidenten auf zwei Mandate begrenzt.
Genau diese Begrenzung hat Guineas Präsident Alpha Condé nun erfolgreich umgangen. Bei der Wahl am 18. Oktober erhielt er nach Angaben der Wahlkommission (CENI) knapp 60 Prozent der Stimmen, auf seinen Herausforderer Cellou Dalein Diallo entfielen knapp 34 Prozent. Damit bleibt der 82jährige nach zehn Jahren an der Staatsspitze für weitere sechs Jahre im Amt. Um sein drittes Mandat zu ermöglichen, setzte Condé erst im März eine Verfassungsänderung durch – gegen den erbitterten Widerstand von Opposition und zivilgesellschaftlichen Organisationen. Das dafür erforderliche Referendum gewann er indes deutlich: Offiziellen Zahlen zufolge stimmten knapp 90 Prozent für die Verfassungsänderung, die Wahlbeteiligung lag – trotz des Boykottaufrufs der Opposition – bei 58 Prozent. Zwar kann der Präsident auch gemäß der neuen Verfassung nur einmal wiedergewählt werden; allerdings werden bisherige Mandate nicht eingerechnet.[1] Zudem wurde die Amtszeit um ein Jahr auf insgesamt sechs Jahre verlängert.
Noch vor zehn Jahren galt Condé als Hoffnungsträger für eine demokratische Erneuerung: In der ersten freien Wahl seit der Unabhängigkeit von Frankreich im Jahr 1958 wurde der an der Pariser Sorbonne ausgebildete Jurist 2010 ins Präsidentenamt gewählt. Jahrzehntelang hatte er zuvor gegen die verschiedenen Diktaturen Guineas gekämpft, unter General Lansana Conté, der das Land von 1984 bis 2008 regierte, saß er im Gefängnis. Seine Wählerinnen und Wähler erhofften sich von ihm ein Ende der Vetternwirtschaft und eine Demokratisierung des Landes. Zehn Jahre später sind aber nach Untersuchung der Plattform Lahidi, die die Arbeit von Präsident und Regierung dokumentiert, nur 13 Prozent der Versprechen aus Condés zweiter Amtszeit umgesetzt worden – eine ernüchternde Bilanz.[2] Bereits im vergangenen Jahr hatten Spekulationen über eine geplante Verfassungsänderung zahlreiche Menschen in dem knapp 13 Millionen Einwohner zählenden Land alarmiert. Die Nationale Front zur Verteidigung der Verfassung (FNDC), ein Zusammenschluss von Zivilgesellschaft und politischer Opposition, koordinierte seither den Widerstand gegen einen „Präsidenten auf Lebenszeit“.
Laut FNDC starben in den zwölf Monaten vor der Wahl 92 Menschen bei Demonstrationen. Wie auch im Nachbarland, der Elfenbeinküste, setzen die Proteste immer zeitiger vor Wahlen ein, und die Vorwahlkrisen enden nicht am Wahltag, im Gegenteil: In Guinea sind seitdem verschiedenen Quellen zufolge erneut mindestens 21 Personen ums Leben gekommen. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hat Videos, Satellitenbilder und Augenzeugenberichte ausgewertet und sieht ihre These bestätigt, dass Sicherheitskräfte auf Demonstranten geschossen haben.[3]
Das zeigt: Gerade im Umfeld von Wahlen nehmen Menschenrechtsverletzungen in Westafrika zu. Verantwortlich dafür sind oft Mitglieder von Polizei und Armee. Eine juristische Aufarbeitung der Vorfälle bleibt jedoch meist aus, wodurch das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Sicherheitsinstitutionen weiter sinkt. Doch auch international wird die Gewalt im Zusammenhang mit den Urnengängen kaum wahr- oder sogar hingenommen. Kritik gibt es kaum und zumeist nur dann, wenn sich internationale Beobachtermissionen unmittelbar am Wahltag äußern.
Elfenbeinküste: Demonstrationsverbote schüren die Wut der Opposition
Auch in der benachbarten Elfenbeinküste sicherte sich Amtsinhaber Alassane Ouattara am 31. Oktober ein drittes Mandat. Laut der Wahlkommission CEI gewann der 78jährige die Wahl mit 94 Prozent der Stimmen. Ouattara stützte seine Kandidatur ebenfalls auf eine Verfassungsänderung aus dem Jahr 2016. Die neue Verfassung erlaubt zwar auch hier nur zwei Amtszeiten. Ouattara und die regierende Sammlung der Houphouetisten für Demokratie und das Volk (RDHP) argumentieren jedoch, dass mit dem neuen Regelwerk der Zähler wieder auf null gesetzt wurde. Anders als in Guinea gilt Ouattaras Entscheidung nicht nur als Verfassungs-, sondern vor allem auch als Wortbruch. Noch im März hatte er erklärt, dass er nicht erneut antreten wolle. Zu seinem Nachfolger wurde der 61jährige Premierminister Amadou Gon Coulibaly bestimmt – dieser verstarb im Juli allerdings überraschend. Innerhalb der RHDP wurden die Forderungen nach einer erneuten Kandidatur Ouattaras damit begründet, dass sich gut drei Monate vor der Wahl kein neuer, aussichtsreicher Spitzenkandidat mehr aufbauen lasse.
Die Wut über den Wortbruch ist in dem 28 Millionen Einwohner zählenden Land deutlich zu spüren. Auch gehen die Meinungen über Ouattaras Leistung als Staatschef auseinander. Die Elfenbeinküste verzeichnete bis zur Coronakrise zwar ein jährliches Wirtschaftswachstum von rund sieben Prozent und ist die wichtigste Volkswirtschaft im frankophonen Westafrika. Trotzdem lebten 2018 fast 40 Prozent der Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze, sie verfügten über weniger als zwei US-Dollar pro Tag. Ab Mitte August kam es vor allem in Oppositionshochburgen wie Bonoua und Dabou zu schweren Ausschreitungen mit 20 Toten. Ein kurz darauf verhängtes vierwöchiges Demonstrationsverbot trug nicht zur Deeskalation bei.
Unverständnis rief außerdem die Entscheidung des ivorischen Verfassungsrates hervor, lediglich vier der 44 Bewerber als Präsidentschaftskandidaten zuzulassen – ein Trend, der sich auch in anderen Ländern wie Benin abzeichnet, wo bei der Parlamentswahl 2019 nur zwei dem Präsidenten nahestehende Parteien zur Wahl antreten durften. Unter den Abgelehnten sind ehemalige Präsidenten der Nationalversammlung und Minister sowie zwei Urgesteine der ivorischen Politik: der 48jährige ehemalige Rebellenchef und Premierminister Guillaume Soro und der 75jährige Ex-Präsident Laurent Gbagbo.
Gbagbo verlor 2010 als Amtsinhaber die Stichwahl gegen Ouattara, weigerte sich jedoch, die Macht abzugeben. Eine schwere Krise mit mehr als 3000 Toten erschütterte daraufhin das Land, bis Ouattaras Streitkräfte Gbagbo mit Unterstützung französischer und UN-Soldaten festnahmen. Ein anschließender Prozess gegen den Ex-Präsidenten vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag, wo sich dieser wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit verantworten musste, endete 2019 aus Mangel an Beweisen mit einem Freispruch.
In der Elfenbeinküste sind beide im Exil lebenden Politiker in Abwesenheit zu 20jährigen Haftstrafen verurteilt worden – Soro wegen Korruption, Gbagbo wegen „Überfalls auf die BCEAO“, die Zentralbank der westafrikanischen Staaten. Gbagbo-Anhänger innerhalb der von diesem einst selbst gegründeten Ivorischen Volksfront (FPI) kritisierten bereits 2018, mit dem Urteil solle seine Kandidatur verhindert werden. Dabei hatten sie seit Jahren auf die Wahl 2020 hingefiebert und auf einen Machtwechsel spekuliert.
Zu Störungen der Wahlen trug jedoch auch die Opposition bei. Der Vorsitzende der FPI, Pascal Affi N‘Guessan, sowie der 86jährige Ex-Präsident Henri Konan Bédié von der Demokratischen Partei der Elfenbeinküste (PDCI) riefen Mitte Oktober zu einem Boykott der Wahl und zivilem Ungehorsam auf. In Blockhauss, einem Viertel der Hafenmetropole Abidjan, errichteten deren Anhänger Straßensperren und hinderten Wähler daran, ins Wahllokal zu gehen. Nach Angaben der Wahlkommission konnten deshalb landesweit nur 17 601 der 22 381 Wahllokale öffnen. Die Glaubwürdigkeit der Wahlen stellte die Kommission dennoch nicht in Frage. Unter diesen Bedingungen sei es nach Einschätzung der internationalen Beobachtermission des Carter Centers und des Instituts für nachhaltige Entwicklung in Afrika (EISA) schlicht nicht möglich gewesen, „faire und glaubwürdige Wahlen zu organisieren“.
Unterdessen geht die Regierung immer härter gegen den Oppositionsblock vor, was ihre Akzeptanz innerhalb der Bevölkerung weiter schrumpfen lässt. Die Opposition hatte schon am Wahltag angekündigt, einen Übergangsrat mit Bédié an der Spitze zu formen. Vor dessen Villa im Viertel Cocody fielen zwei Tage später Schüsse, am Tag darauf wurde die Straße abgeriegelt und Tränengas einsetzt. Zahlreiche Ivorer fühlen sich seitdem an die Krise von 2010 erinnert, zumal Soro auf Twitter die Stimmung anheizt und betont, Ouattara sei nicht mehr der Präsident der Elfenbeinküste. Oberstaatsanwalt Richard Adou gab mittlerweile bekannt, dass 16 hochrangige Oppositionspolitiker strafrechtlich verfolgt werden. Die Anschuldigungen lauten unter anderem „Organisation einer aufständischen Bewegung“ und terroristische Aktivitäten.
Angesichts der Entwicklungen in beiden Ländern wäre es die Aufgabe der Westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS gewesen, deutliche Worte zu finden. Doch diese blieben aus. Stattdessen heißt es in einer gemeinsamen Erklärung mit der Afrikanischen Union (AU): Die Wahlen in der Elfenbeinküste seien „insgesamt zufriedenstellend“ verlaufen. Schon während einer ECOWAS-Mission Anfang Oktober in Guinea hatte Ghanas Außenministerin Shirley Ayorkor Botchway die Bekundungen von Präsident Condé gelobt, er wolle alles für friedliche Wahlen tun. Es sei an den Wählern zu entscheiden, ob sie ein drittes Mandat befürworteten.
Überraschend sind diese beschwichtigenden Äußerungen nicht: Bis auf seltene Ausnahmen halten sich die Staatschefs der Regionalorganisation mit gegenseitiger Kritik zurück. Statt mehr Demokratie einzufordern, sorgt das Netzwerk vielmehr dafür, dass sich deren Mitglieder gegenseitig an der jeweiligen Staatsspitze halten.
Zentral-Sahel: Terrorgruppen, Banden und Milizen
Noch dramatischer ist die Lage in den Sahel-Staaten Burkina Faso und Niger, wo am 22. November und 27. Dezember Parlaments- und Präsidentschaftswahlen stattfinden. In beiden Ländern stellt die katastrophale Sicherheitslage die Organisatoren der Wahlen vor große Schwierigkeiten. Wie ernst es um die Region bestellt ist, hatten Ende Oktober Regierungsvertreter sowie Repräsentanten verschiedener internationaler Organisationen während einer Sahel-Geberkonferenz betont. Nach Zählungen der US-amerikanischen Nichtregierungsorganisation Armed Conflict Location & Event Data Project starben allein in Burkina Faso zwischen Oktober 2019 und Oktober 2020 insgesamt 2730 Personen durch Kämpfe, Unruhen, Anschläge und Gewalt gegenüber Zivilisten. Die Zahl der Binnenflüchtlinge in dem Staat lag im September dieses Jahres 22 Mal höher als noch zum Jahresbeginn 2019. Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR) zählte zu diesem Zeitpunkt mehr als eine Million Vertriebene.[4] Durch die anhaltende Gewalt ist vor allem im Norden und Osten des Landes die Infrastruktur stark beschädigt worden. Nach Informationen des Amtes der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA) sind mittlerweile 95 Krankenstationen geschlossen, 199 arbeiten nur noch eingeschränkt.[5] Auch mehr als 2500 Schulen – im ländlichen Westafrika werden diese als Wahllokale genutzt – können nach gezielten Angriffen nicht mehr geöffnet werden.
Der Terror breitete sich in Burkina Faso bereits wenige Wochen nach der Amtseinführung von Präsident Roch Marc Christian Kaboré im Dezember 2015 merklich aus. Unter dem früheren Langzeitherrscher Blaise Compaoré, der im Oktober 2014 nach heftigen Protesten der Zivilgesellschaft und der Bewegung Balai Citoyen (Bürgerbesen) zurückgetreten war, galt es lange als stabiles und sicheres Land, allerdings auch als eines der ärmsten der Welt, das im internationalen Vergleich, etwa beim Entwicklungsindex der Vereinten Nationen, stets auf den letzten zehn Plätzen zu finden ist. Die Perspektivlosigkeit der jungen Bevölkerung wie die Langzeitherrschaft wollte die Protestbewegung nicht mehr hinnehmen. Mittlerweile ist jedoch bekannt, dass Compaoré Abkommen mit Milizen getroffen hatte. Es heißt, dass diese das Land als Rückzugsort nutzen konnten und es im Gegenzug dafür nicht angriffen. Der derzeitige Amtsinhaber Kaboré hingegen bekräftigte, unter ihm solle es keine Deals mehr mit Terrorgruppen geben.[6] Allerdings gehörte er noch bis wenige Monate vor dem Sturz Compaorés dessen Regierungspartei an. Ein neuer, unbelasteter Politiker war dieser also schon vor fünf Jahren nicht. Nun tritt er erneut als Spitzenkandidat an.
Inmitten der um sich greifenden Gewalt transparente, faire und glaubwürdige Präsidentschafts- und Parlamentswahlen abzuhalten, gilt als nicht realistisch. Bereits im August hatte die nationale Wahlkommission (CENI) bekannt gegeben, dass bei der im Frühjahr durchgeführten Erfassung für das neue biometrische Wählerregister 22 Kommunen nicht aufgesucht werden konnten. Dabei würden alleine dort laut nationalem Statistikinstitut 417 000 Erwachsene leben.[7] Mittlerweile heißt es, dass die Wahlen nur auf gut 82 Prozent des Staatsgebietes stattfinden werden. Der Präsident der Wahlkommission, Newton Ahmed Barry, musste im Oktober gar mit dem Hubschrauber zu Treffen in die Städte Djibo und Arbinda im Norden des Landes reisen, da Konvois oft angegriffen werden. In 14 von 45 Provinzen gilt der Ausnahmezustand, seit Jahren kommt es mancherorts mehrmals pro Woche zu Überfällen und Anschlägen. Angesichts dessen ist es schier unmöglich, die betroffenen Regionen rund um den Wahltermin so zu sichern, dass die Bevölkerung dort auch tatsächlich gefahrlos abstimmen kann. Dadurch haben auch zahlreiche Kandidaten der Parlamentswahl keine Möglichkeit, vor Ort Wahlkampf zu machen.
Von der Wahl ausgeschlossen werden zudem Binnenflüchtlinge, die sich nicht ausweisen können. Ohne Papiere aber ist es nicht möglich, neue Dokumente zu erstellen. Dabei hatte unter anderem die katholische Bischofskonferenz frühzeitig dazu aufgerufen, die Flüchtlinge in den Prozess mit einzubeziehen. Dass sie nun nicht wählen können, könnte die Wahlbeteiligung, die vor fünf Jahren bei 60 Prozent lag, weiter sinken lassen. Trotz all der Widrigkeiten hält die Wahlkommission jedoch an der angesetzten Wahl fest: Das Rechtssystem im Sahel müsse aufrechterhalten werden, rechtfertigte Barry die Entscheidung.[8]
Amtsinhaber Kaboré, der als aussichtsreichster Kandidat gilt, könnte von einer geringeren Stimmenzahl in konfliktgebeutelten Landstrichen profitieren, denn hier ist der Unmut gegenüber der Regierung am stärksten. Beobachter gehen allerdings davon aus, dass die Oppositionsparteien den 63jährigen immerhin in eine Stichwahl drängen könnten. Insgesamt stehen dreizehn Präsidentschaftskandidaten zur Wahl, unter ihnen auch der Vorsitzende der ehemals regierenden Partei Compaorés, der Kongress für Demokratie und Fortschritt (CDP). Experten warnen mittlerweile davor, dass Burkina Faso in eine ähnliche Lage wie das benachbarte Mali geraten könnte, wo die umstrittene Parlamentswahl im März dieses Jahres monatelange Proteste auslöste, die schließlich im August zu einem Militärputsch beitrugen. Bereits bei der dortigen Präsidentschaftswahl im Juli und August 2018 und der Parlamentswahl im März hatte sich gezeigt, wie schwierig die Organisation von Wahlen im Zentralsahel ist. Anders als in Burkina Faso gibt es dort seit 2013 die Stabilisierungsmission der Vereinten Nationen für Mali (Minusma). Sie steht zwar immer wieder in der Kritik, hat aber den Wahlprozess logistisch unterstützt. Auf solche Unterstützung kann Burkina Faso nicht zurückgreifen.[9]
Niger: Menschenrechte unter Druck
Als einigermaßen stabil galt bisher der benachbarte Binnenstaat Niger, in dem eine der ärmsten und zugleich jüngsten Bevölkerungen der Welt lebt – wie in Burkina Faso liegt das Durchschnittsalter der gut 23 Millionen Einwohner bei lediglich 16,5 Jahren. Mit Agadez befindet sich hier zudem das Drehkreuz der westafrikanischen Migration. Doch nach Informationen von ACLED kamen seit Ende Oktober 2019 auch hier 1174 Personen durch Kämpfe und Angriffe ums Leben. Längst ist nicht mehr nur die Region Diffa am Tschadsee betroffen, in die sich schon vor Jahren Kämpfer der nigerianischen Terrorgruppe Boko Haram zurückgezogen haben, sondern vor allem die Region Tillabéri, die an Burkina Faso und Mali grenzt. Besonders in den Fokus geraten sind in den vergangenen Monaten Entwicklungshelfer. Einerseits lässt sich mit ihnen viel Lösegeld erpressen, andererseits sorgen solche Entführungen für internationale Aufmerksamkeit. Im Juni wurden zehn Mitarbeiter der Hilfsorganisation APIS, ein Partner des UN-Welternährungsprogramms, verschleppt, im August sieben Angehörige der NGO ACTED sowie ihr Fremdenführer südöstlich der Hauptstadt Niamey ermordet. Für die Wahlen sollen nun landesweit die Sicherheitskräfte geschult werden, nicht zuletzt um die Einhaltung der Menschenrechte zu gewährleisten.[10]
Diese jedoch sehen Beobachter zunehmend unter Druck. Amnesty International etwa kritisierte mehrfach, dass drei politische Aktivisten über ein halbes Jahr in Haft saßen, weil sie Mitte März an einer Anti-Korruptions-Demonstration teilgenommen hatten. Laut der westafrikanischen Denkfabrik WATHI werden friedliche Demonstrationen fast systematisch verboten. Schon 2019 wurde ein Gesetz verabschiedet, das die Meinungsfreiheit im Internet einschränkt. Auch ist bei Abhörbeschlüssen nur die Zustimmung des Präsidenten notwendig, nicht aber eine gerichtliche Prüfung.
Der neue Präsident – Amtsinhaber Mahamadou Issoufou tritt nicht mehr an – wird diese Einschränkungen kaum aufheben. Schließlich gilt es als wahrscheinlich, dass Mohamed Bazoum, Issoufous parteiinterner Nachfolger, in das höchste Staatsamt gewählt wird und die Linie der Nigrischen Partei für Demokratie und Sozialismus (PNDS) fortführt. Schon bei der vorangegangenen Wahl vor fünf Jahren hatte die Opposition mit extremen Schwierigkeiten zu kämpfen: Mit Hama Amadou saß ihr bekanntester Kandidat im Gefängnis. Ihm wurde vorgeworfen, an einer Kinderhandelaffäre beteiligt gewesen zu sein. Seine Anhänger gingen jedoch davon aus, dass er politisch ausgeschaltet werden sollte. Trotz dieser Schikanen war es Amadou damals überraschend gelungen, in die Stichwahl einzuziehen.
Die Macht in den Händen einer kleinen Elite
Hoffnungsschimmer der Region ist erneut Ghana, das als Westafrikas Musterdemokratie bezeichnet wird. Die internationale Nichtregierungsorganisation Freedom House mit Sitz in Washington D.C. kategorisiert das gut 29 Millionen Einwohner zählende Land als frei und verleiht ihm die besten Werte auf dem ganzen Kontinent.[11] Seit der Rückkehr zum Mehrparteiensystem 1992 ist es in Ghana zu mehreren friedlichen Machtwechseln zwischen den Kandidaten der Neuen Patriotischen Partei (NPP) und dem Nationalen Demokratischen Kongress (NDC) gekommen.
Am 7. Dezember stehen sich Ex-Präsident John Mahama vom NDC und Amtsinhaber Nana Akufo-Addo von der NPP nun zum dritten Mal gegenüber. Letzterer hatte vor vier Jahren als Oppositionskandidat gegen den 62jährigen Mahama gewonnen, der wiederum das Präsidentenamt von 2012 bis 2016 innehatte. Jetzt will Mahama das höchste Staatsamt zurückerobern.
Bei der Bewertung des politischen Systems in Ghana wird allerdings eines oft vergessen: Es ist eine kleine Elite, die das Land seit Jahrzehnten regiert. Akufo-Addos Vater Edward gehörte zu den „Großen Sechs“, den Gründern der Vereinigten Konvention der Goldküste (UGCC), die sich 1947 formierte, um die Unabhängigkeit von Großbritannien voranzutreiben. Später wurde er Richter am Obersten Gerichtshof und von 1970 bis zum Staatsstreich am 13. Januar 1972 Präsident der zweiten Republik. Zu den Gründervätern gehörten außerdem ein Onkel und ein Großonkel des heutigen Präsidenten.[12]
Auch Mahamas Vater Emmanuel Adama war Parlamentsmitglied in der ersten Republik sowie unter dem ersten Präsidenten Kwame Nkurmah Staatsminister für die Nordregion. Er wird als wohlhabender Reisbauer beschrieben. Heute werden John Mahamas Brüder – vor allem Ibrahim, der verschiedene Firmen gegründet und aufgebaut hat – immer wieder in einer Reihe mit den wohlhabendsten Ghanaern genannt.
Ein Machtwechsel bedeutet deshalb nicht, dass sich eine neue Politikergeneration etablieren kann. So verwundert es auch nicht, dass nur jeder dritte Ghanaer der Meinung ist, Ghana würde sich in die „richtige Richtung“ entwickeln.[13] Vielmehr ist nur eine sehr kleine, wohlhabende Elite Teil des herrschenden politischen Netzwerks, zu dem Außenstehende kaum Zugang haben – und dieser bleibt die Macht weiter vorbehalten.
Der Wahlmarathon in Westafrika zeigt damit selbst im Vorzeigeland Ghana vor allem eines: Die Hoffnungen auf eine Demokratisierung der Region, die ein großer Teil der sehr jungen Bevölkerungen dieser Staaten hegen, sind zumindest vorerst an den politischen Realitäten zerschellt.
[1] Die Verfassung von 2010 schloss diese Möglichkeit noch explizit aus. Vgl. République de Guinée, constitution du 7 mai 2010, Artikel 27, https://mjp.univ-perp.fr/constit/gn2010.htm.
[2] Bilan du President Alpha Conde, www.lahidi.org, 13.10.2020.
[3] Guinée. Des récits de témoins, des vidéos et images satellites analysées confirment les tirs à balles réelles par les forces de défense et de sécurité sur des manifestants, www.amnesty.org, 25.10.2020.
[5] OCHA, Burkina Faso – Aperçu de la Situation Humanitaire au 08 août 2020, www.humanitarianresponse.info, 21.8.2020.
[6] Dirke Köpp und Frejus Quenum, Burkina Faso: „Keine Deals mehr mit Terrorgruppen!“, www.dw.com, 22.2.2019.
[7] Sophie Douce, Au Burkina Faso, la présidentielle et les législatives à la merci des djihadistes, www.lemonde.fr, 18.9.2020.
[8] Voice of America, Les élections de 2020 se préparent et inquiètent, www.voaafrique.com, 1.10.2019.
[9] Vgl. Charlotte Wiedemann, Mali: Putschisten als Hoffnungsträger?, in: „Blätter“, 10/2020, S. 33-36 sowie dies., Mali am Abgrund: Fünf Jahre Militärintervention, in: „Blätter“, 5/2018, S. 64-70.
[10] Vgl. Ismaël Chékaré, Elections générales 2020-2021: Les FDS se préparent pour un processus électoral dans la paix et la sérénité, www.nigerdiasspora.net, 9.10.2020.
[11] Vgl. www.freedomhouse.org, 7.11.2020.
[12] Neither Victim Nor Pawn, www.thebusinessyear.com, 8.11.2010.
[13] Afrobarometer, www.afrobarometer.org/countries/ghana-1, 8.11.2020.