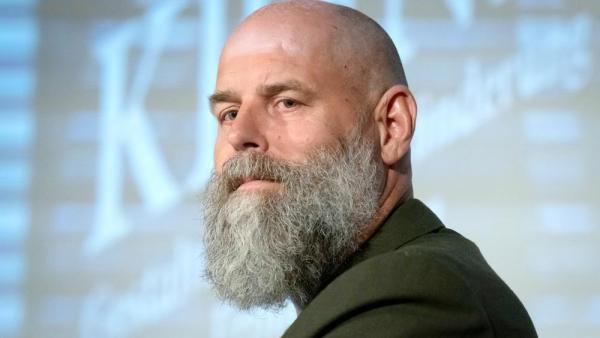Das Berliner Schloss als Restaurationskulisse

Bild: IMAGO / Future Image
Die digitale Eröffnung des „Humboldt Forums“ am 17. Dezember vergangenen Jahres erinnerte an eine populäre Fernsehshow. TV-Moderator Mitri Sirin begrüßte die Zuschauer*innen mit schwärmerischem Blick vor den beleuchteten Barockfassaden: „Darüber hat es so intensive Debatten gegeben. Für die einen eine Provokation und für die anderen die Erfüllung eines Traumes“, sagte er und betrat durch ein großes Portal die Rekonstruktion des ehemaligen Hohenzollernschlosses, das nach sieben Jahren Bauzeit und Kosten in Höhe von 644 Mio. Euro wieder am Schlossplatz in Berlins Mitte steht.
In der Tat werden Debatten um diese Rekonstruktion seit dreißig Jahren geführt, und auch die Wochen vor der Eröffnung blieben nicht ohne heftige Auseinandersetzungen. Der FAZ-Architekturkritiker Niklas Maak fragte sich in einem Artikel, ob eine Generation alter weißer Männer die Stadt nach ihrem Geschmack möbliere und damit dem jungen Berlin seine Freiräume verbaue. Die modern gestaltete Ostfassade sehe außerdem aus wie ein „monumentales Abluftgitter“.[1] Daraufhin forderte der Ko-Architekt Thomas Albrecht die FAZ in einem offenen Brief auf, Maak aus der Redaktion „zu entfernen“. Derweil steht dieser mit seiner Kritik nicht allein: Nach einer Führung durch das Schloss stellte auch Jörg Häntzschel in der SZ fest, der Keller sei der einzige Teil des Gebäudes, „der seinen Ort und seine Zeit weiß, der einzige, der nicht Stein gewordene Verkrampfung ist“. Die Erwartung, hinter barocken Schlossfassaden ein Schloss zu finden und nicht einen „cleanen Zweckbau“, sei dem Gehirn schwer auszutreiben.[2]
Das Berliner Schloss als »Symbol der Wiedervereinigung«
Als Wilhelm von Boddien im Jahr 1992 den Förderverein Berliner Schloss gründete, hatte wohl auch er kein Konglomerat aus preußischem Barock und moderner Betonarchitektur im Sinn. Stattdessen wollte er die jahrhundertelange Residenz der Hohenzollern so aufbauen, wie sie vor ihrer Zerstörung aussah. Das Schloss war 1945 vollständig ausgebrannt und wurde fünf Jahre später auf Geheiß der SED-Führung gesprengt. Der 1942 geborene Boddien wuchs in Hamburg auf und leitete dort eine Landmaschinenfirma, die 2004 insolvent ging. Seitdem widmet er sich ganz und gar der Rekonstruktion des Berliner Schlosses. Gern erzählt Boddien, wie er als 19jähriger zum ersten Mal „an einem düsteren End-Oktober-Tag, Trabi-Duft in der Nase, Braunkohle und Tristesse“, den leeren Schlossplatz erblickte. Nach 1990 sah er die Zeit für den Wiederaufbau gekommen.
Die Bestimmung Berlins zur Hauptstadt der vereinten Bundesrepublik führte zur Umgestaltung der geteilten Stadt. Noch vor seiner Rückbenennung zum Schlossplatz wurde der Marx-Engels-Platz 1994 zum „Gebiet von außergewöhnlicher stadtpolitischer Bedeutung“ bestimmt und dem „Entwicklungsgebiet 2“ zugeordnet. Hier sollten zwar keine Regierungsgebäude entstehen, doch die historische Mitte der Stadt gilt als Aushängeschild der Bundesrepublik und somit nicht nur als städtische, sondern nationale Repräsentationsfläche.
Den medialen Anfang aber machte das „Plädoyer für den Wiederaufbau des Schlüterschen Stadtschlosses“ des konservativen Publizisten und langjährigen FAZ-Herausgebers Joachim Fest. Es erschien 1990 und löste direkt nach der Wiedervereinigung die Schlossplatzdebatte aus. In seinem FAZ-Artikel lieferte Fest erste Argumente für eine Rekonstruktion: „In der weltpolitischen Auseinandersetzung, die hinter uns liegt, ging es nicht zuletzt darum, das Vordringen der Herrschaftsidee [des Sozialismus] zu verhindern. Wenn der Abbruch des Schlosses das Symbol ihres Sieges sein sollte, wäre die Wiedererrichtung das Symbol ihres Scheiterns.“[3] Da wohl schnell klar war, dass die Deutung als westliches Siegessymbol ein Zusammenwachsen der Republiken und somit auch Unterstützung für das Rekonstruktionsprojekt erschwerte, versuchte man, das „Schloss der Demokratie“, das eine „Art Wir-Gefühl“ erzeugen solle, zu einem Symbol der Wiedervereinigung zu wenden.[4]
»Heilung einer Wunde«: Die Debatte über den Wiederaufbau
Aber das historische Schloss war damals aus dem öffentlichen Bewusstsein verschwunden, und so musste zunächst ein Interesse daran geweckt werden. Die Lobbyarbeit übernahmen Bürgervereine und Initiativen, beispielsweise mit einer von Boddien und seinem Verein organisierten und finanzierten Schlosssimulation. Hierfür malte die Großbildkünstlerin Catherine Feff die barocken Fassaden im Maßstab 1:1 auf eine 10 000 Quadratmeter große Leinwand, die ab dem 30. Juni 1993 ein Jahr lang das Berliner Schloss auf dem Schlossplatz simulierte.
Die gigantische Werbeaktion war ein Wendepunkt in der Schlossplatzdebatte. Diese durchlief seit 1990 verschiedene Phasen, in denen jeweils unterschiedliche Möglichkeiten erwogen wurden – von einer Neugestaltung des Schlossplatzes, für die bereits Wettbewerbe ausgeschrieben und Sieger gekürt worden waren, bis zur Bundestagsentscheidung für die Rekonstruktion des Schlosses im Jahr 2002. Die Argumentation der Rekonstruktionsbefürworter*innen nimmt dabei eine offenkundige Entwicklung: Die von Joachim Fests Plädoyer beschworene politische Dimension wird zunehmend hinter stadtplanerischen, kunsthistorischen oder rein ästhetischen Argumenten versteckt.[5] So stellt der Verleger Wolf Jobst Siedler 1992 die Behauptung auf: „Das Schloss lag nicht in Berlin – Berlin war das Schloss.“ Die stadtbildprägenden barocken Achsen blieben ohne Endpunkt wirkungslos, so Siedler.[6] Die Hohenzollernresidenz, deren kunsthistorische Bedeutung oft als Hauptwerk nordeuropäischen Barocks überhöht wird, sei die einzige Option, die „verlorene Mitte“ der Stadt wiederherzustellen. Die Geschichte Berlins wird so als eine des Verlusts erzählt: Durch die kriegsbedingten Zerstörungen sowie die Stadtplanung nach 1945 unter den Vorzeichen der Moderne habe die Stadt ihre Identität und Geschichte eingebüßt, der Schlossplatz sei eine „Wunde“. Weil dieser Platz zum „Herzen der Nation“ stilisiert wird, bekommt die Metapher der „Heilung der Wunde“ eine nationale Dimension.
Der Versuch, das Schloss zu einem nationalen Symbol werden zu lassen, wird durch das Narrativ einer engen Verwandtschaft der Bundesrepublik zum Preußen der Stein-Hardenbergschen Reformen in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts genährt. Das führt zu einem ständigen Widerspruch in der Argumentation der Befürworter*innen: So sagt Boddien stets, es gehe ihm um Ästhetik, nicht um Politik. Auch der Sprecher der Expertenkommission, die 2001 einen kulturell und wissenschaftlich genutzten Neubau für ein „Humboldtforum“ in Form des alten Schlosses empfiehlt, sieht seinen Wert im Künstlerisch-Ästhetischen und nicht in dessen politischer oder funktionaler Bedeutung als Herrschaftssitz. Dennoch erklärt er zugleich, das Schloss verkörpere preußische Geschichte und stehe für dessen „positiven Teil“.
Weichgezeichnetes Preußenbild
Diese Strategie, ein weiches Bild nicht nur der preußischen Geschichte zu zeichnen, wurde zuvor bereits andernorts angewandt. Seit der Wiedervereinigung erlebt Deutschland eine regelrechte Rekonstruktionswelle: auch die Dresdner Frauenkirche, das Potsdamer Stadtschloss und das Braunschweiger Schloss stehen wieder. Der Kirchturm der Garnisonkirche befindet sich im Bau,[7] die Neue Frankfurter Altstadt mit ihren historisierenden Fassaden wurde 2018 eingeweiht; ein ähnliches Wohnquartier, das äußerlich aus der Zeit Friedrichs des Großen stammen könnte, entsteht am Alten Markt in Potsdam, vis-à-vis zum frisch rekonstruierten Palast Barberini.
Das Berliner Schloss kann unter all diesen Projekten als das größte und prestigeträchtigste gelten, seine Bau- und Debattengeschichte teilt es allerdings mit den anderen Bauten. Sie alle sind Gebäude barocker Gestalt, sie alle wurden im Zweiten Weltkrieg zerstört. Manche konnten noch notdürftig genutzt werden, bevor sie schließlich abgetragen wurden. Es vergingen gut vierzig Jahre der Teilung, bis die Rekonstruktion der Gebäude nach der Wiedervereinigung begann. In dieser Zeit – eine historisch durchaus eigenständige Periode – war auf den Grundstücken der verschwundenen Gebäude meist längst Neues entstanden.
So auch auf dem Berliner Schlossplatz: 1976 wurde der Palast der Republik fertiggestellt. Er war Sitz der Volkskammer der DDR, gleichzeitig ein öffentliches Kulturhaus mit Veranstaltungsräumen, Restaurants und einem Theater. Von 1990 bis 2003 wurde der Palast entkernt und asbestsaniert, anschließend für zwei Jahre erneut zum Kulturhaus, bot Ausstellungen und Theateraufführungen Platz. Während des Projektes „Fassadenrepublik“ konnten Besucher*innen mit dem Schlauchboot durch die gefluteten Räume paddeln. 2006 wurde er, trotz großer Proteste, abgerissen, wegen – so die offizielle Begründung – zu starker Asbestbelastung.[8]
Täuschung mittels Rekonstruktion – verzerrte Zeitschichten im Stadtraum
Die nun aufgebauten originalgetreuen Rekonstruktionen stellen daher auch eine Täuschung dar. Denn die Zerstörung und deren Gründe werden durch die erneute Existenz getilgt, unkenntlich gemacht. Dass für den Neubau eines historischen Gebäudes ein original historisches Gebäude weichen muss, führt zu einer Komplexität, der Rekonstruktionen nicht gerecht werden. Die Folge sind verzerrte Zeitschichten im Stadtraum. Nicht nur werden vielerorts Kirchen und Schlösser einer längst vergangenen Zeit wiederaufgebaut. Dort wo sie heute wieder auferstehen, sind zuvor Gebäude der DDR- oder bundesrepublikanischen Nachkriegsmoderne aus dem Stadtbild entfernt worden. Das Technische Rathaus musste der Neuen Frankfurter Altstadt weichen, das Institut für Lehrerbildung am Potsdamer Alten Markt wurde zugunsten des historisierenden Wohnquartiers abgerissen. Noch ist nicht klar, ob das DDR-Rechenzentrum, das von 200 Potsdamer Künstler*innen als Atelier- und Kunstzentrum genutzt wird, tatsächlich für die Rekonstruktion des Garnisonkirchenschiffs abgerissen wird, wie es eigentlich bereits beschlossen ist.
Und noch etwas haben all diese Bauten gemein: Jedes dieser Projekte wurde von Bürger*innen initiiert, die sich in Vereinen mit Namen wie „Mitteschön“ oder „Stadtbild Deutschland“ zusammentun und mit großem Durchsetzungsvermögen für historische Rekonstruktionen werben. Oft positionieren sich an ihrer Spitze prominente Personen, die öffentlichkeitswirksam Reklame machen und den Projekten mit Millionenspenden die Initialzündung geben. SAP-Mitbegründer Hasso Plattner knüpfte eine 20-Millionen-Euro Spende an die Bedingung, das Potsdamer Stadtschloss müsse originalgetreu rekonstruiert werden. Dafür, dass dieser Wiederaufbau überhaupt möglich wurde, sorgte Günther Jauch, indem er die Rekonstruktion des Schlossportals als überdimensionierte und Tatsachen schaffende Werbemaßnahme für die Rekonstruktion des Stadtschlosses finanzierte.
Im Falle des Berliner Schlosses sorgte hingegen erst eine Millionenspende der Otto-Versandhaus-Witwe Maren Otto für die Rekonstruktion des goldenen Kuppelkreuzes, das von der Schlossinitiative ursprünglich nicht einmal vorgesehen war. Das Kreuz, das nun das Weltkulturenmuseum Humboldt Forum krönt, trägt in seiner Inschrift die Aufforderung, „daß im Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Kniee, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind“, was erneut zu großer Kritik führte. Man sei auf die Namen angewiesen, räumte Boddien offen ein: „Viele Leute gaben mir die Prominenz ihres Namens, um Türen zu öffnen. Sie müssen sich auf jemanden berufen können, sonst wird’s schwierig.“ Ebendarin ist auch ein Mangel an Expertise erkennbar: Rekonstruktionsbefürworter*innen berufen sich meist auf Unternehmer*innen, Personen aus der Wirtschaft oder der Unterhaltungsindustrie, nicht aber auf eine Mehrheit der Denkmalpfleger*innen, Kunsthistoriker*innen, Architekt*innen oder Stadtplaner*innen, die diesen Initiativen häufig kritisch gegenüberstehen. Auch Wolf Jobst Siedler nahm auf diesen Umstand in seinem Text von 1992 Bezug, wendete ihn aber ins Demokratisch-Positive: Obwohl führende Intellektuelle sich gegen verschiedene Rekonstruktionen direkt nach 1945 aussprachen, sei „das Volk“ unverständig geblieben und habe „alle Ratschläge in den Wind“ geschlagen. Mehr noch habe „eine Bürgerbewegung, die Züge eines Volksaufstandes hatte“, gegen „alle Autoritäten“ die Wiederaufbauten durchgesetzt. Siedlers Rhetorik ist dabei im Wortsinne populistisch, indem es die Unterstützung eines stumm bleibenden, imaginierten „Volkes“ für sich in Anspruch nimmt.8 Tatsächlich aber wurden die Projekte der aktuellen Rekonstruktionswelle, allen voran das Berliner Schloss, nicht von einem Volksaufstand, sondern ganz im Gegenteil, von einem kleinen, konservativen und wohlhabenden Teil der Bevölkerung im Laufe von Jahren beständig durchgesetzt.
Barocke Kulisse einer heilen Geschichte
Dass mit dem Wiederaufbau des Schlosses an die preußische Tradition angeknüpft werden soll, wird von den Rekonstruktionsbefürworter*innen offen ausgesprochen. An die Zeit danach, insbesondere die der DDR, möchte man eher nicht anknüpfen. Stattdessen werden Gebäude aus der jüngsten und noch nicht gänzlich aufgearbeiteten deutschen Vergangenheit systematisch abgerissen und Stadtbilder zu einer barocken Kulisse einer heilen Geschichte Deutschlands umgearbeitet.
In den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg fiel die Skepsis gegenüber solch heilenden Rekonstruktionen noch größer aus. 1947 sprach sich etwa der Publizist und Mitbegründer der CDU, Walter Dirks, gegen die Rekonstruktion des Frankfurter Goethehauses aus, das zum Goethe-Jahr 1949 wiederaufgebaut werden sollte.[9] Ein vertrautes Gebäude, von dem man sich nicht trennen kann, wiederherzustellen, „ein solcher Gedanke kann etwas sehr Verführerisches haben“. Aber „das Haus am Hirschgraben ist nicht durch einen Bügeleisenbrand oder einen Blitzschlag oder durch Brandstiftung zerstört worden; es ist nicht ‚zufällig‘ zerstört worden, genauer gesagt: in einer Kausalkette, die keine Beziehung zu dem eigentümlichen Wesen dieses Hauses hätte und also ihm gegenüber äußerlich wäre. Sondern dieses Haus ist in einem geschichtlichen Ereignis zugrunde gegangen, das mit seinem Wesen sehr wohl etwas zu tun hat.“ Wenn das „Volk der Dichter und Denker“ nicht vom Geiste Goethes und dem Humanismus abgefallen wäre, dann stände das Haus am Hirschgraben heute noch unversehrt.
Dirks, der in den 1950er Jahren den „restaurativen Charakter der Gesellschaft“ kritisierte, betonte damals, dass „die Zerstörung dieses Hauses“ genauso zur deutschen Geistesgeschichte gehört wie dessen Errichtung und „wir dieses letzte Kapitel einer langen Geschichte, den Zusammenbruch, nicht wegwischen“, sondern nur anerkennen können. Diese Erkenntnis scheint heute ihre Plausibilität eingebüßt zu haben. Das Goethehaus wurde wiederaufgebaut, das Schloss ebenso.
Humboldt Forum: Verschlimmbesserung monumentalen Ausmaßes
Wie es um den Geschichtssinn der selbsterklärt Geschichtssinnigen tatsächlich steht, macht auch die Nutzung des neuen Schlosses klar. Im „Humboldt Forum“ werden die außereuropäischen Sammlungen der Stiftung Preußischer Kulturbesitz neu präsentiert. Was ursprünglich offenbar als Ausgleichskonzept zu den barocken Fassaden des preußischen Schlosses gedacht war, entpuppte sich spätestens 2017 als Verschlimmbesserung monumentalen Ausmaßes. Mit ihrem Rücktritt aus der Expertenkommission des Forums löste die Kunsthistorikerin Bénédicte Savoy eine nationale Debatte über den Umgang mit kolonialer Raubkunst aus. Ihre Entscheidung begründete sie mit der fehlenden Transparenz der Provenienz der Sammlungsobjekte, die aus der Zeit des Kolonialismus stammen.
Das imperiale Äußere, innen gefüllt mit imperialem Raubgut – kein schönes Bild, aber Folge einer nachträglichen und halbherzigen Kompensationsanstrengung. Für die Initiator*innen hatte das Innere des Schlosses ohnehin nie entscheidende Bedeutung. So war Siedler der Überzeugung, nur der Schlosskörper sei für das Stadtgefüge bedeutend, „die Nutzung dagegen fast zweitrangig“.[10] Und Boddien erzählt im Plauderton, der Architekt Franco Stella habe die Innenräume des Schlosses bewusst so konstruiert, dass von sechzig ehemaligen Prunkräumen problemlos fünfzig wieder eingesetzt werden können – wenn die Gesellschaft irgendwann dazu bereit sei. Eine Woche vor der digitalen Eröffnung im Dezember erneuerte die nigerianische Regierung ihre Restitutionsforderung für die Benin-Bronzen. Die Objekte, die im 16. Jahrhundert im Königreich Benin hergestellt wurden, sollen das „Highlight“ des Humboldt Forums werden. Im Zuge einer blutigen Strafexpedition der britischen Armee 1897 wurden Benin-Stadt zerstört und mehrere tausend Bronzen als Beute entwendet. Mehr als zweihundert von ihnen sind derzeit im Besitz des Humboldt Forums. Bénédicte Savoy erinnerte in der FAZ daran, dass die Forderung Nigerias nicht erst seit 2019 vorliegt, die Blamage zur Eröffnung des Forums hätte also leicht verhindert werden können, wäre schon früher angemessen reagiert worden.[11] Die postkoloniale Ignoranz reicht freilich bis 1972 zurück, wie Savoy berichtet, als Nigeria sich einige Bronzen als Dauerleihgabe erbat. Die Bitte wurde abgeschlagen. Jetzt seien „ein weiteres Spiel auf Zeit wie in den 70er Jahren und die Inszenierung des kulturellen Menschheitserbes zu nationalen Behauptungszwecken“ aber keine Option mehr.
Noch hat das Humboldt Forum auf die Anfrage der nigerianischen Regierung nicht reagiert. Tatsächlich steht es vor der gigantischen Herausforderung, in den nächsten Jahren mit dem Paradox umzugehen, das seine eigene Existenz darstellt. Bénédicte Savoy brachte es auf den Punkt: Es sei etwas entstanden, dessen Äußeres sage, man könne Geschichte rückgängig machen, dessen Inneres aber das Gegenteil behaupte: „‚Nein, wir können die Geschichte nicht rückgängig machen, wir können die Objekte nicht zurückgeben.‘“ Man kann es auch positiv formulieren: Das Verdienst des Humboldt Forums besteht darin, dass dieses Paradox nicht so einfach wieder vergessen werden kann. Es steht, Stein geworden, mitten in Berlin.
[1] Niklas Maak, Hurra, Hurra, wir bauen uns ein Schloss, www.faz.net, 3.10.2020.
[2] Jörg Häntzschel, Kaputte Zeitmaschine, www.sueddeutsche.de, 16.12.2020.
[3] Joachim Fest, Denkmal der Baugeschichte und verlorenen Mitte Berlins. Das Neue Berlin, Schloss oder Parkplatz? Plädoyer für den Wiederaufbau des Schlüterschen Stadtschlosses, www.faz.net, 3.11.1990.
[4] Wilhelm von Boddien im Interview mit dem „Tagesspiegel“, www.tagesspiegel.de, 1.2.1993.
[5] Vgl. Beate Binder, Streitfall Stadtmitte. Der Berliner Schloßplatz, Köln 2009.
[6] Wolf Jobst Siedler, „Das Schloss lag nicht in Berlin – Berlin war das Schloss“, www.berliner-schloss.de, 1992.
[7] Vgl. dazu Matthias Grünzig, Sehnsuchtsort der Neuen Rechten: Die Potsdamer Garnisonkirche, in: „Blätter“, 1/2018, S. 21-24.
[8] Vgl. Alexander Schug (Hg.), Palast der Republik: politischer Diskurs und private Erinnerung, Berlin 2007.
[9] Walter Dirks, Mut zum Abschied. Zur Wiederherstellung des Frankfurter Goethehauses, in: „Frankfurter Hefte“, 8/1947, S. 819-828.
[10] Wolf Jobst Siedler im Interview mit der „Welt“, www.welt.de, 5.8.2007.
[11] Bénédicte Savoy, Ein Fall von Verschleppung, www.faz.net, 15.12.2020.