Die Tyrannei der Leistung und die Politik der Demütigung
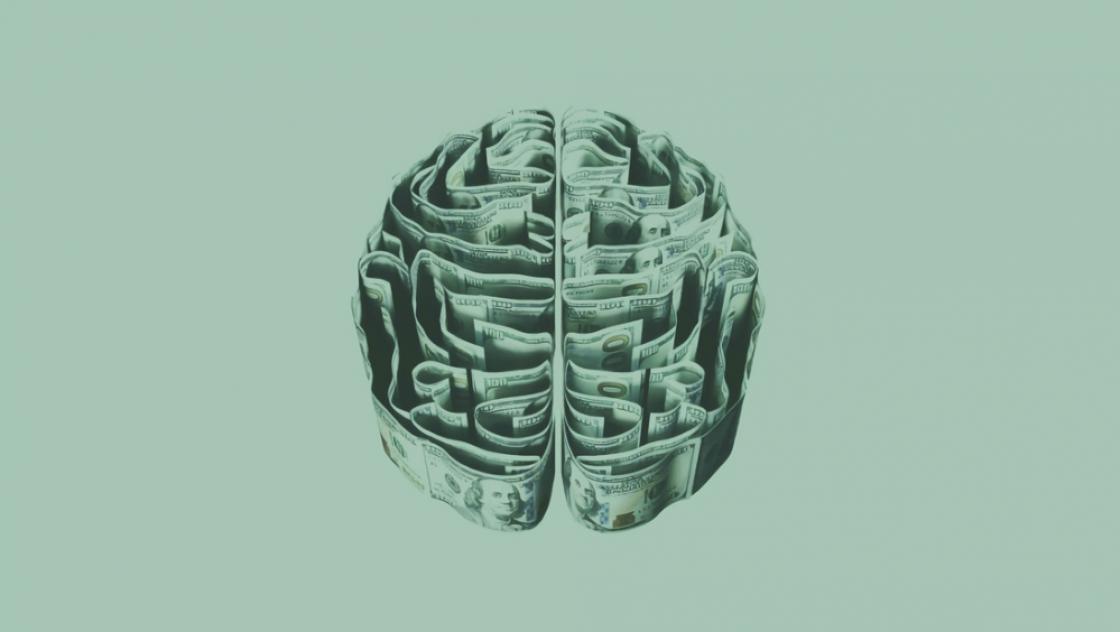
Bild: Morgan Housel / Unsplash
In den vergangenen vier Jahrzehnten haben meritokratische Annahmen ihren Zugriff auf das öffentliche Leben demokratischer Gesellschaften immer mehr verstärkt. Selbst als die Ungleichheit riesige Ausmaße erreichte, hat die kulturelle Öffentlichkeit die Vorstellung verschärft, dass wir für unser Schicksal selbst verantwortlich sind und verdienen, was wir bekommen. Es sieht fast so aus, als hätten es die Globalisierungsgewinner nötig, sich selbst und alle anderen davon zu überzeugen, dass diejenigen, die oben stehen, ebenso wie diejenigen, die unten sitzen, dort gelandet sind, wo sie hingehören. Damit sehen wir Erfolg in einer Weise, wie die Puritaner Erlösung betrachteten – nicht als etwas, das von Glück oder Gnade abhängig ist, sondern als etwas, das wir uns durch eigene Anstrengung und Mühe verdienen. Das ist der Kern der meritokratischen Ethik. Sie rühmt die Freiheit – die Fähigkeit, mein Schicksal vermöge harter Arbeit zu steuern – und die Verdienste. Wenn ich dafür verantwortlich bin, dass ich einen hübschen Anteil weltlicher Güter angehäuft habe – Einkommen und Vermögen, Macht und Prestige –, dann muss ich mir das verdient haben. Erfolg ist ein Zeichen der Tugend. Mein Wohlstand steht mir zu.
Diese Denkungsart gibt einem Kraft. Sie ermutigt die Menschen, sich selbst als verantwortlich für ihr Schicksal anzusehen – und nicht als Opfer von Kräften außerhalb ihrer Kontrolle. Doch sie hat auch eine Kehrseite.









