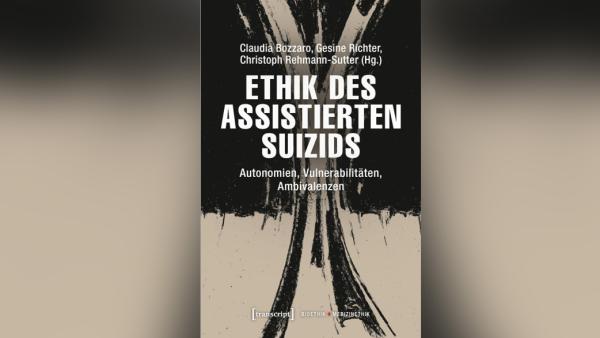Bild: Chester Doles, ein langjähriger Anführer der weißen Nationalisten, führt einen Marsch zu Ehren von Präsident Trump in Dahlonega, Georgia an - 14. September 2019 (imago images / ZUMA Wire)
Als Donald Trump im Jahr 2016 die Präsidentschaftswahl gewann – nicht aber die Mehrheit der Wählerstimmen –, schien die „New York Times“ gar nicht genügend Artikel zu der Frage veröffentlichen zu können, was Trump-Anhänger fühlten und dachten. Sie wurden in diesen Beiträgen als eine exotische Spezies und zugleich als Menschen dargestellt, die zu verstehen wir uns bemühen sollten – verstehen im Sinne sowohl des intellektuellen Begreifens als auch einer gewissen Akzeptanz. Nachdem Trump die Wahl 2020 nun verloren hat, überließ die „Los Angeles Times“ ihre komplette Leserbriefseite Trump-Wählern. Und die hatten genau die vorhersehbaren Dinge zu sagen, die wir seit weit mehr als vier Jahren hören – dank der „New York Times“ und wohl rund 11 000 anderen Nachrichtenmedien, die jedem White Supremacist an den Lippen hängen, den sie zu einer Äußerung bewegen können.
Der zuständige Redakteur kommentierte besagte Leserbriefseite wie folgt: „Zu keiner Zeit während der zehn Jahre, die ich diese Seite nun betreue, standen sich Leserinnen und Leser mit widerstreitenden Meinungen derart unversöhnlich gegenüber wie heute, so als bezögen sie ihre Werte und Fakten aus unterschiedlichen Universen. Als kleinen Beitrag zu dem Versuch, diese Kluft zu überbrücken, veröffentlichen wir heute eine ganze Seite mit Briefen von Trump-Anhängern.“ Impliziert wird hier wie üblich: Wir – das urbane, multi-ethnische, liberal-bis-radikale, nur-teilweise-christliche Amerika – müssen mehr Zeit investieren, um das „Make America great again“-Amerika zu verstehen. Aus der anderen Richtung wird diese Forderung nicht erhoben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass „Fox News“, Ted Cruz und „The Federalist“ ihr Publikum nicht mit erhobenem Zeigefinger drängen, sagen wir, mit Black-Lives-Matter-Aktivist*innen, Rabbis, Imamen, Abtreibungsärzt*innen, Universitätsabsolvent*innen ohne Papiere oder lesbischen Lehrstuhlinhaberinnen in Diskurs zu treten. Wenn nur die eine Seite den Auftrag hat, Frieden zu schließen, kann es nicht zu einem Frieden kommen, sondern nur zu einer einseitigen Kapitulation. Uns wird nahegelegt, diese Haltung als Überparteilichkeit aufzufassen, aber dies würde implizieren, dass beide Seiten sich über ihre Parteilichkeit hinwegsetzen, und daran haben Mitch McConnell – der republikanische Mehrheitsführer im Senat – & Co. nicht das geringste Interesse.
Das Gefühl, nicht respektiert zu werden
Paul Waldmann hat vor ein paar Jahren in einer beachtenswerten Kolumne in der „Washington Post“ darauf hingewiesen, dass diese Diskrepanz rechten Akteuren in die Hände spielt: „Es ist gängige Annahme, dass die Demokraten nur das mächtige Mittel des Respekts einsetzen müssten, und schon würden Meinungen geändert und Wählerstimmen gewonnen. Diese Überzeugung, mag sie noch so weit verbreitet sein, ist erschreckend naiv.“ Das Gefühl, nicht respektiert zu werden, merkt er an, „wird nicht durch die politische Agenda der Demokraten erzeugt und ebenso wenig durch das, was demokratische Politiker sagen. Woher also kommt es? Eine komplette Industrie widmet sich der Aufgabe, Weißen einzureden, dass liberale Eliten auf sie herabblicken. Die Rechte verfügt über einen gigantischen Medienapparat, der damit befasst ist, den Leuten einzureden, man respektiere sie nicht, und über eine Partei, deren Entscheidungsträger allesamt verstanden haben, dass diese Vorstellung von zentraler Bedeutung für ihr politisches Projekt ist, und deshalb bei jeder Gelegenheit in den Chor einstimmen.“
Oft wird auch eine Art Pakt mit dem Teufel geschlossen, der beinhaltet, dass man jenen Weißen, die meinen, das Land gehöre ihnen, schmeichelt und sie – ja genau: – respektiert, indem man andere Leute über die Klinge springen lässt, indem man also etwa Immigrant*innen, queere Menschen, Feminist*innen und ihre Rechte und Ansichten nicht respektiert. Wenn man besagter weißer Klientel derart entgegenkommt, bestärkt man sie in ihrer Überzeugung, wichtiger zu sein als andere Menschen, und so ziemlich alle Probleme, die wir in den vergangenen vier Jahren hatten, von den zurückliegenden fünfhundert ganz zu schweigen, wurzeln in dieser Überzeugung – der Vorstellung, Weiße zählten mehr als Nicht-Weiße, Christ*innen mehr als Nicht-Christ*innen, Einheimische mehr als Eingewanderte, Männer mehr als Frauen, Heteros mehr als Queers, Cis-Sexuelle mehr als Transmenschen.
Samuel Alito, Richter am Obersten Gerichtshof, hat sich kürzlich beklagt: „Man darf ja nicht mehr sagen, die Ehe sei eine Verbindung zwischen einem Mann und einer Frau. Das gilt heute als bigott.“ Es ist die übliche Klage der Rechten: Das eigentliche Opfer sei der Rassist, der als Rassist bezeichnet wird, nicht etwa das Opfer seines Rassismus; die eigentliche Unterdrückung bestehe darin, dass man in seiner Freiheit, andere zu unterdrücken, eingeschränkt wird. Und natürlich ist Alito unaufrichtig: Man darf sehr wohl etwas gegen die Anerkennung der gleichgeschlechtlichen Ehe sagen (er hat es getan). Und dann dürfen andere Menschen einen als bigott bezeichnen, weil sie ebenfalls eine Meinung haben wie auch äußern dürfen. Doch in seiner festgefügten Weltsicht ist diese Art abweichender Meinung nicht hinnehmbar – was lustig ist, wenn man bedenkt, dass er einer Partei angehört, deren Anhänger*innen auf Wahlveranstaltungen T-Shirts mit der Aufschrift „fuck your feelings“ („scheiß auf deine Gefühle“) trugen und den Begriff „snowflake“[1] populär machten. Und doch herrscht diese hoffnungslos naive Form von politischem Zentrismus vor, die Annahme, wenn wir nur nett genug zu der anderen Seite seien, gebe es bald keine andere Seite mehr, sondern wir würden alle zu einer großen, glücklichen Familie. Diese dümmliche Haltung wird auch gegenüber Fragen des Glaubens sowie Tatsachen und Prinzipien eingenommen: Man begegnet allem mit einer krausen Mischung aus moralischer Relativierung und dem therapeutenhaften „jedes Gefühl hat seine Berechtigung“. Aber die Wahrheit ist kein Kompromiss irgendwo in der Mitte zwischen Wahrheit und Lüge, zwischen Fakt und Illusion, zwischen Wissenschaft und Propaganda. Und ethisches Verhalten ergibt sich nicht als Mittelweg zwischen White Supremacists und Menschenrechtsaktivist*innen, Synagogen-Attentätern und jüdischen Menschen, Fremdenhasser*innen und Immigrant*innen, wahnhaften Transphoben und Transmenschen. Wer zum Teufel will Eintracht mit Nazis, es sei denn, sie hören auf, Nazis zu sein?
Wir sollten damit aufhören, die andere Seite versöhnlich stimmen zu wollen
Meiner Ansicht nach hat unsere Seite – man verzeihe mir die anhaltende Vereinfachung und binäre Logik – allen etwas zu bieten, und wir können und müssen es auch ganz konkret anbieten, um auf lange Sicht die Oberhand zu gewinnen, und zwar mittels besserer Narrative und einer besseren Verbreitung dieser Narrative, damit sie wirklich alle erreichen.
Wir wollen, dass jede*r von der eigenen Arbeit leben kann und Zugang zu medizinischer Versorgung hat und dass sich Gesundheits-, Studien- oder Wohnkosten bei niemandem zu einer riesigen Schuldenlast auftürmen. Wir wollen, dass unser Planet in guter Verfassung ist, wenn die diesjährigen Neugeborenen im Jahr 2100 achtzig Jahre alt werden.
Die uns nahegelegte Kompromissbereitschaft würde jedoch bedeuten, dass wir unsere Narrative verwässern oder ganz aufgeben, statt sie zu stärken und verbessern (und Wege zu finden, sie dem Rest der amerikanischen Bevölkerung nahezubringen, statt dass sie verzerrt oder abgeblockt werden). Ich habe einen Großteil meinen Erwachsenenlebens damit verbracht, Politikern wie Bill Clinton und manchmal auch Barack Obama dabei zuzusehen, wie sie die Werte ihrer Seite verrieten, um die andere Seite versöhnlich zu stimmen – mit erbärmlichen Resultaten. Und ich kann nur hoffen, dass sich die Zeiten hinlänglich geändert haben und Joe Biden es ihnen nicht nachtun wird.
Ein weiteres Problem bei dem Kommentar des Leserbriefredakteurs der „LA Times“, der von Fakten und Werten spricht, besteht darin, dass die eine Seite mit jeder Menge Aussagen aufwartet, die es nicht verdienen, als Fakten bezeichnet zu werden, und dass ihre Werte es nur allzu oft rechtfertigen, vielen von uns auf der anderen Seite zu schaden. Um nicht nur das eine Nachrichtenmedium zu kritisieren: Mitte November war auf der Titelseite der „Washington Post“ in einem Artikel über den #millionMAGAmarch, die Demonstration der Trump-Anhänger in Washington, zu lesen: „In aller Krassheit trafen in der Bundeshauptstadt zwei unversöhnliche Versionen von Amerika aufeinander, die sich weigerten, zu akzeptieren, was die jeweils andere Seite als unbestreitbare Tatsache betrachtete.“ Nur hatte die eine Seite eben wirklich Tatsachen zu bieten, insbesondere die, dass Donald J. Trump die Wahl verloren hat, die andere Seite hingegen verbreitete wilde Phantasien.
Das Problem ist die Appeasement-Ökonomie, in der wir leben
Ich begreife, dass der Klimawandel für viele Menschen keine Realität ist. Aber ist wirklich etwas gewonnen, wenn ich ein weiteres Mal denen zuhöre, die sich weigern, der Wissenschaftsgemeinde zuzuhören und die Belege zur Kenntnis zu nehmen, die wir täglich vor Augen haben? Dass die Rechte den Klimawandel nicht „versteht“, hat viel damit zu tun, dass am Klimawandel eines sich ganz klar zeigt: Alles ist miteinander verbunden, alles, was wir tun, hat weitreichende Folgen, und deshalb sind wir für das Ganze verantwortlich – eine Botschaft, die im Widerspruch zur rechten Idealisierung einer Art von Freiheit steht, die sehr nach Unverbundenheit und Unverantwortlichkeit riecht. Aber die Leugnung des Klimawandels ist auch ein Ergebnis davon, dass Öl- und Gasgesellschaften und die von ihnen gekauften Politiker*innen aus Profitgier Propaganda und Lügen verbreiten – und das verstehe ich besser als die Menschen, die das alles glauben.
Wenn die Hälfte von uns glaubt, die Erde sei eine Scheibe, schaffen wir keinen Frieden, indem wir uns darauf einigen, dass sie ein Mittelding zwischen einer Scheibe und einer Kugel ist. Diejenigen von uns, die wissen, dass die Erde rund ist, werden die anderen nicht durch einen Kompromiss gewinnen. Wir wissen alle, dass man Menschen durch eine freundliche, einladende Haltung eher aus ihrem Wahn befreit als durch Spott, aber das bedeutet, sie auf unsere Seite einzuladen, nicht sich in ihre Richtung zu bewegen.
Der Leserbriefredakteur schrieb von Fakten und von Werten. In den vergangenen vier Jahren sind zu viele Rechte dazu ermuntert worden, ihre Werte in Gewalt umzumünzen. Auf einem der T-Shirts bei dem #millionMAGAmarch stand: „Pinochet hat nichts falsch gemacht“ – außer dass er einen Putsch durchführte, tausende Chilen*innen folterte und verschwinden ließ, Gesetze und Rechte missachtete. Kürzlich wurde eine Verschwörung von Rechtsextremisten aufgedeckt, deren Ziel es war, die Regierung von Michigan zu stürzen und die Gouverneurin Gretchen Whitmer zu entführen. Und im vergangenen Sommer haben Rassisten bei verschiedenen Black-Lives-Matter-Demonstrationen Menschen erschossen und ihre Autos in die Menge gesteuert. Das gegen Immigranten gerichtete Massaker in El Paso ist erst gut ein Jahr her, der Anschlag auf die Synagoge in Pittsburgh rund zwei Jahre, die rechtsextreme Demonstration in Charlottesville, bei der Heather Heyer umgebracht wurde, drei Jahre (und natürlich hat es in dieser Zeit unzählige kleinere Vorfälle gegeben). Müssen wir die Kluft zwischen Nazis und Nicht-Nazis überbrücken? Ein Teil des Problems besteht darin, dass wir in einer Appeasement-Ökonomie leben, einem System, dessen reibungsloses Funktionieren dadurch gewährleistet werden soll, dass wir nett zueinander sind.
Die Beschwichtigungspolitik hat in den 1930ern nicht funktioniert, und sie wird auch jetzt nicht funktionieren. Das heißt nicht, dass man wütend oder feindselig sein oder selbst Hass verbreiten muss, doch es bedeutet sehr wohl, dass man an seinen Prinzipien festhalten und das, was angegriffen wird, verteidigen sollte. In manchen Situationen findet sich keine gemeinsame Basis, schon gar keine, auf der man aufbauen könnte. Wollten Nazis auf uns zugehen, Gemeinsamkeiten finden, uns verstehen, dann hätten sie vermutlich keinen Fackelzug veranstaltet, bei dem Scharen weißer Männer brüllten „Jews will not replace us!“ („Wir lassen uns nicht gegen Juden austauschen“), außerdem wären sie dann schlicht keine Nazis. Nazi, White Supremacist, Frauenhasser, Transphober zu sein heißt, eine Haltung zu vertreten, bei der die Weigerung, jemanden verstehen zu wollen, Ausdruck der grundlegenden Weigerung ist, ihn oder sie zu respektieren. Es ist eine Minderheitsposition, aber indem wir sie gelten lassen, geben wir ihr wieder und wieder die Macht einer Mehrheitsposition.
Nachgiebigkeit gegenüber Intoleranz nährt die Intoleranz
Tatsächlich hat sich die gesamte republikanische Partei schon lange vor Trump dem undemokratischen Projekt verschrieben, die Wählerschaft zu verkleinern, statt zusätzliche Stimmen zu gewinnen. Die Republikaner haben die Wahlbehinderung bzw. -vereitelung zu ihrer zentralen Wahlstrategie gemacht, und es sind vornehmlich die Schwarzen und andere People of Color, deren Stimmabgabe verhindert werden soll. Mit absoluter Skrupellosigkeit werden diesen Bürger*innen so ihre verbürgten Rechte verweigert. Nachdem es bei der letzten Wahl nicht gelungen ist, genügend Schwarze vom Wählen abzuhalten, wird jetzt mit aller Macht versucht, die Stimmen nachträglich zu verwerfen. Was tut man mit Menschen, die glauben, sie seien mehr wert als andere Menschen? Auf sie einzugehen, bestärkt sie in ihrem Glauben, sie seien wesentlich für das Leben in unserem Land, sie seien wichtiger als andere, und ihre Ansichten hätten vorzuherrschen. Nachgiebigkeit gegenüber Intoleranz nährt die Intoleranz.
Vor Jahren schrieb der Linguist George Lakoff, die US-Demokraten würden gegenüber der Bürgerschaft wie freundlich fördernde, zugewandte Mütter agieren, die Republikaner dagegen wie strenge, disziplinierende Väter. Das Verhältnis zwischen den beiden Parteien allerdings gleicht der Ehe zwischen einer zu nachgiebigen Frau und einem herrischen Mann, der seine Macht oft missbraucht (man denke nur daran, wie die letzten beiden frei gewordenen Richterposten am Supreme Court besetzt wurden und warum Merrick Garland scheiterte). In „The Hill“ erschien am 13. November die Schlagzeile: „Nominierung von Warren würde Republikaner laut GOP-Senatoren spalten.“ Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Zeitung nie eine Schlagzeile gebracht hat, die etwa lautete: „Nominierung von Pompeo (oder Bolton oder Purdue oder Sessions) würde demokratischen Senatoren zufolge Demokraten spalten.“ Ich bin zu einer Zeit aufgewachsen, als man von Frauen, die geschlagen wurden, erwartete, mehr zur Besänftigung ihrer Männer zu tun und sie nicht herauszufordern, und diese Haltung lebt in der entwürdigenden politischen Praxis unserer von Machtmissbrauch gekennzeichneten nationalen Ehe fort.
Es gibt Menschen, die nicht zu siegen wissen. Andere können nicht glauben, dass sie verloren haben oder jemals verlieren werden oder verlieren könnten, und ihre Uneinsichtigkeit stellt eine gewisse Bedrohung dar. Deshalb wird den Gewinner*innen der letzten Wahl in vielfältiger Weise nahegelegt, sie müssten vor den Verlierer*innen katzbuckeln. Es herrscht die Vorstellung, man müsse bestimmten Leuten schmeicheln und sie mit Samthandschuhen anfassen – obwohl sie doch genau denen Schaden zufügen, die ihnen schmeicheln und sie mit Samthandschuhen anfassen sollen, obwohl sie eine Minderheit sind, obwohl sie Gesetze brechen oder die Wahl verloren haben.
Durch diese Form der einseitigen Kapitulation werden Frauenhass und Rassismus nicht nur in rechte, sondern auch in viele liberale und zentristische Positionen eingebrannt. Lakoff ist nicht so weit gediehen zu sagen, dass dieses Land einem Haushalt gleicht, in dem das ausgeübt wird, was Anwälte, die sich mit häuslicher Gewalt befassen, als coercive control bezeichnen, durch Zwang ausgeübte Kontrolle: der eine Partner – gemeinhin der Mann – kontrolliert den anderen Partner – gemeinhin die Frau – durch Drohungen, Einschüchterungen, Abwertung und schieres Niederbrüllen.
Jetzt ist die richtige Zeit, um auf unseren Prinzipien zu bestehen
So sahen Ehen vor den Zeiten des Feminismus oft aus, und von der misshandelten Frau wurde erwartet, dass sie ihren zornigen Mann besänftigte und beruhigte. Der Feminismus ist in jeder Hinsicht nützlich, und in diesem Fall hat er ein gutes Beispiel dafür zu bieten, dass diese Art von Beziehungsgestaltung zugleich ungeheuerlich und zum Scheitern verdammt ist. Sie hat in der Ehe nie funktioniert, und es war und ist nicht die Verantwortung der Misshandelten, ihre Misshandlung zu verhindern, nicht ihre Aufgabe, sich zurückzunehmen und ihre Rechte wie auch ihre Stimme preiszugeben. In der nationalen Politik funktioniert diese Art von Beziehung genauso wenig. Jetzt ist die richtige Zeit, um auf unsere Prinzipien zu bestehen und das zu verteidigen, was uns wichtig ist, und ich glaube auch, dass das eine durchaus erfolgversprechende Strategie ist, zumindest eine, die uns dem Erfolg näherbringt, als es die Kapitulation täte. Abgesehen davon – das darf ruhig noch einmal wiederholt werden – haben wir gesiegt, und großmütig im Sieg zu sein heißt dennoch siegreich sein.
Postscriptum: In diesem Essay habe ich den Begriff Nazi sowohl im wörtlichen als auch im übertragenen Sinne verwendet, also für Menschen mit durch und durch verwerflichen Ansichten. Es gibt echte Nazis in den Vereinigten Staaten, womit ich White Supremacists meine, die Hakenkreuzfahnen schwenken und sich mittels Tattoos, Abzeichen, einschlägigem Gruß und sonstigen Symbolen des Dritten Reichs identifizieren; Menschen, die extrem rassistisch, antisemitisch und gewaltverherrlichend sind und diese Gewalt selbst wieder und wieder ausüben, in verstärktem Maße seit dem Jahr 2017. Natürlich sind nicht alle Trump-Anhänger und nicht alle Rechten in den USA Nazis, wohl aber haben Trump selbst, seine Anhänger und die amerikanische Rechte nur allzu oft die Wirkmacht solcher Extremisten gutgeheißen, entschuldigt oder geleugnet. Viele Moderate und Vertreter*innen der politischen Mitte wiederum spielen die Existenz solcher Extremisten herunter, und nach der Erstveröffentlichung dieses Textes bin ich Menschen begegnet, die sich weit mehr über die Tatsache aufregten, dass ich Andere als Nazi bezeichne, als über die echten Nazis, Möchtegern-Nazis oder Neonazis selbst.
Und von wegen Neonazis: In den amerikanischen Medien bin ich am 21. November 2020, zwei Tage nach Veröffentlichung dieses Textes in den USA, auf einen Bericht über Neonazis gestoßen, als im „Idaho Statesman“ die Festnahme dreier Männer wegen Verstößen gegen das Waffengesetz gemeldet wurde. Einer von ihnen „war angeblich in einem mittlerweile stillgelegten Neonazi-Forum namens Iron March [„Eiserner Marsch“] aktiv. Laut Staatsanwaltschaft wird ihm neben Verstößen gegen das Waffengesetz auch vorgeworfen, Mitglieder für eine Gruppe angeworben zu haben, die er als ‚moderne SS‘ in den USA bezeichnete.“ Sie wurden in Waldgebieten in Idaho ausgebildet, und die Zeitung berichtet weiter: „Der Staatsanwaltschaft zufolge drehte die Gruppe ein Video von sich beim Schießtraining mit Sturmgewehren und Gewehren mit verkürztem Lauf. Am Ende des Videos sieht man die vier Männer den Hitlergruß entbieten, sie tragen Totenkopfmasken im Stil der Atomwaffen Division, einer terroristischen Nazi-Organisation, die mit etlichen Morden in den USA in Verbindung gebracht wird.“ Insofern: ja, Nazis. Die Dichterin Maya Angelou hat einmal gesagt: „Wenn Menschen dir zeigen, wer sie sind, glaub ihnen gleich beim ersten Mal.“
Deutsche Erstveröffentlichung eines Beitrages, der unter dem Titel „On Not Meeting Nazis Halfway“ zuerst in „Literary Hub“ (www.lithub.com) erschienen ist. Die Übersetzung aus dem Englischen stammt von Kathrin Razum.
[1] Zu Deutsch etwa: Mimose; ein pejorativer Begriff, den die radikale US-Rechte gegenüber Liberalen und Feminist*innen nutzt, besonders in Fragen der Political Correctness. – D. Red.