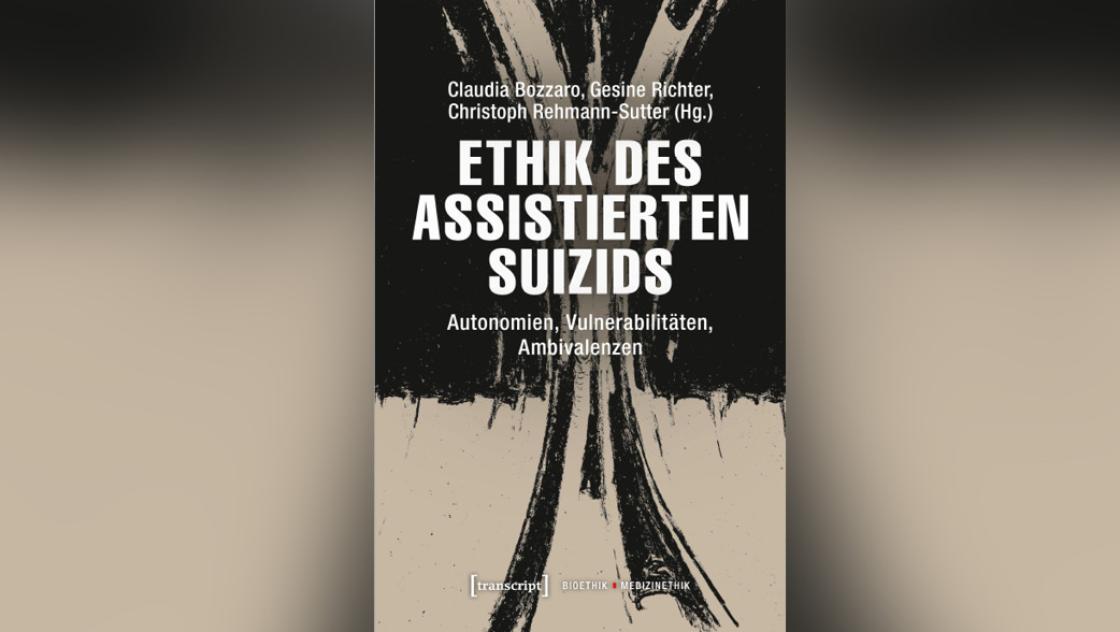
Bild: Claudia Bozzaro / Gesine Richter / Christoph Rehmann-Sutter (Hg.), Ethik des assistierten Suizids, Cover: transcript Verlag
„Er war so lange krank. Er hat all die Therapien mitgemacht, weil sie ihn überredet haben. Sein Sterben soll anders sein als seine Krankheit.“ Mit diesen Worten beschreibt Beate Winkler die Situation eines 19-jährigen, schwer an Krebs erkrankten jungen Mannes. Die Onkologin und Kinderärztin einer Hamburger Klinik hat ständig mit der Diagnose Krebs zu tun: Sie kennt den Kreislauf von Chemo- und Strahlentherapie und wieder Krankenhaus und weiß, dass viele das nicht mehr wollen. Sie wollen zuhause sterben – wie der 19-Jährige. „Es soll schnell sein und unter seiner Kontrolle. Er möchte selbst entscheiden, wann, wie und wo er stirbt und wer bei ihm ist.“
Die Ärztin hat den Fall ein wenig verändert, die Gedanken sind zum Teil fiktiv, räumt sie in ihrem Artikel ein. Der Wunsch, nicht bis zum „bitteren Ende“ durchhalten zu müssen, ist es nicht. Von Sterbewilligen werde häufig Unterstützung und Enttabuisierung beim Thema Suizid gewünscht. „Unsere Patient:innen werden es uns danken, wenn wir nicht die Ohren vor ihren Gedanken verschließen“, ist sie überzeugt, „und ihnen, wenn nötig, auch im Prozess eines assistierten Suizids zur Seite stehen.“
Diesem klaren Plädoyer für eine Liberalisierung der Sterbehilfe stehen immer wieder mahnende Worte gegenüber.









