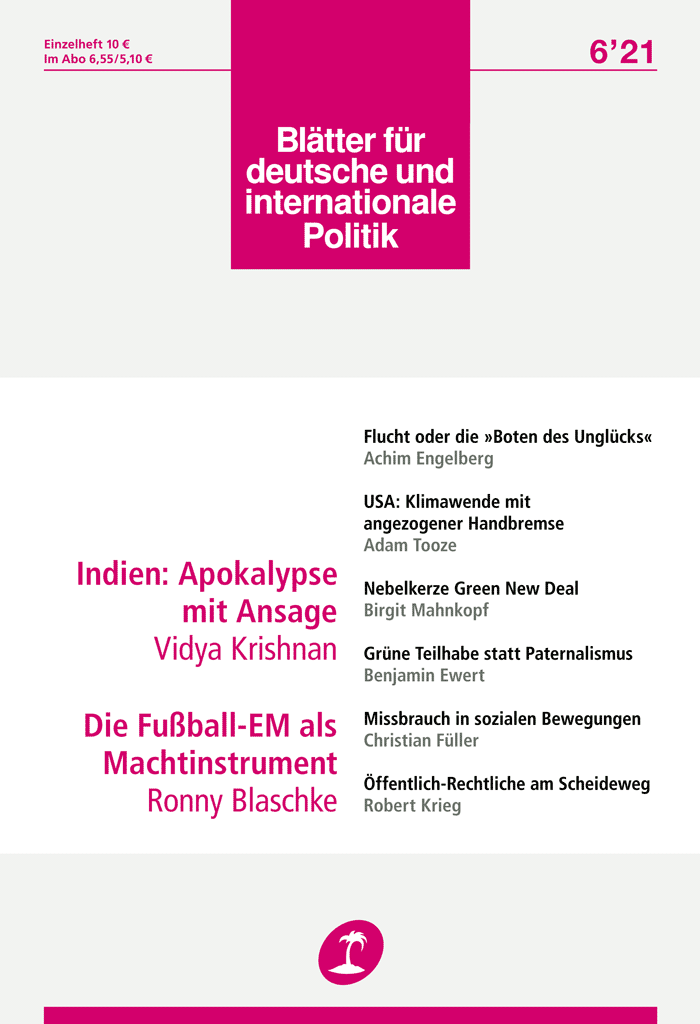Bild: Eine Demonstrantin während einer Demonstration in Istanbul gegen den Austritt der Türkei aus der Istanbul-Konvention, 20. März 2021 (IMAGO / ZUMA Wire)
Niemand verkörperte das Erdoğan-Regime zuletzt besser als der Imam der Hagia Sophia, der nach ihrer Umwandlung in eine Moschee Ende Juli vergangenen Jahres frisch ernannt worden war. Der Theologie-Professor Mehmet Boynukalın zeigte sich modern und twitterte gern – bis zu seiner unfreiwilligen Kündigung Anfang April. Am 8. März, dem Weltfrauentag, schrieb er etwa, das „Gerede“ über Frauenmorde sei nichts anderes als ein propagandistischer Slogan, um Frauen gegen Männer aufzuhetzen. Am selben Tag hatte die „Plattform für die Verhinderung der Frauenmorde“ in Istanbul darauf aufmerksam gemacht, dass 2020 im ganzen Land 300 Frauen ermordet und 171 Todesfälle als verdächtig eingestuft wurden.[1] „Die Religion des Staates ist der Islam“, schrieb der Imam zudem. „Der Laizismus gehört aus der Verfassung gestrichen.“ Das Fass zum Überlaufen brachten jedoch seine Bemerkungen über das im Zuge der Pandemiebekämpfung verhängte Verkaufsverbot für Alkohol während des dreiwöchigen Ramadan-Lockdowns. „Ihr werdet wohl nicht umkommen, wenn ihr ein paar Wochen nichts trinkt“, bemerkte der Imam trocken und behandelte Erdoğan-Kritiker wie üblich als Alkoholiker. „Dein Gehalt wird mit unseren Alkohol-Steuern finanziert!“, empörten sich daraufhin viele – immerhin fast drei Mrd. US-Dollar nahm der türkische Staat 2020 mit diesen Steuern ein. Der Imam antwortete: „Ich habe von meinem Anteil bereits erstklassiges Leichentuch für euch gekauft.“ Die Empörung schlug so hohe Wellen, dass Boynukalın die derzeit wichtigste „Moschee“ des Landes verlassen musste.
Geld, Gebete und Connections
Dennoch lässt sich an seiner Person die jüngere Geschichte des türkischen Islamismus erzählen. Sein Vater Rifat begründete mit dem 2011 verstorbenen Necmettin Erbakan die islamistische Millî-Görüş-Bewegung, die auch in Europa gut organisiert ist. Nach dem Militärputsch 1980 wanderte er nach Saudi-Arabien aus, wo Mehmet Boynukalın aufwuchs, bis er später die Al-Azhar-Universität in Kairo besuchte. Zusammen mit seinem Bruder, der in Saudi-Arabien Theologie studierte, gründete er später eine Lebensmittelfirma, die wegen ihrer lukrativen Geschäfte mit den Saudis für Aufsehen sorgte. Ein Neffe des späteren Hagia-Sophia-Imams wurde erst zum Vorsitzenden der AKP-Jugendorganisation und dann zum Abgeordneten gewählt. Ebendiese diffuse Vermengung von Religion, Politik und Wirtschaft prägt heute das Regime des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan. In ihm zählen Geld, Gebete und gute Connections. Und die Formel geht auf.
Unter Erdoğan entwickelt sich die Türkei mehr und mehr in Richtung eines theokratischen Staates, in dem manche mehr verdienen als andere. Dahinter versteckt sich allerdings ein großes Netzwerk, das seit Gründung der säkularen Republik 1923 durch Fleißarbeit nach und nach aufgebaut wurde. Anatolische Sekten sind darin genauso vertreten wie städtische, anti-säkulare Intellektuelle. Sie alle haben in Erdoğan – nachdem dieser sich von der Millî-Görüş-Bewegung gelöst und die AKP gegründet hatte – ihren „Führer“ gefunden, den sie respektvoll „Reis“ nennen.[2]
Erdoğan genießt dabei nach wie vor das Image eines gläubigen Underdogs, der jahrzehntelang durch „säkulare, verwestlichte Eliten“ unterjocht und schließlich durch Gottes Hand zur Stimme des Volkes erhoben wurde. Die Klassenfrage vermischt sich hier mit Religion und Politik: Zwar nahm in der Türkei die Religiosität bei den städtischen, modernen Bevölkerungsschichten seit den 1930er Jahren stetig ab. Den anatolischen Zuwanderern in den Städten und auf dem Land fehlte hingegen in jeder Hinsicht das Kapital, um an dem „westlichen“, freiheitlichen Lebensstil teilzuhaben. So erzeugte die Landflucht ab 1950 ein verarmtes städtisches Proletariat, das aufgrund der geringen Industrialisierung des Landes oft in die Selbstständigkeit flüchtete. Kleine Familienbetriebe und Handel gediehen an den Peripherien der Großstädte, die mit der Zeit zu Mega-Citys heranwuchsen. Vor allem nach 1980 gelang es vielen dieser anatolischen Geschäftsleute, innerhalb des wirtschaftsliberalen türkischen Systems eigene ökonomische, politische und kulturelle Netzwerke aufzubauen und dadurch aufzusteigen. Vor allem diejenigen unter ihnen, die sich von den westlich-liberal orientierten Bürgern verachtet fühlen, fanden ihre politische Heimat bei Erdoğan.
Der Islamismus des Osmanischen Reiches ging dabei über in eine neue Bewegung, die aus der verteufelten „kemalistischen Republik“ einen theokratischen Staat formen will. Doch anders als früher erscheint das Ziel eines islamischen Staates heute zum Greifen nahe. Und dieser bedeutet nicht nur die Aufwertung des kulturellen Kapitals der aufstrebenden neuen Schichten; er ist für sie auch als juristischer Garant ihres neuen Reichtums erstrebenswert.
Die Frauenfrage als Ankerpunkt der islamistischen Weltsicht
Die Frauenfrage bildet dabei nicht nur einen unübersehbaren Konfliktstoff, sondern einen der wichtigsten Ankerpunkte der islamistischen Weltsicht. Dass Erdoğan über Nacht die Istanbul-Konvention[3] zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen aussetzte, war nur ein weiterer Warnschuss. Die türkische Frauenbewegung weiß, womit sie es zu tun hat. Und trotz der durch die Coronapandemie legitimierten Demonstrationsverbote existiert im Land eine rege feministische Szene. Vor allem die gut gebildeten jungen Frauen in den Großstädten verfolgen auch die internationalen Debatten. So kommt es, dass Feministinnen und LGBT-Aktivisten in der Türkei heftig über Terfs (trans-exclusionary radical feminists – also Transpersonen ausschließende radikale Feministinnen) in ihren Reihen diskutieren, derweil die AKP versucht, getrennte städtische Busse für Frauen und Männer einzuführen. Doch auch die Umweltbewegung, wirtschaftsliberale Netzwerke, Akademikerinnen und Gewerkschaften kämpfen weiter gegen die komplette Übernahme des Landes durch die AKP. Die Bürgergesellschaft wehrt sich zweifellos gegen jede Verordnung vom Palast und gegen jede Praxis, die in die Richtung eines theokratischen Staates geht. Aber mit welchem Erfolg?
Zwar stößt jede Maßnahme auf Gegenwehr, da in der Türkei die Transformation hin zu einem islamischen Staat – im Gegensatz zum Iran von 1979 – in einem mittlerweile stark modernisierten Land nur schleichend und ohne eine „Revolution“ vonstatten geht. Doch das Parlament ist weitgehend entmachtet und Erdoğan bestimmt per meist nächtlichem Dekret den Lauf der Dinge. Auch die Zivilgesellschaft ist, wenn überhaupt noch, in kleinen Vereinen und Grüppchen organisiert und kämpft – wegen des immensen polizeilichen Drucks auf der Straße – vor allem in sozialen Medien und auf Plattformen wie YouTube weiter. Rechtsanwälte geben montags die Prozesstermine bekannt, wo zu Unrecht angeklagte Journalistinnen oder Aktivisten Unterstützung benötigen. Frauenorganisationen machen fast täglich auf einen verdächtigen Todesfall aufmerksam und rufen die Bürgerinnen und Bürger dazu auf, die Spur aufzunehmen. Die Umweltbewegung kämpft an vielen Fronten: zuletzt etwa in Rize am Schwarzen Meer, in der Heimat Erdoğans, wo eines der schönsten Flusstäler des Landes durch ein Bergwerk zerstört wird. Es gibt Fotografen, die eindrucksvolle Bilder liefern, Reporter, die mit Anwohnern sprechen, und Anwälte, die sich der Sache freiwillig annehmen und gegen mächtige Unternehmen vorgehen, die über allzu gute Verbindungen zum „Reis“ verfügen. Dessen Reichtum und Machtapparat wiederum kann mittlerweile niemand mehr einschätzen – die Fixierung auf die Führerfigur Erdoğan ist gegenwärtig der vielleicht einzige verletzliche Punkt des Totalitären in der Türkei.
Dieser tagtägliche Kampf ist äußerst ermüdend. Allein das Verfolgen von Tweets oder das Anschauen von YouTube-Gesprächen nimmt sehr viel Zeit in Anspruch und nagt an der Seele. Von Schülern bis hin zu Akademikerinnen und Politikern haben viele die Erfahrung von Anklage und Haft gemacht. Aber dieser Teil der türkischen Gesellschaft hat eines begriffen: Demokratie und Freiheit werden nicht geschenkt. Sie haben es nicht nur mit einem mächtigen Staatsapparat zu tun, sondern auch mit gleichgeschalteten Medien und den im Internet aktiven Trollen der AKP, die propagandistisch jedes Mittel nutzen, um Informationen zu verzerren und zu verfälschen. Es verdient Respekt, wie sie dennoch an ihren Rechten festhalten und sich diese zurückzuerobern versuchen.
Bürgerrechte ohne starkes Forum
Gerade in diesem von oben erzwungenen Transformationsprozess wird sichtbar, wie eng diese Bewegungen mit der Demokratie zusammenhängen. Jede dieser Bürgerbewegungen zielt auf die Freiheit des Individuums, während der Islamismus als eine totalitäre Weltsicht das Kollektive im Sinn führt. Wie Frauen (oder ein nicht-binäres Individuum) sich zu kleiden und zu benehmen haben, ist direkt verbunden mit einer demokratischen, freiheitlichen Staatsordnung, die auf der Gewaltenteilung basiert und die Verantwortung und Freiheiten der Bürger definiert und garantiert. Bildung, Weltsicht, wirtschaftliche Stellung und Lebensweise sind eng miteinander verknüpft und führen zu einem kohärenten Ergebnis – etwa bei Wahlen. Das ist der Grund, warum islamistische oder andere totalitär gesinnte Bewegungen in einer liberalen Demokratie existieren können, aber nicht umgekehrt.
Doch die Bürgerrechte haben in der Türkei kein starkes Forum, im Zweifel können sie dem starken Staat geopfert werden. So gelingt es Erdoğan vor jeder Wahl, Stimmen zu mobilisieren, etwa mit der Kurdenfrage oder einer vermeintlichen „Attacke“ aus dem Ausland auf die Türken. Das wirkt: Seine AKP kommt jüngsten Umfragen zufolge auf 30 bis 35 Prozent und liegt damit klar vor der sozialdemokratischen CHP, die bei lediglich 20 bis 26 Prozent landet, während auf die pro-kurdische HDP etwa 9 Prozent entfallen. Der Rest der Stimmen verteilt sich unter den Nationalisten und Konservativen.
Wenn Erdoğan bei den kommenden Präsidentschaftswahlen 2023 nur einem einzigen Kandidaten gegenübersteht, so sein Kalkül, wird er diese angesichts der gespaltenen Opposition auf jeden Fall gewinnen.
Auch die heute gegen die Verwüstung ihrer Umwelt kämpfenden Landsleute in Rize werden dann wohl wieder für ihn stimmen. Dabei spielt nicht zuletzt seine Sozialpolitik eine wichtige Rolle: Jeder Bürger ist krankenversichert, es gibt Arbeitslosengeld und -hilfe, die Privatkliniken stehen im Notfall allen offen und der Staat übernimmt auch hohe Behandlungskosten, etwa bei Krebspatienten. In der Pandemie verteilte die Regierung rund 300 Mio. Euro an Bedürftige – das kommt gut an.
Das Alte verschwindet, um dem Neuen Platz zu machen
Wie also geht es weiter in der Türkei? Erdoğans „schleichende Islamisierung“ setzt die islamische Ordnung zunächst als „Alternative“ neben die bestehende: eine andere Schule, ein anderes Hotel, ein anderer Betrieb, eine andere Bank – jeder nach seiner Façon. Nach und nach aber verschwindet so das Alte, um dem Neuen Platz zu machen.
Einige Beispiele: Paare dürfen sich seit fast drei Jahren offiziell durch einen Imam trauen lassen. Warum sollte er sie nicht auch scheiden dürfen? Und warum sollte eine Familie ihre Erbangelegenheiten nicht nach islamischem Recht regeln dürfen (was unter anderem ein doppeltes Erbe für den Mann bedeutet)? Warum sollten maximal vier Ehefrauen nicht legalisiert werden, ist es nicht für sie von Vorteil?
Bei den nicht enden wollenden, zermürbenden Debatten über diese Fragen sind drei Punkte von entscheidender Bedeutung.
Erstens: Wer legt die Scharia aus? In der Türkei ist das die offizielle Religionsbehörde Diyanet. Abweichende, liberalere Interpretationen des Koran stoßen auf den Widerstand der Konservativen – und im Zweifel gewinnen diese.[4] Daher ist derzeit von Theologen im Staatsdienst eine Reform nicht zu erwarten und der eingeschlagene Weg führt zu einer eher konservativen als liberalen Auslegung der Primärquellen des Islam.
Zweitens: Wie lange kann die türkische Bürgergesellschaft durchhalten? Ohne politische Unterstützung wohl nicht mehr lange. Gegen einen massiven AKP-Apparat ist sie auf Dauer machtlos, was sich bereits an einer wachsenden Auswanderungswelle junger Städterinnen und Städter bemerkbar macht.
Drittens: Von wem kann die türkische Bürgergesellschaft Solidarität erwarten? Nicht von politischen Institutionen aus dem Ausland, die im Zweifel ihre nationalen Interessen verteidigen, wohl aber von anderen Teilen der Weltöffentlichkeit, die sich in Sachen bürgerlicher Freiheit, Feminismus und LGBT-Rechte, Umwelt, Klima und vielem mehr engagieren. Die türkische Bürgergesellschaft braucht dringend diese internationale Vernetzung und Unterstützung. Sonst wird es ziemlich still werden in der Türkei.
[1] Vgl. 2020 Yılında Erkekler Tarafından 300 Kadın Öldürüldü, 171 Kadın Süpheli Sekilde Ölü Bulundu, www.kadincinayetlerinidurduracagiz.net, 2.1.2021
[2] Vom arabischen Wortstamm ras: „Anführer, Führer, Kapitän“. Im Türkischen hat das Wort eine stark patriarchale Konnotation.
[3] Das 2014 in Istanbul verabschiedete Übereinkommen des Europarats ist nicht nur für die türkische Frauenbewegung enorm wichtig. Die islamistische Propaganda setzte es mit der Sichtbarkeit von Homo- und Transsexualität in der Öffentlichkeit gleich und plädierte aus „moralischen Gründen“ für den Austritt der Türkei aus der Konvention, um die Familie als Basis der Gesellschaft zu schützen.
[4] So musste der Theologe Mustafa Öztürk im Dezember 2020 aufgrund der Kritik der Konservativen seine Professur an der Marmara-Universität in Istanbul aufgeben. Nun führt er seine historizistische Koranforschung am Zentrum für Islamische Theologie an der Universität Münster unter der Leitung des liberalen Theologen Mouhanad Khorchide fort. Öztürk tritt für eine historische Einordnung der Koranverse ein und kritisiert die konservative Schule.