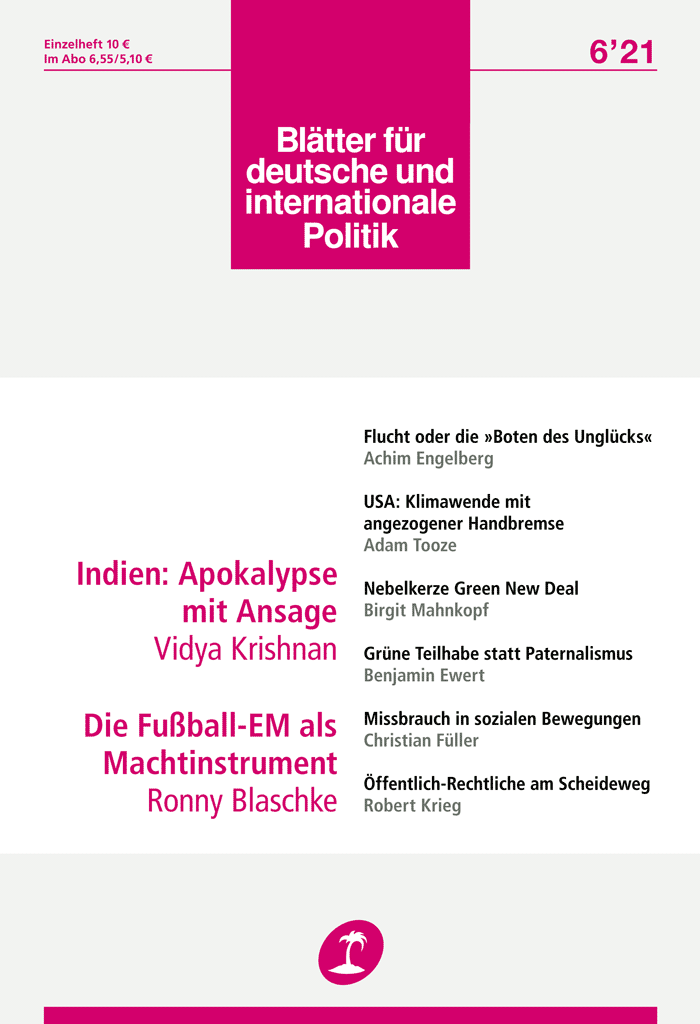Bild: Pressekonferenz mit der designierten Kanzlerkandidatin von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Annalena Baerbock, 19. April 2021 (IMAGO / Christian Thiel)
Angesichts einer wahrscheinlichen grünen Regierungsbeteiligung, ja sogar einer denkbaren Kanzlerschaft von Annalena Baerbock stellt sich umso mehr die Frage nach dem inhaltlichen Profil von Bündnis 90/Die Grünen – und zwar gerade auf dem von diesen nicht so prominent besetzten Terrain. Auch wenn der grüne Programmentwurf zur Bundestagswahl[1] mit dem schön mehrdeutigen Titel „Deutschland. Alles ist drin“ eine umfassende Kompetenz im Stile einer Volkspartei suggeriert, nahm die breite Öffentlichkeit die Grünen bislang meist monothematisch wahr. Um speziell das Feld der Sozialpolitik strategisch zu besetzen, auch und gerade in Konkurrenz zur SPD, drängt die Partei jedoch schon lange „raus aus der Öko-Nische“.[2] Insbesondere in der Corona-Pandemie thematisieren die Grünen ganz gezielt die soziale Situation der „Betroffenen“, wobei die Partei dabei speziell die Situation von Kindern und älteren Menschen in den Vordergrund stellt.[3]
Ungeachtet dessen ist grüne Sozialpolitik bisher nicht „nachhaltig“ in das Bewusstsein der Bürger*innen vorgedrungen: Weder wird die Partei mit einer großen sozialpolitischen Reform in Verbindung gebracht, noch besitzen grüne Sozialpolitiker*innen einen hohen Bekanntheitsgrad. Wenn in der Öffentlichkeit aus einer sozialpolitischen Perspektive über grüne Politik diskutiert wird, geschieht dies vor allem mit Blick auf die Kosten grüner Klima- und Umweltschutzpolitik – gemäß dem Motto: „Grüne Politik muss man sich leisten können!“ Infolgedessen bekräftigen politische Gegner*innen der Grünen gerne das Vorurteil einer Partei moralisierender Gutverdiener*innen,[4] denen beim Versuch, „die Welt zu retten“, das Verständnis für die (vermeintlich) wahren Nöte und Sorgen der Menschen abhandengekommen sei. Der Vorwurf, eine im Kern sozial ungerechte Politik zu vertreten, trifft die Grünen in ihrem ureigenen Selbstverständnis. Schließlich gründete sich die Bundespartei 1980 unter dem Leitspruch „ökologisch – sozial – basisdemokratisch – gewaltfrei“. Soziale Politik und ein soziales Bewusstsein gehören zu den zentralen Gründungspfeilern grüner Programmatik. Angesichts ihres ausgeprägten umweltpolitischen Profils war die sozialpolitische Programmatik der Partei allerdings lange Zeit eine „strategische Leerstelle“.[5] Ziel grüner Politik, gerade mit Blick auf die kommende Bundestagswahl, muss es daher sein, die Konturen grüner Interessen und Interessenvertretung in der Sozialpolitik theoretisch wie praktisch zu schärfen.
Theoretisch-konzeptionell basiert grüne Sozialpolitik auf einem „inklusiv-garantistischen Ansatz“, der sich an alle Bürger*innen richtet, unabhängig von ihrem sozialen Status.[6] Das Adjektiv „inklusiv“ verweist darauf, dass die Grünen sich speziell in ihrer Anfangsphase „insbesondere jener Gruppen annahmen, die von den Sicherungssystemen des klassischen Sozialstaats nicht erfasst wurden“.[7] Zählten hierzu damals vor allem Frauen sowie erwerbslose und behinderte Bürger*innen, richtet sich der Fokus einer inklusiven Sozialpolitik gegenwärtig auch auf Geflüchtete und Migrant*innen. Aufgrund des Engagements speziell für „die Schwächsten der Gesellschaft“[8] wurde die Partei auch vereinzelt als „Träger einer neuen sozialpolitischen Kultur“[9] bezeichnet. Überspitzt formuliert: Nicht dem „männlichen Facharbeiter“, sondern „Geflüchteten mit psychischen Problemen“ gilt das vordringliche Augenmerk grüner Sozialpolitik. Das Adjektiv „garantistisch“ verweist in einer Minimalversion auf die Sicherstellung des Vorhandenseins einer sozial-staatlichen Infrastruktur, als elementare Grundvoraussetzung für soziale Teilhabe, verwirklichte Gleichberechtigung und gesellschaftlichen Zusammenhalt. In einer – innerhalb der Partei nicht mehrheitsfähigen – Maximalversion bedeutet „garantistisch“ die Entkopplung sozialstaatlicher Leistungen von erwerbszentrierter Lohnarbeit, wie es grüne Bürgerversicherungskonzepte für die Bereiche Gesundheit und Rente sowie die Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens vorsehen. Hinter dieser Position verbirgt sich auch der Ansatz einer „ökologischen Sozialpolitik“,[10] demzufolge soziale Sicherheitsgarantien weitestgehend unabhängig von wirtschaftlichem Wachstum (und dem Verbrauch fossiler Ressourcen) erfolgen sollen. Der Referenzpunkt einer garantistischen Sozialpolitik ist in dieser Lesart nicht mehr soziale Umverteilung, sondern ein immaterielles Verständnis von Wohlstand, bestehend aus „Sicherheit, Freiheit, Zeitsouveränität, gesunden Lebensgrundlagen, Gleichberechtigung, kultureller und politischer Teilhabe“.[11]
Inwieweit die Grünen diese Vision einer wachstumsunabhängigen und nicht mehr auf Erwerbsarbeit fixierten Sozialpolitik realpolitisch weiterverfolgen werden, so sie im Bund tatsächlich an die Macht gelangen, ist ungewiss. Im neuen Grundsatzprogramm spricht sich die Partei denn auch eher allgemein für eine „sozial-ökologische Marktwirtschaft innerhalb klarer Leitplanken“ aus.[12] Grundsätzlich verspricht der „inklusiv-garantistische Ansatz“ grüner Sozialpolitik das Beste aus allen Welten, das heißt eine gemischte Wohlfahrtsproduktion im intermediären Sektor zwischen Staat, Markt und Familie bzw. Gemeinschaft.[13] Tatsächlich finden sich aus Sicht der Grünen für jede der drei Steuerungsinstanzen sowohl handfeste Pro- als auch Kontra-Argumente. Einerseits gab und gibt es in der aus sozialen Bewegungen und alternativen Milieus der 1970er und 1980er Jahre entstandenen Partei tief verwurzelte Vorbehalte gegen eine staatlich-interventionistische Sozialpolitik. Dies zeigte sich traditionell in „Forderungen nach Entprofessionalisierung, Dezentralisierung, Entbürokratisierung und Kommunalisierung“.[14] Andererseits spricht sich die Partei in ihrem im Herbst 2020 verabschiedeten Grundsatzprogramm für einen „starken Sozialstaat“[15] aus, dessen „Sicherheitsversprechen“ für alle Bürger*innen auf einer „soziale[n] und inklusive[n] Infrastruktur“ beruht.[16]
Gegen den paternalistischen Versorgungsstaat
Die Grünen haben somit ein durchaus ambivalentes Verhältnis zum Sozialstaat: Zwar lehnt die Partei einen paternalistischen Versorgungsstaat ab, in dem Menschen suggeriert würde, dass sie „qua Geburt ein Anrecht auf alles besäßen“, staatliche Institutionen und Angebote hingegen, die der Befähigung – und weniger der sozialstaatlichen Betreuung – von Bürger*innen dienen, gilt es nach grüner Überzeugung zu stärken. Das Kernanliegen eines „barrierefreien Sozialstaates“ (ebd.) sind somit verlässliche und für alle Menschen zugängliche soziale Infrastrukturen. Im Vordergrund dieser gewissermaßen grünen Variante einer „vorsorgenden Sozialpolitik“[17] steht die Stärkung der Bürger*innen-Rolle entlang der Leitwerte Emanzipation und Empowerment. Anknüpfend an das freiheitlich-libertäre, dem zweiten Steuerungsprinzip Markt angelehnte, Element grün-alternativer Sozialpolitik gilt es, Bürger*innen zu befähigen, sozialstaatliche Infrastrukturen eigenmächtig und bedarfsgerecht zu nutzen. Jenseits von oktroyierter Eigenverantwortung und staatlicher Fürsorge soll grüne Sozialpolitik effektive Hilfe zur Selbsthilfe ermöglichen. Ein wesentlicher Schritt in diese Richtung ist die Überführung bestehender Sozialleistungen wie Hartz IV in eine „bedingungslose und bedarfsgerechte“[18] Garantiesicherung. Gerade im Bereich der Arbeit strebt die Partei an, klassische Fürsorgeleistungen in Richtung garantierter Teilhabeansprüche weiterzuentwickeln. So schlägt das neue Grundsatzprogramm[19] die Erweiterung der „Arbeitslosenversicherung zu einer Arbeitsversicherung“ und einen „Rechtsanspruch auf Weiterbildung und Umschulung“ vor, um „die Transformation der Arbeitswelt gerecht und partizipativ zu gestalten“.
Im Zentrum grüner Sozialpolitik steht jedoch zweifellos das dritte Steuerungsprinzip, der Bereich der Zivilgesellschaft und Gemeinschaft. Der Fokus grüner Sozialpolitik liegt dabei weniger auf der Familie als Primärinstanz für sozialen Zusammenhalt, sondern auf unkonventionellen Formen des Miteinanders und des Austauschs innerhalb „starke[r] öffentliche[r] Begegnungsräume“.[20] Hier wird die sozial-initiative und bürgerbewegt-kommunitaristische Tradition von Bündnis 90/Die Grünen deutlich, die einerseits auf ein „starkes soziales Netz“[21] und informelle Unterstützungsinitiativen setzt, sich aber andererseits immer des immanenten Spannungsverhältnisses zwischen gemeinschaftlicher Einbindung und wachsenden Individualisierungsbedürfnissen und -prozessen bewusst ist.
Idealerweise sollen Bürger*innen somit beides erfahren: Solidarität und Rückhalt sowie Möglichkeiten der Selbstentfaltung. Exemplarisch hierfür stehen bürgerschaftlich organisierte „Mensch-zu-Mensch-Geschichten“ wie alternative Wohnformen im Alter oder Mentorenprogramme. Diese „urgrüne“ Vorstellung von gemeinschaftlichem und teilhabeorientiertem Zusammenleben setzt allerdings eine intakte (sozial-)staatliche Infrastruktur, das heißt, „lebenswerte und sichere öffentliche Räume und Institutionen“,[22] voraus. Doch welche sozialpolitische Politik und Interessen vertritt die Partei ganz konkret und in der Praxis – also dort, wo sie heute bereits regiert?
Die Gelegenheit, ihre programmatischen Vorstellungen von Sozialpolitik realpolitisch umzusetzen, bietet sich für die Grünen bisher nur auf Ebene der Bundesländer. Mit Manfred Lucha (Baden-Württemberg), Kai Klose (Hessen), Anja Stahmann (Bremen) und Ursula Nonnenmacher (Brandenburg) sind derzeit vier grüne Sozialminister*innen im Amt.[23] Sowohl in Baden-Württemberg als auch in Hessen findet grüne Sozialpolitik ausgesprochen günstige Rahmenbedingungen vor. In beiden Bundesländern stellt das Sozialressort ein „Gestaltungsministerium“ dar, zumindest galt das vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie. Die Realisierung sozialpolitischer Gesetzesinitiativen, sofern sich diese auf Landesebene umsetzen lassen, scheitert hier also nicht von vornherein an Finanzvorbehalten. Ferner verantworten die grünen Sozialminister in Hessen und Baden-Württemberg ein breites Spektrum an sozialpolitischen Feldern, das neben Familie und Soziales sowie Gesundheit und Pflege ebenfalls den Bereich der Integration umfasst. In Hessen ist dem Sozialministerium zudem das Arbeitsressort untergeordnet. Die vorrangig sozial- anstatt ordnungspolitische Bearbeitung des Integrationsthemas – sowohl Lucha als auch Klose sind Minister für Soziales und Integration – ist in beiden Bundesländern ein Kernmerkmal grüner Sozialpolitik.
Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang insbesondere der 2017 in Baden-Württemberg geschlossene „Pakt für Integration mit den Kommunen“: Basierend auf einem gemeinsam von Landesregierung und Kommunen erarbeiteten Konzept für ein kommunales Integrationsmanagement können Städte und Landkreise Integrationsmaßnahmen in Eigenregie gestalten. Kommunale Integrationsmanager*innen loten dabei die jeweiligen Bedarfe mit Integrationsbeauftragten und Ehrenamtlichen vor Ort aus. Der Pakt umfasst eine Direkthilfe für die Kommunen von 180 Mio. Euro sowie weitere 140 Mio. Euro für projektbezogene Maßnahmen in den Förderbereichen Integrationsmanagement, Schule und Übergang zum Beruf, Sprache und Bürgerengagement.
Der Realitäts-Check: Grüne Sozialpolitik auf Länderebene
Ähnlich, wenngleich weniger staatstragend, ist die Integrationspolitik des hessischen Sozialministeriums: Im Rahmen des Landesprogramms „WIR“ werden Integrationskoordinator*innen und -fallmanager*innen sowie gemeinnützige Migrantenorganisationen gefördert, ehrenamtliche Integrationslots*innen qualifiziert sowie eine sozialräumliche Willkommens- und Anerkennungskultur[24] entwickelt. Als Zielgruppe adressiert das Programm, der Idee einer inklusiven Sozialpolitik folgend, „alle Bürgerinnen und Bürger – mit und ohne Migrationshintergrund“. Überhaupt trägt der hessische Koalitionsvertrag von CDU und Grünen beim Thema Integration eine dezidiert grüne Handschrift. So heißt es darin unter anderem „Integration ist keine Einbahnstraße. Wir brauchen die Integrationsleistungen sowohl der Zugewanderten als auch der Menschen, die seit Generationen hier leben“ – eine Aussage, die im Regierungsprogramm eines CDU-geführten Bundeslandes durchaus hervorsticht. Allerdings kann in Hessen bisher noch kein die Legislaturperiode wirklich prägendes Vorhaben grüner Sozialpolitik identifiziert werden. Die Wohnungspolitik als das neben den Folgen der Corona-Pandemie drängendste soziale Problem, zumindest in den urbanen Zentren des Bundeslandes, fällt gerade nicht in den Aufgabenbereich des hessischen Ministeriums für Soziales und Integration. Grundsätzlich widmet das grüne Ministerium, so viel ist bereits zu erkennen, vermeintlich schwachen Interessengruppen eine hohe Aufmerksamkeit: So wurde ein Behindertengleichstellungsgesetz verabschiedet und die Stelle eines hauptamtlichen Behindertenbeauftragten eingerichtet, das Landesblindengeld für taubblinde Menschen ausgeweitet, ein Dialogforum Islam ins Leben gerufen sowie ein Runder Tisch zum Zukunftsprogramm Geburts- und Hebammenhilfe in Hessen konstituiert. Bundesweit Beachtung erhielt zudem die von Hessen miterarbeitete Bundesratsinitiative zum Verbot von Konversionstherapien.[25]
Neben den Sozialministerien der beiden großen Flächenländer Hessen und Baden-Württemberg ist auch das Bremer Senatsressort „Soziales, Jugend, Integration und Sport“ seit 2011 in grüner Hand.[26] Der Stadtstaat hat traditionell eine hohe Staatsverschuldung, eine hohe Verschuldung der öffentlichen Haushalte sowie einen „überdurchschnittlich großen Anteil von Langzeitarbeitslosen ohne ausreichende Qualifikation“.[27] Grüne Sozialpolitik trifft hier auf weitaus ungünstigere Voraussetzungen. Dennoch wird in Bremen der auf kleine Initiativen und lokale Netzwerke zentrierte Fokus grüner Sozialpolitik besonders deutlich. Die langjährige Bremer Tradition von integrierten Programmen zur sozialen Stadt(teil)entwicklung bietet einen günstigen Handlungsrahmen für eine an Sozialraumorientierung und Empowerment ausgerichtete Politik. Hierzu zählt auch das 2020 seitens der Zukunftskommission des Senats ins Leben gerufenen Landesprogramm „Lebendige Quartiere“.[28] Senatorin Anja Stahmann setzt in der Umsetzung des Programms auf „bedarfsgenaue“ Unterstützungsleistungen für sozial abgehängte Bewohner*innen in Stadtteilen und Kleinstgebieten.[29] So wurde während der Coronakrise die von den Grünen präferierte Form der „aufsuchenden“ sozialen Unterstützung gezielt um Angebote an der „Schnittstelle von Sozialberatung und Gesundheitskompetenzförderung“ erweitert. Auch andere Ad-hoc-Interventionen des Bremer Sozialressorts zur Eindämmung der sozialen Folgen der Corona-Pandemie zielen ganz bewusst auf die Stärkung von Teilhabe und Inklusion der Betroffenen, aber auch eine „Ambulantisierung“ und Entbürokratisierung sozialer Unterstützung ab. Zu nennen sind der „Ausbau der Straßensozialarbeit in den Corona-Hotspots“, sozial-medizinische „Kommunikations-Schulungen für Multiplikatoren und Multiplikatorinnen“, der Einsatz von zehn „Gesundheitslotsinnen und Gesundheitslotsen“ sowie der „Ausbau des Angebots an Sprach- und Kulturvermittlerinnen und -vermittlern“.
Fasst man die bisherigen Erfahrungen zusammen, stellt man fest, dass die Grünen einen neuen Stil von Sozialpolitik verkörpern, der Kritik übt, aber auch hervorruft. Insbesondere korporatistische Strukturen, in denen „der Sozialstaat“ einseitig durch Politik und Selbstverwaltungsakteure wie Arbeitgeber, Gewerkschaften und Wohlfahrtsverbände repräsentiert wird, sind bei grünen Sozialpolitiker*innen vergleichsweise negativ konnotiert. Die Partei, die sich mit dem Ziel der „realpolitischen Umgestaltung der Verhältnisse“[30] gründete, nimmt für sich in Anspruch, „nicht im Lobbyismus gefangen“ zu sein. Dem eigenen Selbstverständnis zur Folge ist dies eine gute Ausgangsposition, um Interessen materiell schwacher Gruppen und bisher unterrepräsentierten, zivilgesellschaftlichen Akteuren innerhalb des Sozialsystems mehr Geltung zu verleihen.
Sozialpolitischer Kulturwandel
Die Erfolgschancen eines teilhabeorientierten Sozialpolitik-Stils variieren allerdings stark je nach Politikfeld. So gestehen grüne Sozialpolitiker*innen unumwunden ein, dass etwa das Gesundheitssystem, wenn es um das Aufbrechen korporatistischer Strukturen geht, eine „ganz harte Nuss“ sei. Eine im Sinne von Bündnis 90/Die Grünen patientenfreundliche, das heißt, dezentrale und nicht arztzentrierte Politik beschränkt sich daher bis auf weiteres auf die (ideelle) Förderung von Modellprojekten,[31] die Aufwertung von „Heilmittelerbringer*innen und gesundheitsnahe[n] Berufe[n]“[32] innerhalb des Versorgungssystems sowie eine Stärkung des öffentlichen Gesundheitsdienstes. Günstiger sieht die Situation in den Bereichen Integration und Sozialraumentwicklung aus. Hier setzen die Grünen auf eine „experimentelle Sozialpolitik“ jenseits des als starr und zu wenig an den Bedarfen der Betroffenen orientierten bisherigen Sicherungssystems.[33] Die Präferenzen grüner Sozialpolitik sind somit klar: mehr zivilgesellschaftliche Beteiligung statt staatlicher Fürsorge, mehr lokale statt zentraler Lösungen, mehr themenorientierte Netzwerke und Initiativen statt korporatistischer Interessenvertretung.
Das Echo auf das grüne Verständnis von Sozialpolitik ist geteilt. Trotz der kritisierten Tendenz zur „Randgruppenfixierung“ (so der Sozialverband VdK Deutschland e.V.) erhält der betont inklusive Politikstil der Grünen seitens der Wohlfahrtsverbände grundsätzlich Zuspruch, wobei insbesondere die „feine soziale Antenne“ und das „sozialarbeiterische Gespür“ (Liga der Freien Wohlfahrtspflege, Liga) (einiger) grüner Sozialpolitiker*innen hervorgehoben wird. Gerade im Vergleich zu Erfahrungen mit CDU-geführten Sozialministerien, wo, wie beispielsweise eine Vertreterin der Liga in Baden-Württemberg berichtete, „Sozialarbeiter keinen Rang“ hatten, stünde grüne Sozialpolitik für einen spürbaren Kulturwandel. Problematisch sei eine vermeintlich inklusive Sozialpolitik hingegen dort, wo sie zu Lasten der Wertschätzung und Mitwirkung der „eingesessenen Sozialpartner“ (VdK) geht. Grüne Sozialpolitik, so die Klage, nehme die Wohlfahrtsverbände „nicht ausreichend mit“ (VdK) und neige dazu, „das Rad permanent neu erfinden zu müssen“ (Liga). Aus Sicht des baden-württembergischen Sozialverbands VdK habe das Sozialministerium unter grüner Führung zudem den Blick „für die Gesamtheit der Gesellschaft und zentrale Herausforderungen wie den demographischen Wandel und die Pflege“ (VdK) verloren, während die Integration von Geflüchteten und Migrant*innen gewissermaßen „über allem“ (ebd.) stünde. Auch andere Gesprächspartner*innen attestieren den Grünen eine zwar durchaus „themenorientierte“, jedoch tendenziell „randgruppenfixierte Sozialpolitik“ (Liga). Derartige Einschätzungen offenbaren jedoch ihrerseits ein – gelinde gesagt – antiquiertes Gesellschaftsbild mancher Sozialpartner, demzufolge ein quasi natürlicher Zusammenhang zwischen „Migrationshintergrund“ und „Randgruppe“ existiert. In allen drei untersuchten Bundesländern bemängeln Vertreter*innen von Gewerkschaften und Wohlfahrtsverbänden zudem, dass die Grünen, sobald sie regieren, gesellschaftspolitische Themen wie Armut und die Verteilung von Reichtum nur noch „mit spitzen Fingern“ (DGB) anfassen und „bestenfalls routiniert abarbeiten“ (Liga) würden.
All das zeigt, dass Bündnis 90/Die Grünen mit Blick auf eine mögliche Regierungsbeteiligung, ja sogar -führung im Bund an ihrem sozialpolitischen Profil noch werden arbeiten müssen.[34] Dessen Umrisse lassen sich bisher nur auf Bundesländerebene beobachten: Hier tarieren grün geführte Sozialministerien Verantwortlichkeiten in der Wohlfahrtsproduktion neu aus, indem sie Themen und Zielgruppen in den Vordergrund stellen, die seitens der etablierten Sozialpolitik eher wenig Beachtung fanden. Inwiefern eine derart zivil- und bürgergesellschaftsorientierte Sozialpolitik geeignet ist, um dem grünen Anspruch nach einer effektiveren Vertretung sozial-schwacher Interessen tatsächlich gerecht zu werden, bleibt abzuwarten.
Nicht zuletzt wird der Erfolg grüner Sozialpolitik davon anhängen, in welcher Regierungskonstellation die Grünen ab dem 26. September werden gestalten können – oder müssen. Ungeachtet der am Ende herauskommenden Koalition dürfte die entscheidende Frage allerdings sein, ob es den Grünen als mittlerweile arrivierte Partei dauerhaft gelingt, auf Augenhöhe mit der Vielfalt der Bürgergesellschaft zu bleiben,[35] als dem von ihnen selbst ausgemachten Dreh- und Angelpunkt grüner Sozialpolitik. Eine exekutiv verordnete Beteiligungs- und Engagementkultur, die feinsäuberlich zwischen alten und neuen sozialpolitischen Akteuren unterscheidet, dürfte in diesem Zusammenhang jedenfalls ebenso wenig hilfreich sein wie das Ausblenden der realexistierenden materiellen Verteilungskonflikte. Um eine breite gesellschaftliche Unterstützung für ihre Sozialpolitik zu organisieren, wären die Grünen daher gut beraten, stärker als bisher Interessenschnittmengen mit den klassischen Sozialpartnern, insbesondere Gewerkschaften und Sozial- und Wohlfahrtsverbänden, auszuloten, um so die gesellschaftlichen Kräfte und Ressourcen für die Umsetzung der erforderlichen sozialpolitischen Reformen zu bündeln. Denn nur auf diese Weise dürfte grüne Sozialpolitik am Ende wirklich erfolgreich sein.
[1] Vgl. „Deutschland. Alles ist drin“, Programmentwurf. Grünes Wahlprogramm zur Bundestagswahl, www.gruene.de, 19.3.2021.
[2] Silke Kerstin, Die Grünen wollen mit Bürgerfonds aus der Öko-Nische raus, in: „Handelsblatt“, 29.8.2019.
[3] „Es war fatal, Familien und Kinder außen vor zu lassen“, Interview mit Annalena Baerbock, in: „Deutschlandfunk“, 26.4.2020.
[4] Dass Anhänger*innen der Grünen überdurchschnittlich verdienen, ist falsch. Nach einer Studie des Instituts YouGov ist das „Haushaltseinkommen der typischen Grünen-Wähler ähnlich verteilt wie das der übrigen Wähler – 27 Prozent der Grünen-Wähler haben sogar weniger als 1500 Euro im Monat zur Verfügung, das ist etwas mehr als die 22 Prozent der anderen Wähler“, siehe Lisa Caspari, Weitgereiste Bücherfreunde, www.zeit.de, 10.8.2017.
[5] Heinrich-Böll-Stiftung, Zur Geschichte der grünen Wirtschafts- und Sozialpolitik, Fragen an Wolfgang Schroeder im Rahmen der Reihe „Was ist die grüne Erzählung“, www.youtube.com, 17.11.2020.
[6] Hierzu zählen explizit auch diejenigen Menschen, die keinen offiziellen Bürgerstatus haben bzw. keiner sozialversicherten Beschäftigung nachgehen.
[7] Silke Mende, Von der „Anti-Parteien-Partei“ zur „ökologischen Reformpartei“. Die Grünen und der Wandel des Politischen, in: „Archiv für Sozialgeschichte“, 2012, S. 311.
[8] Ingolfur Blühdorn, Reinventing green politics: on the strategic repositioning of the German Green Party, in: „German Politics“, 1/2009, S. 42.
[9] Antonia Gohr, Grüne Sozialpolitik in den 80er Jahren: eine Herausforderung für die SPD, in: „ZeS-Arbeitspapier“, 5/2002, S. 43.
[10] Ebd., S. 14 ff.
[11] Bündnis 90/Die Grünen, „‚… zu achten und zu schützen …‘ Veränderung schafft Halt“, Grundsatzprogramm von Bündnis 90/Die Grünen, 2020, S. 19.
[12] Bündnis 90/Die Grünen, a.a.O.
[13] Adalbert Evers und Jean-Luis Laville, The third sector in Europe, 2004.
[14] Antonia Gohr, Grüne Sozialpolitik in den 80er Jahren: eine Herausforderung für die SPD, in: „ZeS-Arbeitspapier“, 5/2002, S. 10.
[15] Bündnis 90/Die Grünen, a.a.O., S. 5.
[16] Ebd., S. 59.
[17] Wolfgang Schroeder, Konfessionelle Wohlfahrtsverbände im Umbruch. Fortführung des deutschen Sonderwegs durch vorsorgende Sozialpolitik?, Heidelberg 2016.
[18] Robert Habeck, Anreiz statt Sanktionen, bedarfsgerecht und bedingungslos, Debattenbeitrag für das Grundsatzprogramm 2018, S. 4.
[19] Bündnis 90/Die Grünen, a.a.O., S. 61.
[20] Ebd., S. 7.
[21] Ebd., S. 59.
[22] Ebd., S. 39.
[23] Aus Platzgründen wird im Folgenden nicht auf Brandenburg als den jüngsten Fall von grüner sozialpolitischer Regierungsverantwortung auf Länderebene eingegangen. Obwohl Ursula Nonnenmacher seit ihrem Amtsantritt im November 2019 vor allem mit der Eindämmung der Pandemie beschäftigt war, verspricht ihr Ministerium ebenfalls eine Politik des vorsorgenden Sozialstaats.
[24] Vielfältige Fördermöglichkeiten im Landesprogramm WIR, integrationskompass.hessen.de, 2019.
[25] Die Initiative wurde am 17.5.2019 vom Bundesrat beschlossen und an den Bundestag weitergeleitet.
[26] Der Zuschnitt des Ressorts änderte sich in dieser Zeit mehrfach: Von „Soziales, Kinder, Jugend und Frauen“ (2011-2015) über „Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport“ (2016-2019) zu „Soziales, Jugend, Integration und Sport“ (seit August 2019).
[27] Karl Marten Barfuß, Mirko Kruse und Jan Wedemeier, Bremen – Einige Thesen zur sozio-ökonomischen Entwicklung, in: „HWWI Policy Paper 117“, 2019, S. 23.
[28] Senatspressestelle Bremen, Pressemitteilung der Senatorin für Soziales, Jugend, Integration und Sport, „Wir wollen der sozialen Spaltung der Stadt mehr entgegensetzen“, 3.12.2020.
[29] Hier und im Folgenden: Senatspressestelle Bremen, a.a.O.
[30] Heinrich-Böll-Stiftung, Zur Geschichte der grünen Wirtschafts- und Sozialpolitik, Fragen an Wolfgang Schroeder im Rahmen der Reihe „Was ist die grüne Erzählung“, www.youtube.com, 17.11.2020.
[31] Wie etwa das Gesundheitsnetzwerk „Gesunder Werra-Meißner-Kreis“ in Hessen.
[32] Bündnis 90/Die Grünen, a.a.O., S. 45.
[33] Christoph Strünck, Experimentelle Sozialpolitik, in: Fabian Hoose, Fabian Beckmann und Anna-Lena Schönauer (Hg.), Fortsetzung folgt, Berlin 2017.
[34] Blühdorn, a.a.O.
[35] Adalbert Evers und Claus Leggewie, Falsch verbunden, in: „Forschungsjournal Soziale Bewegungen“, 1-2/2018.