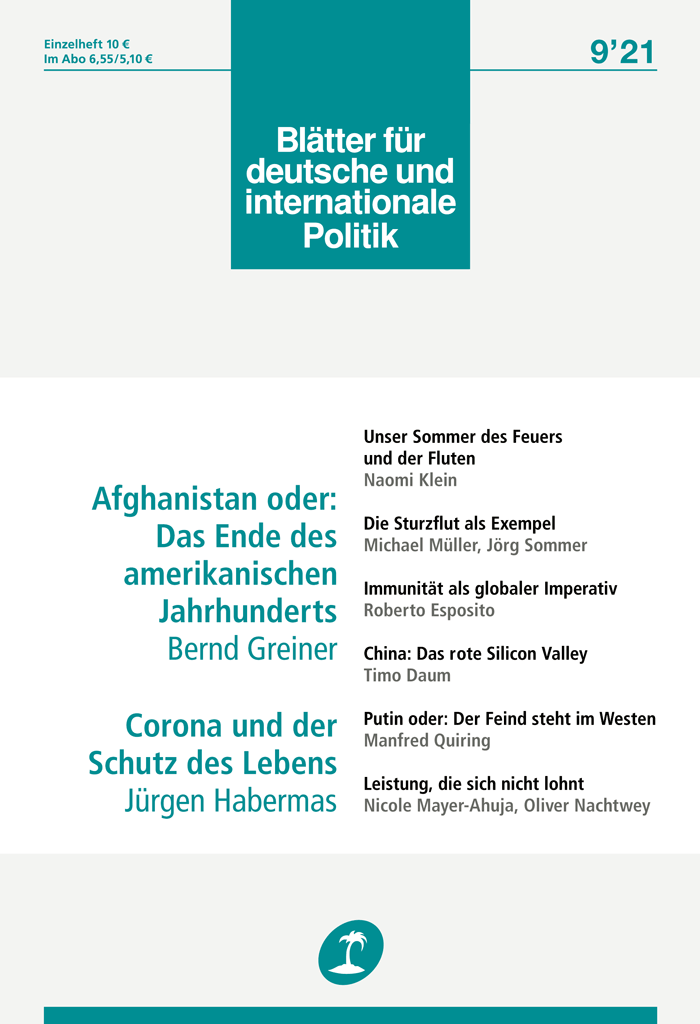Bild: Russlands Präsident Wladimir Putin nimmt zusammen mit Veteranen des Zweiten Weltkriegs an der Militärparade zum Tag des Sieges auf dem Roten Platz teil, die den 75. Jahrestag des Sieges im Zweiten Weltkrieg markiert, 24.6.2020 (IMAGO / ITAR-TASS)
Kurz vor der Sommerpause ereignete sich in Moskau ein Skandal, ein Theaterskandal, wie es schien. Auf der Bühne des Moskauer „Sowremennik“-Theaters wurde, insgesamt drei Mal, das Stück „Das erste Brot“ des russischen Autors Rinat Taschimow aufgeführt. Das aber reichte, um Offiziere und Kriegsveteranen in vereinter Empörung auf den Plan zu rufen und nach „Maßnahmen“ zu verlangen. Denn in dem Stück, in dem es um die Perspektivlosigkeit Jugendlicher in der russischen Provinz geht, sahen die „Offiziere Russlands“ und die „Veteranen Russlands“ den Tatbestand der Veteranenbeleidigung und der „Homosexuellen-Propaganda“ erfüllt. Beides gilt in Russland als schweres Verbrechen, schwerer wiegt nur noch die Verunglimpfung des Präsidenten.[1] Verschärfend dürfte in den Augen russischer Patrioten zudem die Tatsache wirken, dass ein aus Polen stammender Regisseur, Weniamin Koz, das Stück inszeniert hat. Was zunächst wie ein Streit über Theater, Kunst, Missverständnisse und beleidigte Angehörige verschiedener Bevölkerungsgruppen erscheinen mag, illustriert bei näherem Hinsehen die repressiven Veränderungen, die sich im autoritären russischen Staat gerade in den Monaten und Wochen vor den Wahlen zur Staatsduma abspielen, die für den 19. September anberaumt sind. Kaum war der Streit entbrannt, schaltete sich das russische Kulturministerium ein. Es kündigte „gesellschaftliche Anhörungen“ an, in denen die Spielpläne der Theater landesweit gründlich durchleuchtet werden sollen. Es gelte zu klären, inwieweit diese der gerade von Präsident Wladimir Putin unterzeichneten „Strategie der nationalen Sicherheit“ entsprechen. Denn, so begründete der Vorsitzende des gesellschaftlichen Beirats des Ministeriums, Michail Lermontow, den auch für russische Verhältnisse einmaligen Vorgang, das Dokument enthalte einen „gewaltigen Abschnitt“ über die Bewahrung der geistig-moralischen und patriotischen Werte Russlands. Daran müssten auch Theaterspielpläne gemessen werden.[2]
Das unter Federführung von Sicherheitsratschef Nikolai Patruschew im russischen Sicherheitsrat verfasste Strategiepapier hatte Putin am 3. Juli mit seiner Unterschrift in Kraft gesetzt. Die Doktrin, die alle sechs Jahre aktualisiert wird – die Vorgänger-Variante stammt aus dem Jahr 2015 –, bildet die Grundlage für die „strategische Planung“ des Kreml. In ihr wird festgelegt, wie die nationalen Interessen und strategischen Prioritäten aus Sicht der russischen Führung zu interpretieren sind.
Die »Bedrohung der russischen Werte«
Die in dem Papier formulierten Ziele sind hoch gesteckt – und reichen weit in die Zukunft. Zu ihnen zählen etwa die Bewahrung des russischen Volkes, die Erhöhung der Lebensqualität und des Wohlstandes der Bürger, die Stärkung der Verteidigungsfähigkeit, die Einheit und Geschlossenheit der russischen Gesellschaft sowie die Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit und des internationalen Ansehens Russlands. Der Weg dahin werde allerdings kein leichter sein, heißt es in dem Dokument: „Unfreundlich gesinnte Länder versuchen, die in der Russischen Föderation existierenden sozial-ökonomischen Probleme auszunutzen, um die innere Einheit zu zerstören, Protestbewegungen zu inspirieren und zu radikalisieren, marginale Gruppen zu unterstützen und die russische Gesellschaft zu spalten. Immer aktiver werden indirekte Methoden angewendet, die darauf gerichtet sind, langfristig Instabilität innerhalb der Russischen Föderation zu provozieren.“[3]
Ganz besonders beunruhigt den Kreml offensichtlich die angebliche Bedrohung der traditionellen russischen „geistig-moralischen Werte“. Rund dreißig Mal taucht der Begriff in dem 44 Seiten umfassenden Werk auf, übertroffen nur von dem Begriff „Sicherheit“, der rund einhundert Mal Verwendung findet. Zu den ur-russischen Werten gehören laut der Doktrin „Leben, Würde, Rechte und Freiheiten des Menschen, Patriotismus, staatsbürgerliches Bewusstsein, Dienst am Vaterland und Verantwortung gegenüber seinem Schicksal, hohe moralische Ideale, eine starke Familie, schöpferische Arbeit, der Vorrang des Geistigen vor dem Materiellen, Humanismus, Barmherzigkeit, Gerechtigkeit, Kollektivität, gegenseitige Hilfe und Achtung, historisches Gedächtnis und generationenübergreifende Kontinuität“.[4]
Diese Werte sind zwar zumindest teilweise der europäischen Menschenrechtskonvention entlehnt, seien aber nach Meinung des russischen Strategiedokuments „seitens der USA und ihrer Verbündeten aktiven Angriffen ausgesetzt – auch von Seiten transnationaler Konzerne und ausländischer nicht kommerzieller Organisationen“. Es ist vor allem die westliche Lebensweise, wie der russische Sicherheitsrat sie versteht, die die Verfasser der Doktrin umtreibt. Die russischen Eliten, in denen Geheimdienste und Militärs das Sagen haben, fühlen seit geraumer Zeit, dass ihnen zwar die älteren Jahrgänge der Bevölkerung mehrheitlich noch gewogen sind, ihnen jedoch die junge Generation entgleitet. Die patriarchalen, orthodox geprägten Lebensentwürfe verfangen bei ihr immer weniger. Das wirre Bild, das Sicherheitsratschef Patruschew mit seinen Leuten vom Westen malt, dürfte daran wenig ändern. Es hat etwas Verzweifeltes, wenn in der Doktrin davor gewarnt wird, im Westen würden „persönliche Freiheiten verabsolutiert“. Dort walte „eine aktive Propaganda der Freizügigkeit, der Sittenlosigkeit und des Egoismus; es wird ein Kult der Gewalt, des Konsums und des Vergnügens durchgesetzt; es wird der Konsum von Drogen legalisiert und eine Gesellschaft gebildet, die den natürlichen Lebenszyklus [gemeint ist die Vater-Mutter-Kinder-Familie – d. A.] negiert.“ Dem Dokument zufolge wachse dadurch der Druck des Westens auf Russland – und damit die Gefahr einer Spaltung der Gesellschaft.[5]
Russland sei „eingekreist von Feinden, im Griff einer fremden Kultur“, kommentierte denn auch die kremlnahe Zeitung „Njesawissimaja Gaseta“ und brachte damit das von Paranoia geprägte Lebensgefühl der russischen Eliten zum Ausdruck. Dem versuchten die Sicherheitsorgane entgegenzuwirken, indem sie sich der „Feinde“ im Inland und im Ausland annähmen.[6]
Und tatsächlich wurden Ende Juli erneut zahlreiche NGOs, dieses Mal aus Tschechien, Großbritannien, Frankreich und Deutschland, in Russland als „unerwünschte Organisationen“ eingestuft, was praktisch einem Verbot gleichkommt. Betroffen davon sind auf deutscher Seite das Zentrum Liberale Moderne und der Deutsch-Russische Austausch, beides Mitglieder des Petersburger Dialogs. Dieses 2001 gegründete deutsch-russische Gesprächsforum, das sich seit Jahren verzweifelt darum bemüht, die Gesprächskanäle offenzuhalten, sah sich angesichts dessen zu einer Reaktion gezwungen und setzte die bilateralen Veranstaltungen aus.[7] Der Direktor des Moskauer Carnegie-Zentrums, Dmitrij Trenin, der in der Regel gut darüber informiert ist, was im Kreml gedacht wird, sieht auch diese Wende in der neuen Sicherheitsstrategie begründet. Er hält die Strategie für einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zur formalen Ablehnung der liberalen Phraseologie der 1990er Jahre und der Ersetzung der „westlichen“ Moral durch Standards, die auf eigenen russischen Traditionen beruhen. Mehr noch: Für Trenin bildet die Strategie gar das „Manifest einer neuen Epoche“.[8]
Genau dreißig Jahre nachdem die Sowjetunion auf dem Höhepunkt ihrer militärischen Macht und ohne äußere Einwirkung zerfallen sei, habe Russland den Status einer Großmacht wiedererlangt, glaubt man nicht nur im Kreml. Nun habe „die russische Führung allen Grund, sich mit den offenkundigen inneren Schwächen zu beschäftigen“, so Trenin. Ignoriert wird bei diesem Glauben an die Wiedererlangung einstiger Größe allerdings die Tatsache, dass die USA über ein dreizehn Mal größeres Bruttoinlandsprodukt (BIP) verfügen. Russlands Anteil an der Weltindustrieproduktion liegt bei lediglich zwei Prozent, 1913, vor dem Ersten Weltkrieg, waren es schon einmal fünf Prozent. Und in der Statistik des BIP pro Kopf kommt der russische Staat hinter Surinam und Gabun erst auf Platz 73.[9] Dessen ungeachtet malt die neue Sicherheitsdoktrin ebenso bunte wie unkonkrete Bilder über die ökonomische Zukunft Russlands, dessen Wirtschaft, so hofft man dort, schneller als das weltweite Mittel wachsen werde.[10]
Die Wahl zur Staatsduma als Legitimierungsritual der Mächtigen
Die Verschärfung des repressiven Charakters des Putin-Regimes im Innern begann allerdings schon, während im russischen Sicherheitsrat noch an der neuen Doktrin gefeilt wurde. Der Trend war bereits im Frühjahr 2020 zu beobachten, als die Verfassung geändert und jene Gesetze verabschiedet wurden, die die Grund- und Freiheitsrechte der Bürger beschränken. Nun setzt er sich allerdings verstärkt fort. Die Mächtigen in Russland reagieren damit auf die Tatsache, dass sich der sogenannte Krim-Konsens von 2014/2015 zwischen der Putin-Führung und der Gesellschaft erschöpft hat, wie die russische Politologin Tatjana Woroscheijkina analysiert.[11] Seinerzeit hatten viele Russen die Annexion der ukrainischen Halbinsel begrüßt, und Putins Popularität wuchs an. Lange vor den jetzt anstehenden Wahlen hatte der Kreml deshalb das Feld der tatsächlichen oder vermeintlichen Opponenten der „Partei der Macht“, wie Putins Partei „Einiges Russland“ auch genannt wird, bereinigen lassen. Kandidaten der „nichtsystemischen“, also vom Kreml nicht zugelassenen Oppositionsparteien wurden landesweit hundertfach vom Urnengang im September ausgeschlossen. Oft wurden sie mit Hilfe überaus fadenscheiniger Anklagen vor Gericht gestellt oder allein durch die Drohung mit einem Verfahren zum Aufgeben gedrängt.
Für den Politologen Andrej Kolesnikow sind Wahlen in Russland ohnehin nur ein „Ritual“ zur Legitimierung der aktuellen Machthaber. Der Bevölkerung werde nahegelegt, für die Partei „Einiges Russland“ zu stimmen und dass es besser sei, sich bei der Mehrheit und damit bei der „Herde“ zu halten. Auch bei diesen Wahlen strebt „Einiges Russland“ wieder die absolute Mehrheit in der 450köpfigen Duma an, um jederzeit Eingriffe in die Verfassung vornehmen zu können. Es gibt kaum Zweifel, dass sie dieses Ziel auch erreichen wird, wenngleich die Aggressivität, mit der die Behörden gegen die nichtsystemische Opposition vorgehen, auf eine tiefsitzende Verunsicherung schließen lässt. Von der systemischen, vom Kreml zugelassenen Opposition – KPRF, LDPR und Gerechtes Russland – geht indes keine Gefahr für das System aus. Sie sind Kolesnikow zufolge „Abteilungen der Administration des Präsidenten“.[12]
Die zentrale Hassfigur in den Augen der Staatsmacht ist zweifellos Alexej Nawalny, der seit Jahren mit seiner Antikorruptions-Stiftung (Fond borby s korrupzijej – FBK) die Bestechlichkeit hoher und höchster Staatsfunktionäre enthüllt hatte. Nach einem fehlgeschlagenen Giftanschlag, den er mit Hilfe deutscher Ärzte nur knapp überlebte, sitzt er seit seiner Rückkehr nach Russland im Gefängnis; seine FBK wurde für illegal erklärt. Ihr Chef, Dmitrij Wolkow, lebt inzwischen im Ausland und die Mitarbeiter der regionalen Organisationsstäbe werden strafrechtlich verfolgt.
Auch im Medienbereich, den der Kreml bereits weitgehend unter Kontrolle gebracht hat, spielen sich letzte Gefechte ab. Die Beseitigung kritischer Stimmen und um Objektivität bemühter Medien ist in den Monaten vor der Parlamentswahl in ein entscheidendes Stadium getreten. So musste das russische Onlinemedium „VTimes“ nach nur einjähriger Tätigkeit aufgeben, nachdem es im Mai 2021 vom russischen Justizministerium auf die Liste der „ausländischen Agenten“ aufgenommen worden war. Abgesehen von finanziellen Problemen wird „VTimes“ durch das Agenten-Label in die Nische der politischen Opposition gedrängt – dabei sei dies nie so konzipiert gewesen, beklagt die Redaktion in einer Abschiedserklärung.[13]
Zuvor hatte bereits das Nachrichten-Portal „Newsru.com“ nach 21 Jahren seine Arbeit einstellen müssen. Seit 2014 habe sich die Lage im Land grundsätzlich zu verändern begonnen, bilanziert die Redaktion: „Immer öfter mussten wir über die Annahme einschränkender Gesetze berichten, die in jedem Moment auch uns selbst betreffen konnten. Immer mehr angesehene Persönlichkeiten und Quellen wahrhaftiger Informationen mussten wir als ausländische Agenten und Extremisten markieren. Die Situation, die in der Wirtschaft und auf juristischem Felde entstanden ist, macht es ‚Newsru.com‘ unmöglich, weiterhin Qualitätsarbeit zu leisten.“[14]
Betroffen sind auch die Online-Rechercheplattform „Projekt“ und das Investigativ-Medium „The Insider“. Auch ihnen wurde der Status „ausländischer Agent“ verliehen, was eine journalistische Tätigkeit praktisch unmöglich macht. Fünf „Projekt“-Mitarbeiter wurden sogar persönlich zu „ausländischen Agenten“ erklärt. Damit sind sie verpflichtet, „nicht nur alle Einnahmen, sondern selbst ihre täglichen Ausgaben dem Staat zu melden“.[15]
Geschichtsschreibung im nationalen Interesse
Eine Sonderbehandlung erfahren Historiker, die mit der offiziellen, von Präsident Putin vorgegebenen Geschichtsbetrachtung nicht konform gehen. Im Zentrum der Verfolgung steht die Menschenrechtsorganisation „Memorial“ mit ihren regionalen Ablegern, die sich seit dem Ende der Sowjetunion der Erforschung des sowjetischen totalitären Erbes verschrieben hat. Unter Putin wurde auch sie als „ausländischer Agent“ eingestuft, einzelne Mitglieder werden gerichtlich verfolgt. So wurden etwa Alexander Gurjanow von der polnischen Kommission von „Memorial“ gerichtliche Schritte angedroht. Der Historiker erforscht die sowjetischen Repressionen der 1930er und 1940er Jahre. Und Jurij Dmitrijew von der karelischen Abteilung von „Memorial“, der das Andenken an die Opfer der Repressionen in Karelien aufrechterhalten will, wird mit fabrizierten Anklagen wegen angeblichen Kindesmissbrauchs überzogen.[16] Schon 2014 war Andrej Subow, ein angesehener Historiker und Kenner der Geschichte der orthodoxen Kirche, aus dem Moskauer staatlichen Institut für internationale Beziehungen (MGIMO) entlassen worden, unter anderem weil er die russische Besetzung der Krim scharf kritisiert und sie mit dem „Anschluss“ Österreichs an Hitler-Deutschland im Jahr 1938 verglichen hatte. Andrej Petrow, Dozent an der Staatlichen Universität Irkutsk, wiederum verlor seine Arbeitsstelle, weil er historische Spaziergänge durch seine Heimatstadt organisierte, deren inhaltliche Aussagen der Obrigkeit missfielen. Und Jurij Piwowarow, Mitglied der russischen Akademie der Wissenschaften und ehemaliger Direktor des Moskauer Instituts für wissenschaftliche Information für Gesellschaftswissenschaften (INION), der sich derzeit zur medizinischen Behandlung in Deutschland aufhält, wird wegen seiner kritischen Haltung zum politischen System in Russland verfolgt.
Letztlich geht es bei all dem darum, das kulturelle und geistige Leben Russlands in ein monolithisches Denkgebäude zu verwandeln. In diesem Sinne hat auch eine soeben ins Leben gerufene „Sonderkommission“ unter Leitung von Ex-Kulturminister Wladimir Medinski, die sich vorwiegend aus Geheimdienstlern, Staatsanwälten und Militärs zusammensetzt, den Auftrag, die offizielle Kreml-Sicht in der Geschichtsschreibung durchzusetzen. Im Gegensatz zur Vorgänger-Kommission von 2009 wurde dabei auf die Mitwirkung von Abgeordneten, Vertretern aus dem Kunst- und Kulturbereich oder Historikern weitgehend verzichtet. Die Kommission, so heißt es in der Anordnung des Präsidenten, habe die Aufgabe, „einen systematischen und offensiven Ansatz zur Wahrung der nationalen Interessen zu gewährleisten“. Dazu gehöre die Bewahrung der „historischen Erinnerung“, die von ausländischen Strukturen angegriffen würde, „zum Schaden der nationalen Interessen Russlands in der Sphäre der Geschichtsschreibung“.[17]
Fest steht: Die russische Führung hat mit ihren jüngsten restriktiven Entscheidungen, in deren Zentrum die Strategie der nationalen Sicherheit steht, den autoritären Druck im Innern des Landes noch einmal deutlich erhöht. Gleichzeitig hat der Kreml zahlreiche der noch existierenden Verbindungen nach Westeuropa gekappt oder genau das in Aussicht gestellt. Auch wenn man Trenins Worten von der „neuen Ära“ nicht unbedingt folgen mag, so wird doch überaus deutlich: Wir haben es mit einer Zäsur in den Beziehungen Russlands zum Westen zu tun, deren Auswirkungen noch gar nicht in vollem Umfang abzuschätzen sind. Eines hat Putins neue Sicherheitsdoktrin indes unmissverständlich klargestellt: Für den Kreml steht der Feind im Westen – das ist jetzt Staatsräson.
[1] Следственный комитет проверяет спектакль «Первый хлеб» с Лией Ахеджаковой. В постановке «Современника» ищут оскорбление ветеранов и «неприкрытую пропаганду однополой любви, www.meduza.io, 30.7.2021.
[2] Die Repertoires der Theater werden auf Übereinstimmung mit der Strategie der nationalen Sicherheit überprüft, in: „RIA Nowosti“, 2.8.2021.
[3] Putin bestätigte die Strategie der nationalen Sicherheit, www.tass.ru, 3.7.2021.
[4] Der Präsident bestätigt die Strategie der nationalen Sicherheit, www.kremlin.ru, 2.7.2021.
[5] Ebd.
[6] Wladimir Iwanow, Von Feinden umringt, im Griff fremder Kulturen, in: „Njesawissimaja Gaseta“, 15.7.2021.
[7] Aussetzung der bilateralen Veranstaltungen des Petersburger Dialogs, Presseerklärung vom 27.7.2021, www.petersburger-dialog.de.
[8] Dmitrij Trenin, Russia’s National Security Strategy: A Manifesto for a New Era, www.carnegie.ru, 6.7.2021.
[9] Vgl. Manfred Quiring, Russland. Auferstehung einer Weltmacht?, Berlin 2020, S. 207.
[10] Der Präsident bestätigt die Strategie der nationalen Sicherheit, www.kremlin.ru, 2.7.2021.
[11] Tatjana Woroschejkina, Nawalny, die Politik und die Moral. Das Putin-Regime und die Gesellschaft, in: „Osteuropa“, 3/2021, S. 29-38.
[12] Diskussion. Wahlen als Ritual, www.newtimes.ru, 26.7.2021.
[13] Vtimes, www.dekoder.org.
[14] Dank an alle, die im Verlaufe von 21 Jahren mit uns waren, www.newsru.com, 31.5.2021.
[15] Pavel Lokshin, Die dunkelste Stunde der Repression, www.welt.de, 23.7.2021.
[16] Vgl. Olesja Pawlenko, Verbrechen gegen die Geschichte (Prestuplenije protiw istorii), in: „Nowaja Gaseta“, 11.6.2021.
[17] Федеральные ведомства, в том числе силовые структуры, приступают к работе по унификации истории, www.echo.msk.ru, 31.7.2021.