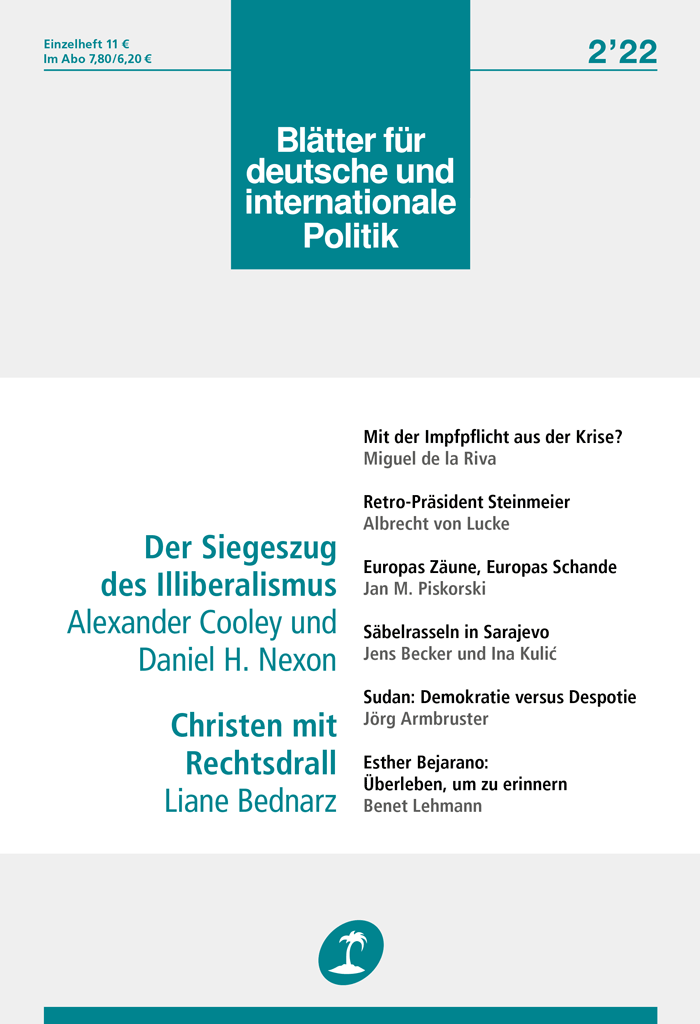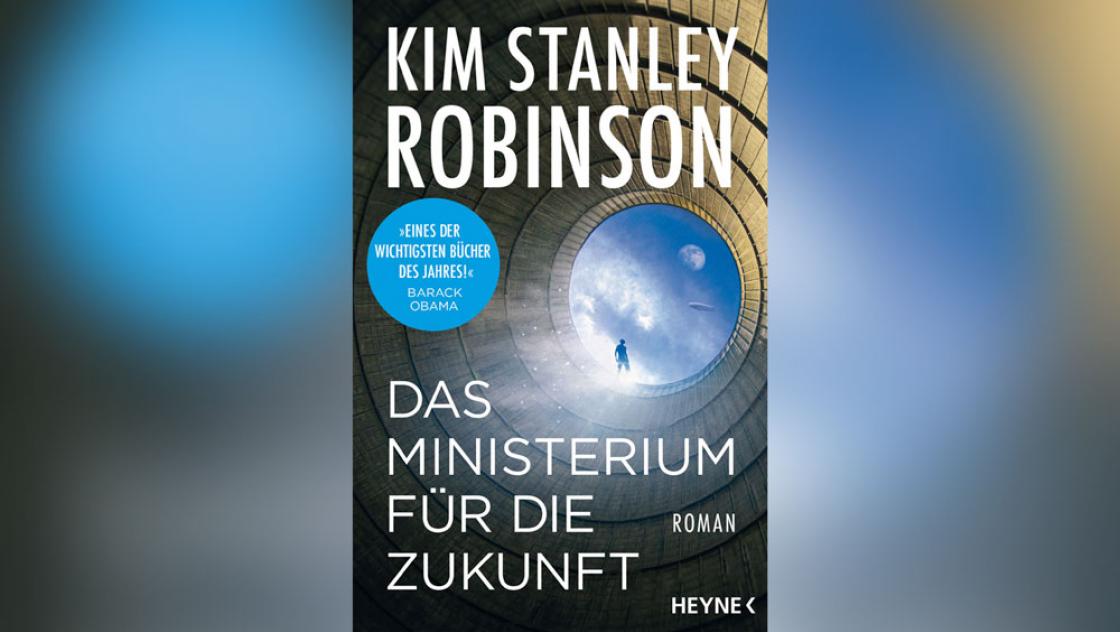
Bild: Kim Stanley Robinson: Das Ministerium für die Zukunft (Heyne Verlag)
Quälend langsam geht der Kampf gegen die Erderhitzung voran. Allzu oft droht wirksamer Klimaschutz zwischen nationalen Rivalitäten, gesellschaftlichen Beharrungskräften und dem Lobbydruck der fossilen Industrien zerrieben zu werden. Nicht nur unter Aktivistinnen und Klimaforschern wachsen Sorge und Skepsis, wenn nicht gar Resignation. Da kommt die deutsche Übersetzung eines Romans gerade recht, dessen amerikanisches Original bereits als visionäre Darstellung eines gelingenden globalen Umsteuerns gefeiert wurde. Barack Obama pries „Das Ministerium für die Zukunft“ als eines der besten Bücher des Jahres 2020.
Verfasst hat dieses weltumspannende Panorama der Science-Fiction-Autor Kim Stanley Robinson, der bei Genrefans Anfang der 1990er Jahre mit seiner Mars-Trilogie populär geworden ist. Schon dort interessiert er sich für die Verbindung von technisch-naturwissenschaftlichen und sozialen Utopien. In seiner Schilderung, wie eine internationale Mars-Expedition den Roten Planeten terraformt, also in einen blauen Planeten mit für Menschen lebensnotwendiger Atmosphäre und Vegetation verwandelt, greift er ausgiebig auf Modelle der NASA zurück. Zugleich lässt er fröhliche Bakunin-Anhänger, sozialistische Revolutionäre und andere Freigeister für die Unabhängigkeit von den terrestrischen Multis streiten und schließlich eine Revolution wagen.
In seinem neuen Buch ist die Utopie im Wortsinne geerdeter, aber auf ihre Weise nicht minder revolutionär. Es erzählt von den entscheidenden Jahren zwischen 2025 und 2050: Nach mageren Ergebnissen auf den Weltklimakonferenzen greift eine Gruppe von Staaten auf eine – tatsächlich vorhandene – Bestimmung im Pariser Klimavertrag zurück, interpretiert diese allerdings eher freihändig: Statt, wie im Vertrag vorgesehen, einen Ausschuss einzurichten, gründet sie eine Organisation mit eigenem Budget, die die Rechte künftiger Menschen und Lebewesen vertreten soll. Diese von einem Journalisten „Zukunftsministerium“ getaufte Institution nutzt fortan ihren Status als UN-Behörde, um auf politische, juristische, wirtschaftliche und technologische Weise für Klimaschutz zu kämpfen. Ihre Leiterin Mary Murphy, eine pragmatische Idealistin, ist eine von zwei Protagonisten des Romans. Daneben tritt der US-Amerikaner Frank May als das schlechte Gewissen der meist diplomatischen Mary. Er hat als junger Entwicklungshelfer in Indien nur knapp eine verheerende Hitzewelle überstanden, bei der 20 Millionen Menschen starben. Plastisch schildert Robinson, was die Kombination aus Hitze und hoher Luftfeuchtigkeit mit dem menschlichen Körper anrichtet, wobei er reale Szenarien zu einer alptraumhaften Sequenz verdichtet. Schwer traumatisiert verliert Frank den Glauben an eine schrittweise Lösung der ökologischen Krise. Zugleich ist er ein schuldlos Schuldiger, der mit seinem Überleben wie mit dem verheerenden ökologischen Erbe des Westens hadert und an der psychischen Last des Klimawandels zerbricht.
Neben den zwei Protagonisten kommen in kurzen Monologen zahlreiche namenlose Akteure zu Wort, darunter Klimaflüchtlinge, indische Biobauern und Antarktisforscher. Mit dieser Montage aus längeren Erzählpassagen, Monologen und diversen knappen theoretischen Exkursen unterstreicht Robinson schon formal die zentrale Grundannahme seines Buches: Die eine Lösung der Klimakrise kann es nicht geben. Vielmehr gilt: „Gut ist, was gut für die Biosphäre ist.“ Als die Romanhandlung Anfang der 2050er Jahre nach vielen Rückschlägen mit einem großen Etappenerfolg endet, dem dauerhaften Rückgang der weltweiten CO2-Emissionen, und das Pariser Abkommen rückblickend als „Gezeitenwechsel“ hin zu einem „guten Anthropozän“ gewürdigt wird, ist das dem zeitgleichen, aber oft unverbundenen Handeln vieler Akteure auf ganz unterschiedlichen Feldern zu verdanken. Dazu zählen neben Umweltschützern und UN-Diplomatinnen auch Zentralbankerinnen und Militärs.
Echte Klimagerechtigkeit
Überhaupt schert sich Robinson, der sich gegen die Bezeichnung Ökosozialist nicht wehren würde, angesichts der heraufziehenden Katastrophe wenig um ideologische Reinheit. Obwohl er etwa um die Kritik am Geoengineering weiß und auch die Risiken und offenen Fragen von derart massiven Eingriffen in Ökosysteme benennt, schildert er im Buch mehrere Beispiele von funktionierenden technischen Lösungen: Gigantische Pumpensysteme bremsen das Abgleiten der antarktischen Gletscher und damit den Anstieg des Meeresspiegels, künstlich angelegte Meerwasser-Seen halten in der Sahelzone die Wüstenbildung auf. Solche wissenschaftlichen Großexperimente erachtet Robinson in unserer dramatischen Lage schlicht als nötig.
Den tiefgreifendsten Wandel hin zu echter Klimagerechtigkeit imaginiert er aber als eine glückliche Verbindung von Protestbewegungen, progressiver Regierung und Graswurzelansätzen: In Indien übernimmt nach der Hitzekatastrophe eine neue Partei die Regierungsgeschäfte und verbreitet die Best Practice aus verschiedenen Bundesstaaten im ganzen Land: traditionelle nachhaltige Landwirtschaft aus Sikkim, demokratische Selbstverwaltung aus Kerala, digitale Technologie aus Bengaluru. Der Subkontinent wird damit weltweit zum Klimavorreiter. An dieser wie an anderen Stellen greift Robinson bereits vorhandene Konzepte auf und spielt sie exemplarisch durch. Er präsentiert aber auch originelle eigene Ideen, wie den vom Zukunftsministerium entwickelten und von den wichtigsten Zentralbanken der Welt gestützten, digitalen „Carbon Coin“, der für jede Tonne Kohlenstoff ausgezahlt wird, die nachweislich im Boden verbleibt. So kommen ländliche Gemeinden im globalen Süden zu Wohlstand, indem sie CO2binden.
Robinson schärft auch den Blick für das notwendigerweise tastende, von Rückschlägen begleitete Vorgehen der globalen Klimapolitik. Er erinnert zudem daran, dass es neben den klimatischen auch gesellschaftliche Kipppunkte gibt: Politische Umschwünge, Veränderungen im Finanzwesen, technologische Innovationen oder Gerichtsurteile können die Menschheit geradewegs auf einen Pfad führen, der in eine nachhaltige Zukunft weist.
Neben dem titelgebenden Zukunftsministerium tritt im Buch frühzeitig eine ökoterroristische Gruppe aus Überlebenden der indischen Hitzewelle auf den Plan. Die „Children of Kali“ bringen den weltweiten Flugverkehr nahezu dauerhaft zum Erliegen, indem sie an einem einzigen Tag 60 Maschinen durch simultane Drohnenangriffe zum Absturz bringen. Früher oder später werde eine solche Militanz wohl kommen, so Robinson im Gespräch mit dem „Green Europe Journal“. Die entscheidenden Hebel für Veränderungen, betont er, sind aber „Wissenschaft und Politik“.
Auf der Erde des Jahres 2050, wie Robinson sie sich vorstellt, sind die Meere zwar immer noch übersäuert und ist ein Großteil des arktischen Eises geschmolzen. Zugleich aber sind die Erfolge unübersehbar: Wachsende Energieproduktion führt dank der Umstellung auf Sonne und Wind nicht länger zu höheren CO2-Konzentrationen in der Atmosphäre. Weite Teile der Landmasse sind renaturiert worden und bieten Lebensraum für eine wieder steigende Zahl an Wildtieren. Auf den Weltmeeren fahren große Segler mit Solarantrieb, die durch den Einsatz von KI besonders aerodynamisch gestaltet sind; auch Luftschiffe haben eine Renaissance erfahren. Gleichzeitig werden vielerorts die Höchsteinkommen nach oben begrenzt und Arbeitsplatzgarantien eingeführt. Immer mehr wichtige Ressourcen sind Gemeingüter. Ein vom Zukunftsministerium entwickeltes dezentrales soziales Netzwerk garantiert Datensicherheit und hat zu einem verstärkten planetarischen Bewusstsein beigetragen. Erster sichtbarer Ausdruck dessen sind Weltbürgerrechte für Flüchtlinge.
Die Menschheit stellt sich „immer nur Aufgaben, die sie lösen kann“, schrieb einst der Geschichtsoptimist Karl Marx, weil „die Aufgabe selbst nur entspringt, wo die materiellen Bedingungen ihrer Lösung schon vorhanden oder wenigstens im Prozess ihres Werdens begriffen sind.“ Unter dem Eindruck der so menschenfreundlichen wie zupackend-pragmatischen Vision eines Kim Stanley Robinson möchte man dem auch mit Blick auf den Klimawandel zustimmen.
Kim Stanley Robinson: Das Ministerium für die Zukunft. Roman. Aus dem Amerikanischen von Paul Bär. Heyne, München 2021, 720 S., 17 Euro.