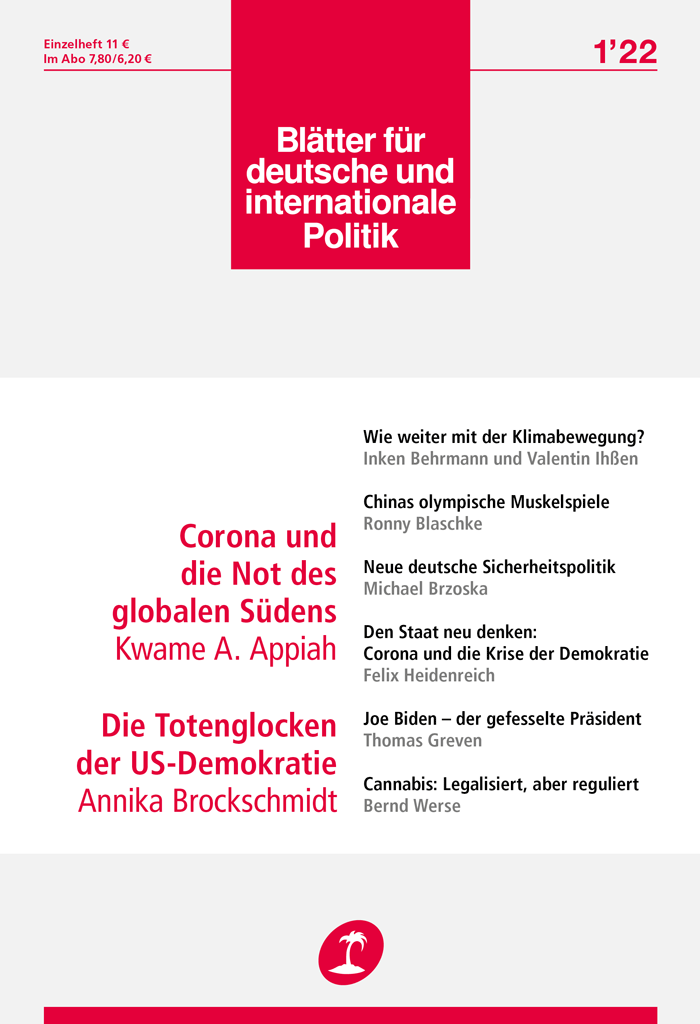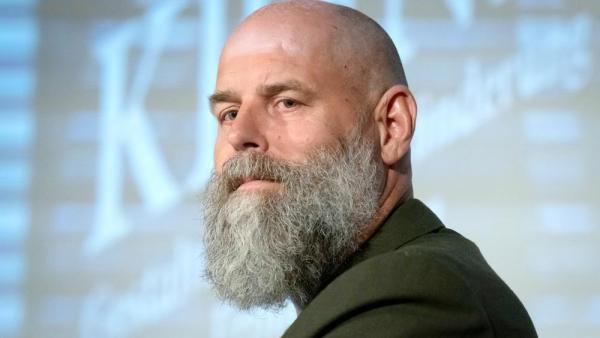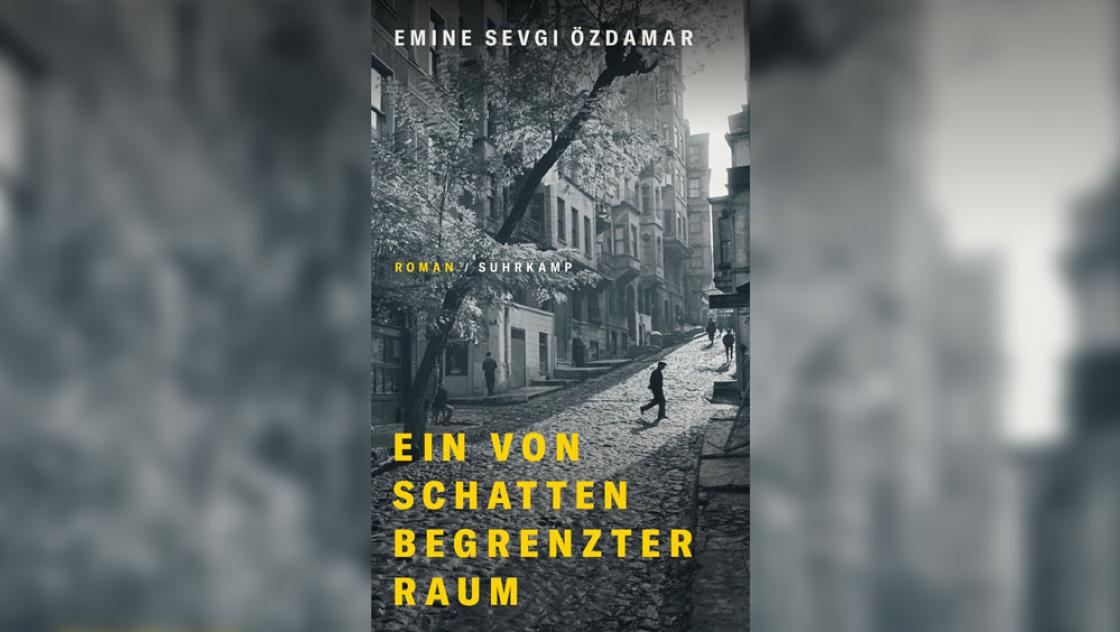
Bild: Emine Sevgi Özdamar: Ein von Schatten begrenzter Raum
Geschichte erzählt Emine Sevgi Özdamar von unten, dort wo der Preis gezahlt wird für die große Historie. Das tut Özdamar selbst dann, wenn sie auf dem Höhenkamm mit großen Künstlern wandert. Ihr Leben zickzackt dorthin, wo die Hölle gerade mal Pause macht. Wo kein Krieg ein „großes Festmahl für Würmer“ auftischt oder ein Diktator bestimmt. Unter ihren Füßen fühlt sie das vergossene Blut aus der Zeit, als an ihrem jeweiligen Wohnort die Hölle tobte. Sie sieht die Bombenlücken im geteilten Berlin oder spürt die Anwesenheit der ermordeten Armenier in der Türkei.
Wie im Märchen ist die Welt in ihrem neuen Buch „Ein von Schatten begrenzter Raum“ vermenschlicht: Die Moskitos singen im Chor, Krähen sprechen, ebenso die „Orthodoxkirche“ in der Türkei, die nur ab und zu von Griechen besucht wird, die das Glaubenshaus ihrer vertriebenen Vorfahren sehen wollen. Auch die Gefallenen aus den Kriegen und Massakern sprechen, etwa der Soldat mit dem Kopf unterm Arm. „Orientalisch“ nennt man das zuweilen, mir erscheint es exemplarisch für viele Geschichten von den Rändern, die man in einigen Vierteln in den Metropolen hört. Aus Erzählungen aus der schlesischen Heimat meiner Vorfahren mütterlicherseits kenne ich das oder – für alle nachzulesen – aus den Büchern der polnischen Literaturnobelpreisträgerin Olga Tokarczuk, die in Niederschlesien spielen.