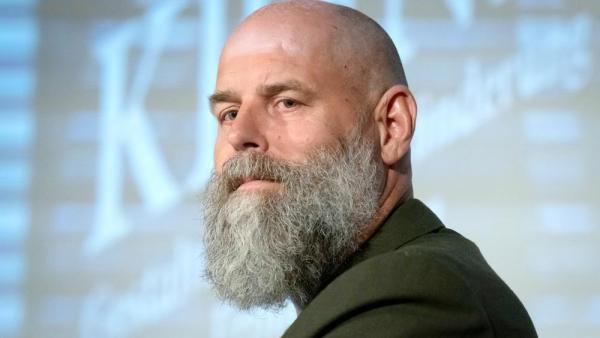Wie die Kritik an linker Identitätspolitik in rechtes Identitätsdenken kippt

Bild: Dawid Małecki via unsplash
Rund um die Kritik an linken Identitätspolitiken hat sich hierzulande und anderswo ein ganzes Medien- und Publikationsfeld gebildet. Das Anprangern von „Woke*-Wahnsinn“[1] ist zum Geschäftsmodell geworden. Auch Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen beteiligen sich an diesem Furor, der mit der monothematischen Manie des fundamentalistischen Teils der anderen Seite locker mithält.
Mit der ominösen Wokeness hat der Konservatismus ein in seinen Augen willkommenes Abgrenzungsnarrativ gefunden. Dabei kommt es unter dem Label des Pluralismus zur Akzeptanz von Allianzen, die offensichtlich genutzt werden, um rechtes Identitätsdenken zu propagieren. Ja, mehr noch: In einer Art Übersprungshandlung, hervorgerufen auch durch die eigene Ideen-losigkeit, greifen selbst (im demokratietheoretischen Sinn) republikanisch orientierte Autoren zunehmend auf das Vokabular rechten Denkens zurück. So ist im internationalen Diskurs der längst überwunden geglaubte Nationalismusbegriff wieder en vogue, was die selbsterklärten rechten Gegner von Pluralismus und Gewaltenteilung nur erfreut. Sie streben ganz gezielt solche Allianzbildungen aktiv an, wobei der angebliche Kampf gegen identitätspolitisch-moralisierende Bevormundung als argumentatives Einfallstor bis hin zu liberalen Milieus dient. Das Ziel ist die Erlangung rechter Diskurshegemonie unter dem Deckmantel einer angeblichen Freiheitsorientierung.
Auf den ersten Blick scheint Kritikern der Identitätspolitik die Abgrenzung vom rechten Populismus sehr wichtig zu sein. So distanziert sich etwa die neue konservative „Denkfabrik Republik 21“ rund um den Historiker Andreas Rödder und die ehemalige CDU-Ministerin Kristina Schröder in einem programmatischen „Manifest“[2] explizit vom linken und rechten Identitätsdenken und warnt vor einer dadurch bewirkten „Polarisierung der Öffentlichkeit“. Jedoch wurden auf der hauseigenen Tagung zum Thema „Wokes Deutschland – Identitätspolitik als Bedrohung unserer Freiheit?“ kritiklos Akteur:innen präsentiert, die wenig Berührungsängste aufweisen oder selbst für eine radikal-polarisierende Marschrichtung stehen.[3] Judith Sevinç Basad arbeitet für den Youtube-Krawallkanal des ehemaligen Bild-Machers Julian Reichelt. Sandra Kostner und Susanne Schröter (eine Initiatorin von R21) gehören dem siebenköpfigen Vorstand des Netzwerks Wissenschaftsfreiheit an, zu dem mit dem Juristen Gerd Morgenthaler auch ein dezidierter Rechtsaußen gehört, der mit den Gleichgesinnten Max Otte und David Engels die Oswald-Spengler-Gesellschaft leitet. Kristina Schröder wiederum macht Reichelts Medienformat hoffähig, indem sie sich im Januar ausführlich vom Mitarbeiter Ralf Schuler (ehemals „Bild“) interviewen lässt.[4] Bei Viktor Orbáns Regime-Thinktank Mathias Corvinus Collegium (MCC) erläutert Schuler freimütig, dass Reichelts Auftritte analog zur Show des bekannten ehemaligen Fox-News-Propagandisten Tucker Carlson stünden, während sein eigenes Interviewformat andere Zuschauervorlieben bediene.[5] Die MCC-Konferenz „The Future of Publishing“ war ein Stelldichein der internationalen rechtsradikalen Medienszene, aber auch Konservative kamen.[6] Mit diesen Verbündeten möchte Orbán, wie er im August 2022 auf der rechtsradikalen CPAC-Konferenz in Dallas ausführte, in den „Kulturkrieg“ gegen den „Woke Globalist Goliath“ ziehen.[7]
Dem Aufzeigen derartiger Strukturen wird gerne mit dem Vorwurf begegnet, auf „Kontaktschuld“ zu rekurrieren – als wüssten die Beteiligten nicht, mit wem sie es zu tun haben. Ganz offensichtlich ist es die Taktik rechter Akteure, sich mit (liberal-)konservativen Kritikern linker Identitätspolitik gemeinzumachen und wahlweise deren pluralistische Impulse oder gespielte Naivität auszunutzen. Wer gegen das angebliche Canceln ist, tut sich naturgemäß schwer bei der Abgrenzung, so das Kalkül. Rechte Aktivisten wie Morgenthaler, Engels, Ulrich Vosgerau, Heinz Theisen, Harald Seubert (alle im Netzwerk Wissenschaftsfreiheit) oder eben Viktor Orbán machen sich das zunutze. Portale wie „Achtung Reichelt“, „Tichys Einblick“, „Achse des Guten“ oder „Bild.TV“ garantieren Zuspruch und Applaus, sodass auch für die schlicht aufmerksamkeitsheischenden Milieus, die sich dazugesellen, etwas geboten wird. Es konsolidiert sich eine mit Fox-News vergleichbare Szene, für die linke Identitätspolitik als wichtiger Teil eines negativen Gründungs- und Selbstvergewisserungsmythos fungiert.
Etwas Besseres hätte Rechtsidentitären auch nicht passieren können. Die Angriffspunkte gegen linkes Identitätsdenken, das sich freilich aus emanzipatorischen Motiven speist, liegen schließlich auf dem Tisch. Zu offensichtlich ist der Befund, dass positive Diskriminierungen durch Quoten, Fälle extensiver Aneignungsverbote (bis hin zum Reggae) sowie Opfergruppenbildungen, die über emanzipatorische Gleichheitsansprüche hinausgehen, mit eben jenem Gleichheitsanspruch in der Demokratie kollidieren (können). Wenn Argumente nur noch von bestimmten Personen und mit ausgefeilter Geheimbegrifflichkeit legitim vorgetragen werden dürfen, verliert die politische Öffentlichkeit ihr Allgemeinheitserfordernis. So weit, so einleuchtend. Das Geschäft vieler Kritiker:innen besteht aber darin, einzelne Phänomene zu einem verzerrten Gesamtbild aufzubauschen und bestehende gruppenspezifische Benachteiligungen pauschal und kontrafaktisch in Bevorzugungen umzudeuten. Neben Geschäftssinn, emotionaler Aufwallung und populistischen Ambitionen ist dafür vor allem ein Faktor verantwortlich: die normative Ideenlosigkeit eines bürgerlich-konservativen Denkens, das seine Felle davonschwimmen sieht und sich deshalb gerne an ewig gleichen Abgrenzungsnarrativen abarbeitet.
Insofern besteht eine Hoffnung der Rechten darin, vermittelt über Allianzen bei der Kritik an der linken Identitätspolitik eine Diskurshoheit im inhaltlich verwaisten Spektrum des (Liberal-)Konservatismus zu erlangen. Deutschland hinkt hier noch etwas hinterher, denn international geht dieses Bemühen über eine rein negative Buzzword-Kritik an „Gender“, „Cancel Culture“ und „Wokeism“ hinaus. Analog zur Debatte über „Leitkultur“ zu Beginn des Jahrtausends erhält insbesondere ein noch stärker exkludierend-homogenisierender, von der Rechten seit einigen Jahren gezielt stark gemachter und eigentlich längst überwunden geglaubter Orientierungsbegriff Bedeutung: „Nationalismus“. Selbst Vertreter des liberal-konservativen Spektrums finden Gefallen an einer expliziten Bezugnahme darauf, wobei wie zur Rechtfertigung regelmäßig Gegensätze wie „liberaler“ oder „inklusiver Nationalismus“ beschworen werden. Die Antwort auf linke Identitätspolitiken besteht deshalb immer häufiger in einem letztlich reaktionären Identitätsdenken, das nur die Wahl zwischen Nationalismus pur (Orbán, PIS, Trump, Le Pen, Vox, FPÖ etc.) und dessen vermeintlich liberalen Abschwächungen lässt. Die Gefährlichkeit liegt darin, dass einerseits das verzerrte Bild einer linken Hegemonie gezeichnet wird, tatsächlich aber eine rechte Diskursverschiebung stattfindet, an der sich auch demokratische Akteure beteiligen, denen vor lauter Abgesangsrhetorik schlichtweg die Leitmotive ausgegangen sind.
Die Schriften Mark Lillas als Seismograph
Auf der Ebene politischen Denkens bilden die Schriften des US-amerikanischen Politikwissenschaftlers Mark Lilla einen hervorragenden Seismographen für die beschriebene Tendenz zur bewussten Aufweichung notwendiger Distinktionen. Dies gerade deshalb, weil Lilla nicht zu den offen gegen die Gewaltenteilung arbeitenden Wissenschaftler- bzw. Aktivistengruppen der sich selbst so bezeichnenden „Postliberals“[8] oder „National Conservatives“[9] gehört. Lilla beschäftigt sich sogar im Gegenteil mit der mitunter absurd rückwärtsgerichteten Wechselwirkung zwischen politischem Denken und gesellschaftlicher Entwicklung. In seinen Büchern wird der Hang europäischer Intellektueller zu totalitarismusfreundlichen und reaktionären Ideen thematisiert.[10] Er wäre damit eigentlich der geborene Beschreiber der Szene um rechte US-Wissenschaftler wie Patrick Deneen oder Adrian Vermeule, deren oft theokratisch inspirierter Antiliberalismus das Modell Orbán anpreist.[11] Dazu kann nämlich mit Lilla konstatiert werden, „dass die Versuchung, die politische Theologie wieder aufleben zu lassen, stets lebendig ist“.[12] Freilich blieben seine Arbeiten mit dieser Thematik trotz Übersetzung eher ein Fall für das Fachpublikum.
Einer größeren Öffentlichkeit wurde Mark Lilla hingegen mit seiner Kritik der Identitätspolitik bekannt. Sein Buch „The Once and Future Liberal“ aus dem Jahr 2017 markiert einen durchaus gehaltvollen Beitrag zur Debatte. Lilla wendet sich darin gegen den Subgruppismus des linken Identitätsdenkens, vergisst aber auch nicht, dass Nationalismus, Tribalismus und Autoritarismus identitätspolitische Gefahren von rechts darstellen.[13] Maßstab des Buches ist das klassische „Wir“ republikanischer Demokratietheorien, also die Einforderung eines gemeinsamen Bezugsrahmens politischen Handelns. Explizit bezieht sich Lilla auf eine liberale Tradition inklusiver Staatsbürgerschaft.[14] Streiten kann man über seine teils harsche Wortwahl („no one is interested in your personal testimony“)[15] und gewiss auch über seine recht monokausale Erklärung des Trumpismus als Gegenbewegung – ein Erklärungsmuster also, dass den Konservatismus tendenziell zu sehr aus der eigenen Verantwortung lässt. Lilla schreibt, wie er selber sagt, als „frustrierter amerikanischer Liberaler“, der sich gegen eine „Ideologie“ wendet, die dem liberaldemokratischen Amerika die integrative „Vision“ für alle verbaue:[16] partikularistische Identitätspolitik von links. Dass nun aber speziell ein neuer Nationalismus keine demokratisch angemessene Programmatik darstellt, hat Lilla an anderer Stelle eigentlich deutlich gemacht. In seinem 2016 erschienenen Buch über den „Geist der Reaktion“ benennt er den „Nationalismus“ explizit als Kernelement reaktionären Denkens seit der Französischen Revolution.[17] Die „ideologischen Massenbewegungen des 20. Jahrhunderts wie Marxismus, Faschismus und Nationalismus“ seien „‚politische Religionen‘, komplett ausgestattet mit Propheten, Priestern und Tempelopfern“.[18] Die Sache schien also klar zu sein. Ein republikanischer Theoretiker, der sich an den Leitideen von Alexis de Tocqueville und Hannah Arendt ausrichtet, übt Kritik an einem Partikularismus, der seines Erachtens die gleiche Staatsbürgerschaft und das geteilte Bürgerschaftsethos unterläuft, obwohl die antidiskriminierende Intention doch Gleichheit verspricht. Nun zeigen aber Lillas Publikationen nach 2017 paradigmatisch, dass die Frustration selbst diesen Autor in jene Gefilde tragen kann, die er in früheren Jahren ausgeleuchtet hatte. Lilla ist kein Rechter, aber er kokettiert mit der Rechten.
Lilla, Hobbes und Maréchal: Der Flirt mit der rechten Identitätspolitik
Mitentscheidend dafür dürfte das subjektive Eingeständnis des Scheiterns der eigenen Programmatik sein. In einem Text aus dem Jahr 2020 setzt sich Lilla mit der Zukunftsfähigkeit des „modernen demokratischen Patriotismus“ à la Tocqueville auseinander.[19] Es handelt sich um ein reines Abgesangsstück ohne jegliche zukunftsweisende Idee. Für Lilla ist der demokratische Staatsbürgerpatriotismus, den er selbst noch am Ende seines Buches über Identitätspolitik aus dem Jahr 2017 vertrat, nunmehr gestorben. Der diagnostizierten gesellschaftlichen Spaltung hat er drei Jahre später nichts mehr entgegenzusetzen, kritisiert aber weiterhin die angeblich alles überwölbende Moralisierung der Politik – diesmal in Anlehnung an Organismusanalogien (der Staat als „Körper“ mit defektem „Immunsystem“) und Hobbes: „All that’s left is a moralistic and emotive war of all against all“, so Lilla.
Der Ideengeschichtler spielt mit den offensichtlichen Bezugspunkten. Er weiß, dass Hobbes den vertraglichen Ausweg aus dem vermeintlichen „Krieg aller gegen alle“ in der fast totalen Unterwerfung sah, während Carl Schmitt nach zumindest vergleichbarer Diagnose und Moralisierungskritik aus der Not eine Tugend machte. Freund-Feind-Denken und innerstaatlicher Monismus waren Schmitts Antworten auf die angeblich durch den Liberalismus hervorgerufene Krise. Das bleibt jedoch im Text Lillas unausgesprochen, genauso wie er unterschlägt, welche partizipatorischen und pluralismuskompatiblen Integrationsmechanismen Tocqueville benennt (Gewaltenteilung, Föderalismus, Vereinigungen etc.). Lust am Abgesang, mangelnde Differenzierung und die geradezu störrische Verweigerung gegenüber prozeduralem Pragmatismus kennzeichnen Lillas jüngere Essays.
Darüber hinaus flirtet der Autor mit den Versatzstücken rechter Identitätspolitik. Im Dezember 2018 setzt er sich mit der französischen Rechten auseinander.[20] Lilla sieht hier einen für Kontinentaleuropa paradigmatischen Weg für einen möglichen neuen Konservatismus, der zwischen dem radikalen Rechtspopulismus und klassischen konservativen Parteien angesiedelt sei. Die von ihm ausgemachte, angeblich jenseits von Marine und Jean-Marie Le Pen agierende intellektuelle Strömung zeichne sich durch den Bezug auf eine „organische Konzeption von Gesellschaft“ aus, die man vom 19. Jahrhundert kenne. Das betreffe Rollen- und Pflichtenverständnisse in der Familie sowie die Ausrichtung an der „Perpetuierung des Lebens des zivilisatorischen Organismus“, also gerade die Ablehnung eines Gesellschaftsbilds, dass auf „autonomen Individuen, die Rechte tragen“ beruhe. Lilla ist explizit beeindruckt von der antiindividualistischen, antineoliberalen und antikosmopolitischen Ausrichtung dieser Weltsicht, die zudem offensiv den klassischen Links-rechts-Gegensatz überwinde. Kurzum: Er bietet eine positive Beschreibung gängiger Querfrontnarrative, wie sie rechtsradikale Öffentlichkeiten seit vielen Jahren anbieten. Zum reaktionären Bezug auf Organismusanalogien genügt der antiindividualistische, kapitalismuskritische und ökologische Tenor, den die von ihm beschriebenen französischen Jungintellektuellen anzubieten haben. Natürlich geschieht das mit einer routiniert beschreibenden Alibidistanz. Am Ende steht aber bei Lillas Analyse die Hoffnung, dass ein „erneuerter, eher klassisch organischer Konservatismus“ als „moderierende Kraft in den derzeit unter Stress stehenden europäischen Demokratien“ fungieren könne. Dafür setzt er auf Marion Maréchal, die gerade eine eigene private Bildungseinrichtung in Lyon gegründet hat (das ISSEP). Sie könne nach dem Vorbild Macrons eine integrative Bewegung von rechts bilden, so Lilla.
Einstweilen fungiert Maréchal jedoch als Stargast rechtsradikaler Akteure in Europa, etwa beim Thinktank Ordo Iuris in Polen, mit dessen Kaderschmiede Collegium Intermarium seit 2021 eine Kooperationsvereinbarung besteht.[21] Die Enkelin Jean-Marie Le Pens konnte Lilla mit ihrem knapp zehnminütigen Vortrag auf einer CPAC-Konferenz im Jahr 2018 beeindrucken.[22] Sie hätte sich darin gegen Egoismus und Individualismus gewandt, schreibt er.[23] Das ist Etikettenschwindel, denn es handelt sich um eine handelsübliche rechte Hetzrede, in der vor der Verletzung des „Naturrechts“ durch „Eugenik“, „Euthanasie“, „Transhumanismus“ und das „Gender-Theoriedelirium“ gewarnt und Trump gefeiert wird.
Ein geschlossen-überhöhtes Verständnis von Nation
Von der Sympathie für Organismusanalogien ist es nicht weit zu einem geschlossen überhöhten Verständnis von Nation, für das der Begriff „Natio-nalismus“ Pate steht. Schon im Jahr 2018 formuliert Lilla einen Gegensatz zwischen einem „ungesunden“ und einem vermeintlich „liberalen“ bzw. „gesunden Nationalismus“, bezieht sich dann aber explizit auf den „Republikanismus“ als Leitmotiv.[24] Im Oktober 2022 hält er einen später publizierten Vortrag, in dem die Nationalismusidee und andere rechtsidentitäre Leitmotive dann offener präsentiert werden.[25] Darin erklärt er, die normative Idee eines „liberalen Nationalismus“ zu teilen.[26] Er bezieht sich dabei auf den Journalisten David Brooks, der den Kampf der Ukrainer mit diesem Ideal verbindet.[27]
Lilla führt aus, der Nationalismus stünde auf einer grundsätzlichen Ebene den individualistischen Auswüchsen des Liberalismus entgegen. Allerdings glaube er nicht an eine Verwirklichung der Idee des „liberalen Nationalismus“ in westlichen Gesellschaften – und zwar nicht, weil der Nationalismus mit der demokratisch-pluralistischen Idee nicht kompatibel ist, sondern weil der Westen längst „verflüssigt“ sei. Hier bezieht er sich auf Zygmunt Baumans Gegenwartsdiagnose von der „Liquid Modernity“. Die Verflüssigung im Sinne einer Auflösung hergebrachter Ordnungsmuster ist laut Lilla das zentrale Problem westlicher Gesellschaften, nicht Xenophobie. Die zentrifugalen Kräfte in westlichen Gesellschaften hätten langfristig auch stärkere Auswirkungen auf die Ukraine und auf den Westen als der gegenwärtige Krieg, behauptet er gegen Ende seines Vortrags.[28] Wieder zeigt er sich monothematisch fixiert.
Die woke Bewegung als »größte Gefahr für unsere Gesellschaft«
Bei Lichte betrachtet erreicht Lilla damit das Niveau von Judith Sevinç Basad, die auf der eingangs erwähnten Tagung „Wokes Deutschland“ im November 2022 ausführt: „Ich glaube, dass die woke Bewegung gerade die größte Gefahr für unsere Gesellschaft darstellt.“[29] Denn unter Verflüssigung fasst Lilla einen bunten Strauß an Pluralisierungen und Liberalisierungen von Lebensstilen, die gemein haben, dem geschlossenen Denken in festen Ordnungsstrukturen entgegenzustehen. Der Soziologe Bauman hatte noch vor dem Nationalismus und verwandten monistischen Gesellschaftsmodellen gewarnt.[30] Das hindert Lilla nicht daran, ihn als Gewährsmann für die Anprangerung von individueller Emanzipation und gesellschaftlicher Pluralität anzuführen. Heutige Gesellschaften seien geprägt durch: soziale Probleme von Scheidungskindern, den Zerfall sozialer Institutionen, die Zurückdrängung familiärer, nationaler und religiöser Werte sowie eine Verflüssigung durch „neue Ideologien fluider psychosexueller Identitäten“.[31] Letzteres sei, selbstredend, der „dramatischste“ Bereich. Der für eine Demokratie notwendige Konservatismus sozialer Stabilität werde unterlaufen. Nimmt man Lillas jüngere Publikationen zum Maßstab, können nationalistische und organische Ordnungsvorstellungen hier Abhilfe schaffen. Gleichwohl distanziert er sich pflichtschuldig vom „Christian Integrism“ rund um Orbán, der ja nur ein Symptom der Krise sei.[32]
Bewusste Anbiederung an antipluralistisches und reaktionäres Denken
Lillas aktuelle Position hat in ihrer bewussten Anbiederung an antipluralistisches und reaktionäres Denken nur noch wenig gemein mit einem staatsbürgerlichen Republikanismus. Der rekurriert zwar auf Grenzziehungen und geteilte Zugehörigkeiten, hegt aber weder Verständnis noch Sympathie für die überkommenen Ideale geschlossener Gesellschaftsmodelle mit nur geringer Anerkennung von individuellen Freiheits- und Gleichheitsrechten. Pate für eine republikanische Position, die Freiheit im bürgerschaftlichen Verbund pluraler Individuen in den Institutionen einer gemeinsamen Öffentlichkeit denkt, stehen die Arbeiten von Alexis de Tocqueville und Hannah Arendt. Wenn Lilla als Ideengeschichtler die Bezüge anders setzt, geschieht dies ganz bewusst. Damit stehen seine jüngeren Arbeiten im Kontext von anderen aktuellen Theoriesträngen, die (auch in Abgrenzung von linken Identitätspolitiken) im Begriff des „Nationalismus“ zusammenfinden und damit trotz unterschiedlicher Ausgangspunkte zu einer Rehabilitierung rechten Identitätsdenkens beitragen.
Erstens: Aus einer vorgeblich „realistischen“ Perspektive wird analog zu Lillas jüngsten Ausführungen argumentiert, dass Demokratien den Nationalismus – laut Mearsheimer die „mächtigste politische Ideologie auf dem Planeten“[33] – als emotionales Bindeglied benötigen, um die zentrifugalen Kräfte des individualistischen Liberalismus zu bremsen. Linke Identitätspolitik stehe dem notwendigen nationalistischen Einheitsgefühl entgegen.[34] Nationalismus wird dabei explizit als kulturell fundiert aufgefasst und gerade nicht als „ziviler Nationalismus“, wobei der Nationalismus im Zweifel über liberale Werte obsiege.[35] Wunsch und Wirklichkeit vermischen sich bei solchen simplen Betrachtungen, da gegenläufige Tendenzen nicht einmal diskutiert werden.
Zweitens: Der Nationalismusbegriff wird zudem von einem kommunitaristisch orientierten Theoriestrang reakzentuiert, wobei sich diese Lesart heute mit der durch Yael Tamir gesetzten Ausrichtung am Modell des „liberalen Nationalismus“ überschneidet.[36] Dabei sind nuancierte Wandlungstendenzen hin zu einer stärkeren Betonung überkommener Ordnungsmodelle feststellbar. Im Jahr 1993 wandte sich Yael Tamir gegen kommunitaristische und ethnozentrische Ausformungen des Nationalismusbegriffs.[37] David Miller, ein Kommunitarier, bevorzugte für seine eigene normative Ausrichtung im Jahr 1995 noch den Begriff „nationality“ gegenüber dem Begriff „nationalism“ und wandte sich gegen statisch-konservative Verständnisweisen von Nation.[38] Diese Positionierungen erfolgten vor dem Hintergrund der Kosmopolitismusdebatte. Heute, wenn es um Identitätspolitik geht, wendet sich Tamir gegen „zivilen Nationalismus“ und betont die Notwendigkeit ethnischer und kultureller Homogenität für die Demokratie.[39]
»Nationalismus als Tugend«?
Drittens: Schließlich wird der Nationalismusbegriff heute von Rechtsradikalen und religiösen Fundamentalisten gebraucht, die sich intellektuell geben. „Nationalismus als Tugend“ heißt es programmatisch bei Yoram Hazony,[40] dem Vorsitzender der Edmund Burke Foundation. Die Stiftung veranstaltet die regelmäßig stattfindende National Conservatism Conference, auf der die Stars der Szene sowie dazugehörige Politiker und Politikerinnen des prinzipiell antiliberalen, theokratischen und antidemokratischen Spektrums auftreten. Kritik an linker Identitätspolitik ist für diese Kreise ein konstitutiver Ausgangspunkt, etwa wenn die Aktivistin Eva Vlaardingerbroek über „gender madness“ referiert und dann zur Verschwörungstheorie vom großen transhumanistischen Plan globaler Eliten übergeht.[41] Am Ende plädiert sie für eine Theokratie. Vlaardingerbroek ist regelmäßige „Expertin“ in den Medienformaten um Julian Reichelt.
Wer sich mit dem rechtsradikalen Feld beschäftigt, und das hat Mark Lilla ebenso getan, wie es der demokratische Konservatismus in den letzten Jahren notgedrungen tun musste, dem kann nicht entgehen, dass das Gemeinmachen mit rechtsidentitären Narrativen und Aktivist:innen dazu beiträgt, diese hoffähig zu machen. Die Kritik an linker Identitätspolitik hätte eine republikanisch-konservative Ausformung verdient, also ein Beharren auf institutionellen Gleichheitserfordernissen und allgemein zugänglicher Öffentlichkeit. Das Vorbringen inklusiver und antidiskriminierender Verfahrensweisen innerhalb eines solchen institutionellen Rahmens, also die offensive Formulierung von demokratischen Alternativen zur linken Identitätspolitik, ist jedoch intellektuell mühsamer als das plakative Bashing mit Bezug auf die immer gleichen Einzelbeispiele. Also wird gerne der einfache Weg gewählt – am besten in applaussichernden Räumen. Dadurch stärkt man aber nur die von rechtsradikaler Seite angestrebte Tendenz, in rechtes Identitätsdenken etwas Antitotalitäres hineinzuinterpretieren.
Die »egozentrische Borniertheit« des Nationalismus
Hannah Arendt, deren Kritik autonomistisch-subgruppistischer Freiheitsvorstellungen gegen heutige Identitätspolitiken angeführt werden kann, stand auch der Nationalismusvokabel aus guten Gründen ablehnend gegenüber. Sie spricht von der „egozentrischen Borniertheit“ des „Nationalismus“.[42] Bornierte Identitätsbildung steht ihrem Bild einer Öffentlichkeit, in der Gleiche von vorgegebenen Zuordnungen abstrahieren, um einen gemeinsamen politischen Handlungsraum zu bilden, entgegen. Wenn die Antwort auf Erscheinungsformen emanzipatorisch ausgerichteter Identität nun aber in einem reaktionär-identitären Denken besteht, besitzt eine derartige Engführung Konsequenzen, die bis hin zur grundsätzlichen Infragestellung von Gewaltenteilung und individuellen Rechten reichen. Der demokratisch-liberale Konservatismus hat hier gerade keine Wahl, sofern der ungarische, polnische oder US-republikanische Weg der rechten, antidemokratischen Identitätspolitik vermieden werden soll. Bei manchen Akteuren und Akteurinnen ist man sich freilich nicht so sicher. War am Ende irgendwie nur eine Notwehrreaktion, könnten sie sagen. Das kennt man irgendwoher.
Immerhin aber kündet das im Vergleich zum Vorgänger wesentlich ausgewogenere Programm zur jüngsten Tagung von Republik 21 davon,[43] dass die hier angemahnte Reflexion über notwendige Abgrenzungen inzwischen in vollem Gange ist.
[1] Vgl. Judith Sevinç Basad und Hans-Jörg Vehlewald, Woke*-Wahnsinn in Deutschland. Wie *wache Aktivisten bestimmen wollen, was wir noch sagen und tun dürfen, www.bild.de, 16.6.2021.
[2] Vgl. Denkfabrik R21, Wokes Deutschland – Identitätspolitik als Bedrohung unserer Freiheit?, www.denkfabrik-r21.de, 7.11.2022; siehe dazu auch Albrecht von Lucke, Ukrainekrieg und Klimakrise: Die geschürte Polarisierung, in: „Blätter“, 1/2023, S. 5-8, hier: S. 7 f.
[3] Vgl. den Mitschnitt der Veranstaltung, Denkfabrik R21, Wokes Deutschland – Identitätspolitik als Bedrohung unserer Freiheit?, www.youtube.de, 7.11.2022.
[4] Vgl. Schuler! Fragen, was ist, „Wir haben Menschen alleine sterben lassen“ – Kristina Schröder bei „Schuler! Fragen, was ist“, www.youtube.de, 19.1.2023.
[5] Vgl. Konferencia a Publikálás Jövőjéről – Üzleti modellek: Lehet-e nyereséges az online média?, www.youtube.de, 20.2.2023.
[6] Programm abrufbar unter MCC, MCC Conference on the Future of Publishing, www.mcc.hu, 1.3.2023.
[7] Vgl. Viktor Orbán, Speech by Prime Minister Viktor Orbán at the opening of CPAC Texas, www.miniszterelnok.hu, 4.8.2022.
[9] Vgl. www.nationalconservatism.org.
[10] Vgl. Mark Lilla, Der hemmungslose Geist. Die Tyrannophilie der Intellektuellen, München 2015; Der Glanz der Vergangenheit. Über den Geist der Reaktion, Zürich 2018.
[11] Vgl. z.B. Fanni Kaszás, Deneen: Hungary as a Model in US Conservative Circles, www.hungarytoday.hu, 26.11.2019; Hungarian Conservative, Hungary Resists the Disruptive Tendencies of Liberalism — An Interview with Harvard Professor Adrian Vermeule, www.hungarianconservative.com, 12.2.2023; zum Spektrum vgl. Markus Linden, Das Heerlager der Scheinheiligen. Der Neue Christliche Fundamentalismus in Rechtslehre, Publizistik und Politik, in: „Kritische Justiz“, 2/2022, S. 191-206.
[12] Vgl. Mark Lilla, Der totgeglaubte Gott. Politik im Machtfeld der Religion, München 2013, S. 284.
[13] Vgl. Mark Lilla, The Once and Future Liberal. After Identity Politics, New York 2017, S. 130.
[14] Ebd., S. 120.
[15] Ebd., S. 113.
[16] Ebd., S. 6 f.
[17] Vgl. Mark Lilla, Der Glanz der Vergangenheit. Über den Geist der Reaktion, Zürich 2018, S. 19 f.
[18] Ebd., S. 50.
[19] Vgl. Mark Lilla, Farewell to America’s Modern Democratic Patriotism?, Reset – Dialogues on Civilizations, www.resetdoc.org, 20.11.2020.
[20] Vgl. Mark Lilla, Two Roads for the New French Right, in: „New York Review of Books“, 20.12.2018, S. 42-46.
[21] Vgl. Ordo Iuris Institute for Legal Culture, A response to the crisis of academic life – an agreement between Collegium Intermarium and ISSEP, www.en.ordoiuris.pl, 5.10.2021.
[22] Vgl. CPAC, CPAC 2018 - Marion Maréchal-Le Pen, www.youtube.com, 22.2.2018.
[23] Vgl. Mark Lilla, Two Roads for the New French Right, a.a.O., S. 42.
[24] Vgl. Mark Lilla und Michael Ignatieff, Open Society as an Oxymoron: A Conversation between Mark Lilla and Michael Ignatieff, in: Michael Ignatieff und Stefan Roch (Hg.), Rethinking Open Society. New Adversaries and New Opportunities, Budapest und New York 2018, S. 22.
[25] Vgl. Mark Lilla, Should America be more like Ukraine? Western society is being liquified, www.unherd.com, 5.11.2022 und: 4libertyEu Network, Mark Lilla, Citizen and Nation. Can liberal patriotism be stronger than national attachment?, www.youtube.com, 14.10.2022.
[26] Ebd., Min. 13:20-13:30.
[27] Vgl. David Brooks, The Triumph of the Ukrainian Idea, www.nytimes.com, 6.10.2022.
[28] Vgl. 4libertyEu Network, Mark Lilla, Citizen and Nation. Can liberal patriotism be stronger than national attachment?, www.youtube.com, 14.10.2022, ab Min. 32:10.
[29] Vgl. Denkfabrik R21, Wokes Deutschland – Identitätspolitik als Bedrohung unserer Freiheit?, www.youtube.de, 7.11.2022., 1:35:36.
[30] Vgl. Zygmunt Bauman, Liquid Modernity, Cambridge/Malden 2000, S. 177 f.
[31] Vgl. 4libertyEu Network, Mark Lilla, Citizen and Nation. Can liberal patriotism be stronger than national attachment?, www.youtube.com, 14.10.2022, ab Min. 24:00.
[32] Ebd., ab Min. 30:15.
[33] Vgl. John J. Mearsheimer, Bound to Fail. The Rise and Fall of the Liberal International Order, in: „International Security“, 4/2019, S. 8.
[34] Vgl. John J. Mearsheimer, Liberalism and Nationalism in Contemporary America, in: „Political Science & Politics“, 1/2021, S. 6.
[35] Vgl. John J. Mearsheimer, The Great Delusion. Liberal Dreams and International Realities, New Haven und London 2018, S. 114.
[36] Vgl. David Miller, The Coherence of Liberal Nationalism, in: Gina Gustavsson und David Miller (Hg.), Liberal Nationalism and Its Critics: Normative and Empirical Questions, Oxford 2019, S. 23-37.
[37] Vgl. Yael Tamir, Liberal Nationalism, Princeton 1993, S. 11 f., 167.
[38] Vgl. David Miller, On Nationality, Oxford 1995, S. 10, 129 f.
[39] Vgl. Yael Tamir, Not So Civic: Is There a Difference Between Ethnic and Civic Nationalism?, in: „Annual Review of Political Science“, 2019, S. 433; Yael Tamir, Why Nationalism?, Princeton 2019, S. 158.
[40] Vgl. Yoram Hazony, Nationalismus als Tugend, Graz 2020.
[41] Vgl. Eva Vlaardingerbroek, Reject Globalism: Embrace God, Brussels National Conservatism Conference, www.youtube.com , 23.3.2022.
[42] Vgl. Hannah Arendt, Nationalstaat und Demokratie (1963), www.hannaharendt.de, 8.3.2022.
[43] Denkfabrik R21, „Deutschland nach der Ära Merkel“, Veranstaltung am 21.3.2023, www.denk-fabrik-r21.de.