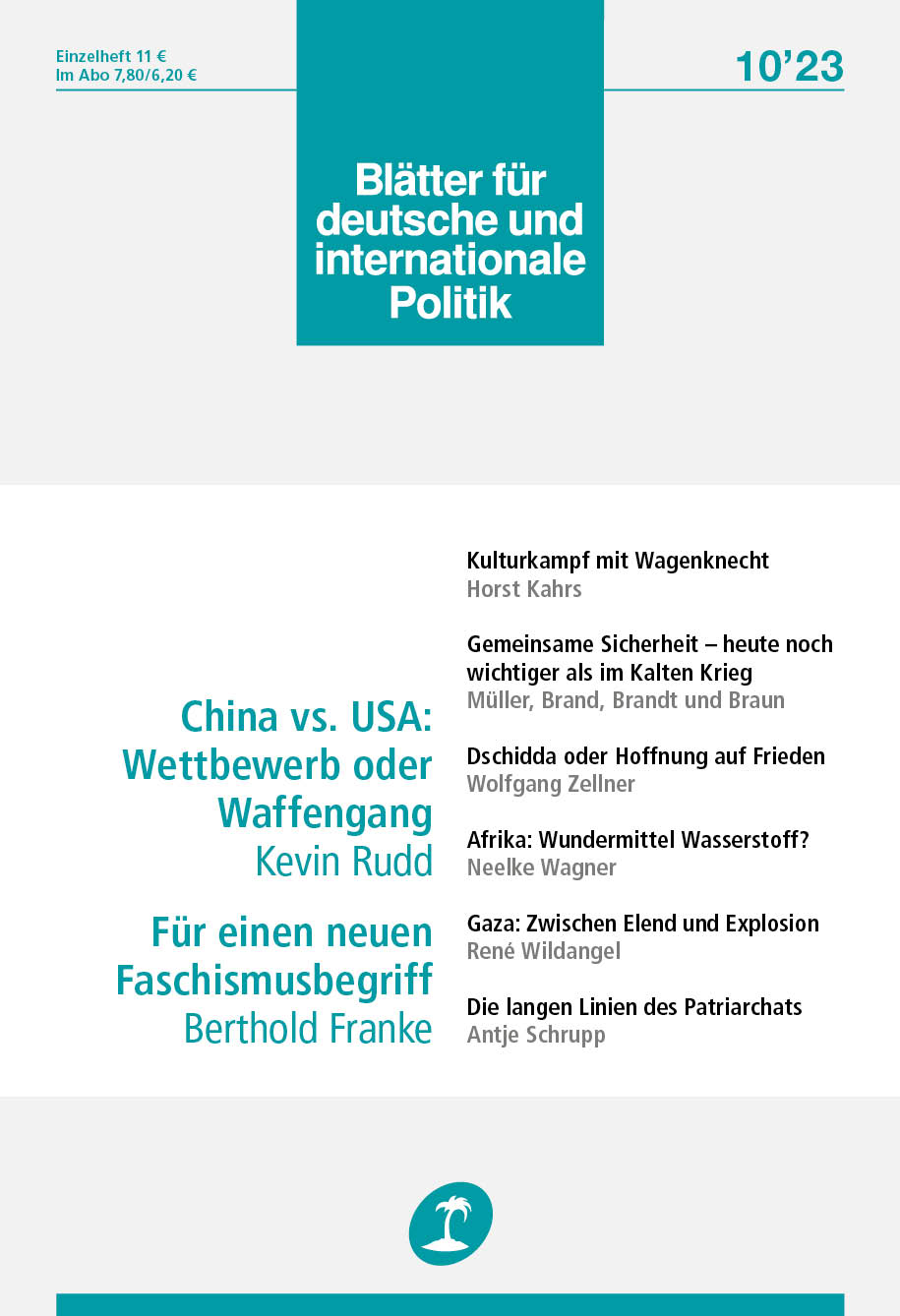Zum politischen Potenzial einer linksautoritären Partei

Bild: Sahra Wagenknecht in Berlin, 25.2.2023 (IMAGO / IPON )
Seit über einem Jahr nährt das Gespenst „Wann gründet Sahra Wagenknecht ihre eigene Partei?“ die Medienlandschaft. Eine „Liste Wagenknecht“ könne eine Alternative zur AfD für jene sein, die staatlichen Schutz und konservative Werte ohne Rechtsextreme wünschen und nur „aus Verzweiflung AfD wählen“ (Wagenknecht). Eine Repräsentationslücke könne gefüllt, so das demokratische System gestärkt werden. Alle diese unterschiedlichen Erwartungen sind mit der Bekanntheit der Bestsellerautorin und politischen Unternehmerin Sahra Wagenknecht verbunden.
Nachdem ein gutes halbes Jahr über eine Parteigründung gemutmaßt worden war, erklärte Wagenknecht Anfang März ihren Abschied von ihrer bisherigen Partei, ohne aus dieser auszutreten. Sie werde 2025 nicht wieder für Die Linke kandidieren, sondern wolle zukünftig als Publizistin und Buchautorin arbeiten. „Oder es ergibt sich politisch etwas Neues.“ Vielleicht die Gründung einer Partei? „Darüber wird an vielen Stellen diskutiert.“[1] Wagenknecht gründet keine Partei, sie öffnet nur den Möglichkeitsraum, eine auf sie zugeschnittene Partei zu gründen – zum Jahresende. Bis dahin gilt es, die mediale Aufmerksamkeit hochzuhalten, wozu gehört, im Unklaren zu lassen, wer die Partei trägt, welche Strukturen und welches Programm sie bekommt.
Im Rückblick erkennt man mehrere Etappen: Der Erfurter Parteitag der Linkspartei wählte Ende Juni 2022 einen angeblichen Wagenknecht-Kandidaten nicht zum Parteivorsitzenden, worauf weitere Kandidaturen zurückgezogen wurden, sodass im neuen Parteivorstand die Wagenknecht-Linie nicht mehr vertreten ist. Damals wurde der Ton gesetzt: Die Mehrheit hat uns ausgegrenzt und die „letzte Chance“ vertan: „Die Chance zu nutzen hätte verlangt, sich von dem Kurs der letzten Jahre zu verabschieden, der uns von einem Wahldesaster zum nächsten geführt hat.“[2]
Ende Oktober 2022 besuchte Wagenknecht die „Bild“-Redaktion. Das Blatt hat eine bei INSA in Auftrag gegebene Umfrage parat, wonach eine „Sahra-Wagenknecht-Partei“ (SW-Partei) der AfD bis zur Hälfte ihrer Stimmen abnehmen und Die Linke in die parlamentarische Bedeutungslosigkeit verbannen könnte. Der „Spiegel“ zieht nach und meldet, nach einer Onlineumfrage könnten sich 30 Prozent der Befragten grundsätzlich „ja, auf jeden Fall“ oder „eher ja“ vorstellen, eine SW-Partei zu wählen; in den östlichen Bundesländern 49 Prozent. Und dann das übliche namenlose Geraune: „Der ‚Spiegel‘ hat mit mehreren Politikerinnen und Politikern im Umfeld Wagenknechts gesprochen, stets ist dasselbe zu hören: Die Überlegungen seien so ernsthaft wie noch nie, es werde geplant und geprüft.“[3]
Im Grunde ist das der Stand bis heute, auch wenn „Bild“ am 10. September titelte: „Wagenknecht gründet ihre eigene Partei“. Diesmal war der Reporter zu Besuch in Wagenknechts Büro, aber die Gewissheit stammt wieder nicht von der Protagonistin selbst, sondern aus deren „Umfeld“. Stattdessen stellte sie „Bild“ Kinderfotos zur Verfügung.
Es bleibt also dabei, dass „im Umfeld“ Namenlose an einer Parteigründung arbeiten und das Potenzial wiederholt auf 20 Prozent vermessen wird. Ungereimtheiten werden in den Skat gedrückt: Ende Juli sah INSA für die „Bild“ eine „Liste Wagenknecht“ bei 15 Prozent, dagegen YouGov für die „Welt am Sonntag“ fast zeitgleich nur bei 2 Prozent. Manfred Güllners Forsa-Institut schätzte ebenfalls ein Potenzial von 20 Prozent – wobei Forsa einst auch für eine Horst-Schlämmer-Partei 20 Prozent erhoben hatte.
Die Konsequenz all dessen: Mit jeder Umfrage wird eine SW-Partei medial – nicht zu Unrecht – als Protestpartei geframt. Da weder ein Programm bekannt ist noch politische Partner in Sicht sind, mit denen politische Veränderungen durchsetzbar wären, wird gar nicht erwartet, dass sie etwas zur Lösung politischer Aufgaben und gesellschaftlicher Probleme beitragen will. Sie gilt als alternative Adresse für Wut, Zorn, Protest – Frau Wagenknecht als in allen Talkshows gern gesehene Alternative zum Faschisten Höcke.
Die möglichen Gründer einer SW-Partei dürften wissen, dass die Umfragen zum Potenzial auf Sand gebaut sind und vor allem keine Rückschlüsse auf tatsächliche spätere Wahlentscheidungen erlauben. Dafür bräuchte es zumindest differenziertere Fragestellungen. Ein Beispiel: Im ARD-Deutschlandtrend vom September 2023 äußerten 21 Prozent der Befragten, dass für sie die Wahl der Linkspartei „grundsätzlich infrage“ käme. 72 Prozent schlossen das „grundsätzlich“ aus. Nur 4 Prozent stimmten aber bei der Sonntagsfrage für die Partei. In den fortlaufenden Civey-Umfragen stand sie bei 4,5 Prozent; gleichzeitig erklärten dort 8,1 Prozent, dass Die Linke die Partei sei, der sie „traditionell am nächsten“ ständen. Dieses Potenzial aus ideologisch geprägter Parteinähe kann die Partei aktuell nicht ausschöpfen. Erst mit solchen Angaben lässt sich ein „enges“ und „weiteres“ Potenzial abschätzen. Naturgemäß fehlen solche Anhaltspunkte für eine SW-Partei.
Der Sozialwissenschaftler Carsten Braband kommt nach einer Analyse verschiedener Datensätze hingegen zu dem Ergebnis, dass lediglich 28 Prozent der möglichen Wagenknecht-Stimmen von Mitte-links-Parteien kommen würden, aber 41 Prozent von der AfD, zu 22 Prozent von vormaligen Unionswählern und zu 8 Prozent von der FDP.[4] Nur 15 Prozent wären vormalige Linkspartei-Stimmen – viel für Die Linke, aber nur eine Minderheit des Potenzials, welches eine SW-Partei erschließen müsste, um erfolgreich zu sein.
Zu einem ähnlichen Befund kommt eine Forschungsgruppe um die Politikwissenschaftlerin Sarah Wagner.[5] Eine SW-Partei habe das Potenzial, „die Kluft zwischen der Linken und der AfD zu überbrücken“, denn: „Während Wagenknechts wirtschaftlich linke Positionen größtenteils mit ihrer Partei übereinstimmen, versetzen sie ihre kulturell rechten Vorlieben in eine einzigartige und unbesetzte Position in der deutschen Politik.“ So könnte sie eine „Wahllücke für linksautoritäre Wähler schließen“. Die SW-Partei würde die klassische linke Idee der Verteilungsgerechtigkeit nicht mehr mit gesellschaftlich progressiven Zielen wie mehr Umweltschutz, Gleichstellung von Minderheiten oder einer liberalen Migrations- und Integrationspolitik verbinden, sondern mit dem gesellschaftlich Konservativen, wobei der Nationalismus nicht wie bei der AfD ins Völkische übersteigert werde. Eine solche Positionierung könne gerade für Menschen, die seit 2017 von der Linkspartei oder der SPD zur AfD gewandert seien, attraktiv sein; das Potenzial für eine SW-Partei liege bei 19 Prozent.
Die Erfindung des »linksautoritären« Wählers
Das Segment der „linksautoritären“ Wähler und Wählerinnen – Wagenknecht selber spricht vom „Linkskonservatismus“ – ist zunächst eine politikwissenschaftliche Erfindung, um den Parteienwettbewerb in einem Zwei-Achsen-Modell in vier Feldern zu strukturieren. Die horizontale ökonomische Achse bilden die Pole umverteilender Sozialstaat und freier Markt, auf der vertikalen gesellschaftspolitischen oder soziokulturellen Achse stehen sich, je nach Konturierung, liberal, individuell, modern, „grün-alternativ“ und traditionell, autoritär, national gegenüber. Die Platzierung der bereits existierenden Parteien zeigt dann ein leeres Feld, weil es an einer Partei fehle, die für einen starken, schützenden Sozialstaat und konservative Wertorientierungen etwa in der Familienpolitik, in der Gleichstellungspolitik, bei Flucht und Einwanderung eintrete.
Diese modellierte Leerstelle prägt seit Jahren viel zu simple Erklärungen zum Aufstieg rechtspopulistischer und nationalistischer Parteien. Bei Verweis auf den traditionellen Autoritarismus in Teilen der (Produktions-)Arbeiterschaft und auf den hohen Anteil der Wahlenthaltung generell unter – ahistorisch gedachten – „Arbeitern“ soll es sich um ein Wählerpotenzial handeln, das von sozialdemokratischen und linken Parteien rechts liegengelassen wurde und sich, politisch verlassen, aus Notwehr der Anti-Systempartei AfD zuwendet – im Grunde aber auf eine Partei wartet, die wieder staatliche Umverteilung ohne gesellschaftspolitische Modernisierung in den Mittelpunkt der Politik stellt.
Die Wahlforschung geht davon aus, dass eine Wahlentscheidung sich immer weniger aus einer sozialstrukturellen Position, Klassenlage oder einer Kombination von sozialen Merkmalen ableiten lasse. Um stattdessen Einstellungsmerkmale zu charakterisieren, wird nicht nur das Zwei-Achsen-Modell verwendet, auch die Einstellung zur „Modernisierung“ teile alle politischen und sozialen Milieus.[6] Eine andere Erweiterung erfolgt durch eine Achse mit den Polen Kommunitarismus und Kosmopolitismus. Eine SW-Partei befände sich hier eher am Pol der Kommunitaristen und an der Seite der Modernisierungsskeptiker und könne auf Zulauf aus nahezu allen sozialen Lagen und Milieus rechnen.
Politische Lager werden hergestellt
Der Soziologe Steffen Mau warnt hingegen vor voreiligen Schlüssen: „Die Charaktermaske des reinen Kosmopolitismus trägt nur eine kleine Gruppe. Aus der Anerkennung von sexueller Diversität kann man eben nicht umstandslos auf die Haltungen zu Migration oder dem Klimaschutz schließen; polarisierte Meinungen finden sich allenfalls bei der Frage, ob Migration als kulturelle Bereicherung empfunden wird oder man Zuwanderung begrenzen sollte. Was Fragen der Diversität und der Anerkennungsbereitschaft nicht heteronormativer Lebensformen und Identitäten angeht, stehen die unteren Schichten nicht im deutlichen Kontrast zu den akademischen Mittelschichten; Gleiches gilt für die Positionen zum Klimawandel.“ Stark polarisierte Positionen existierten in der Gesellschaft nicht per se, vielmehr finde man zwischen schwach besetzten Polen jeweils eine große „Welt des Dazwischen“. Zu diesem Fazit gelangen Mau und sein Forscherteam nach der empirischen Prüfung, wie sich Einstellungen auf vier Konfliktachsen verteilen: „(1) Oben-Unten-Ungleichheiten, bei denen die ökonomische Ressourcenverteilung im Mittelpunkt steht, (2) Innen-Außen-Ungleichheiten, die sich auf territorialen Zugang, Migration und Mitgliedschaft beziehen, (3) Wir-Sie-Ungleichheiten, die die gesellschaftliche Anerkennung von Diversität umfassen, und (4) Heute-Morgen-Ungleichheiten, die sich auf Fragen der Generationengerechtigkeit und ökologischen Nachhaltigkeit richten. […] Der Kernbefund ist, dass sich [...] kein zweidimensionaler Einstellungsraum zeigt, bei dem die alten ökonomischen Ungleichheiten den neuen Ungleichheiten gegenüberstehen.“[7]
Kurzum: Es gibt nicht eine klar definierte „linksautoritäre“ Wählerschaft, die nur auf die Repräsentation durch die SW-Partei wartet. Ohnehin repräsentieren Parteien nicht einfach das, was im Wahlvolk an Stimmungen, Einstellungen und Positionen vorhanden ist. Sie repräsentieren das, was sie zuvor an Unterschieden und Polarisierungen geschaffen haben. Entscheidend für den Parteienwettbewerb ist, ob und wie mindestens zwei dieser Konfliktachsen kombiniert werden. „Ein soziales Schisma ist vor allem dort zu finden, wo politische Unternehmer, Massenmedien und Parteien Konfliktthemen besonders stark bespielen und akzentuieren – ‚Lager‘ mit konsistenten politischen Glaubenssystemen werden politisch und medial hergestellt.“[8]
Kulturkampf statt Klassenkampf
Für den Wahlerfolg einer SW-Partei entscheidend wird nicht sein, wie viele Stimmen sie der Linkspartei oder der Sozialdemokratie abjagen kann. Die politische Leerstelle wird mit Blick auf bisherige AfD- und Unionswähler formiert werden: Was könnte sie dazu bringen, zur SW-Partei zu wechseln? Wenn sich davon auch Nichtwähler angesprochen fühlen, um so besser. Gleichzeitig geht es einer neuen Partei für die ersten Erfolge immer um das Einsammeln aller möglichen „Anti“-Stimmen – als Protestpartei gegen die etablierten und gestaltenden Parteien.
Den Grundton gab Wagenknecht spätestens im Frühjahr 2021 vor, als sie sechs Monate vor der Bundestagswahl mit ihrem Buch „Die Selbstgerechten“ ihren „Linkskonservatismus“ gegen die linksliberalen „Lifestyle-Linken“ stellte, die verächtlich auf die „normalen Menschen“ blicken und statt die „Interessen der Mehrheit“ die Belange „skurriler Minderheiten“ zum Nabel der Politik machen würden. Ein „muffig-reaktionärer Konservatismus“ sei damit nicht gemeint, sondern: „Anstand, Ehrlichkeit, Mitmenschlichkeit. Wertschätzung und Fleiß, kein Ausnutzen staatlicher Leistungen. Das gilt alles als konservativ, aber wenn solche Werte bröckeln, funktioniert eine Gesellschaft nicht mehr.“ Im Kulturkampf bräuchten AfD-Wähler wieder eine „seriöse Adresse“.[9]
Tatsächlich gab es in allen erfolgreichen Arbeiter- und linken Volksparteien immer auch eine starke linkskonservative Strömung. Ihre Wurzeln hat sie in sozialpartnerschaftlichen Traditionslinien wie auch in den frühen Solidarorganisationen der Arbeiterbewegung. Heute orientiert sie sich vor allem an den Erfolgsjahren des sozialdemokratischen Klassenkompromisses, als soziale Sicherheit, staatliche Umverteilung und ökonomische Regulierung einerseits und die kapitalistische Ökonomie und Profitmaximierung andererseits sich in einer nationalstaatlich moderierten Win-win-Balance befanden. Die Grundlage dieser Ära erodierte in den 1990er Jahren mit einer zunehmend globalisierten Ökonomie und transnationaler Konzernmacht. Seit der globalen Krise 2007/2008 wächst das Gewicht staatlicher Sicherung und Regulation der Volkswirtschaften wieder. Der Linkskonservatismus knüpft an das vergangene Modell an, die Kompetenzen des Nationalstaats sollen wieder gestärkt, die Mobilität von Kapital und Arbeit eingeschränkt, der Einfluss der Kapitalmärkte begrenzt werden mit dem Ziel, das nationale Kapital wieder zu einem auch für die Lohnabhängigen positiven Klassenkompromiss bewegen zu können. Jenseits einer spezialisierten politischen Öffentlichkeit ist eine grundsätzliche Differenz zwischen diesem Linkskonservatismus und Parteien wie Die Linke oder SPD nicht erkennbar – solange die Strömung nicht ausgegrenzt wird oder ihrerseits Dominanz anstrebt.
In der Linkspartei deutete sich genau dieser Bruch an, als die Partei in der Migrationskrise 2015/16 zu keiner gemeinsamen Position finden konnte. Mit dem russischen Überfall auf die Ukraine wurde er – längs der Innen-Außen Achse – unübersehbar: Jetzt rückten Wagenknecht und ihre Anhänger mehr und mehr die nationale Souveränität Deutschlands in den Vordergrund und behaupteten, Deutschland sei kein souveräner Staat und müsse sich aus der Hegemonie der USA befreien. Die Parteimehrheit hält dagegen – nicht zuletzt mit Blick auf zwei Weltkriege – an der weiteren Integration in der EU fest und fordert dazu sozialpolitische Regulative auch auf europäischer Ebene.
Offenheit zum ethnisch-völkischen Nationalismus
Nationaler Sozialstaats-Konservatismus, der links zu sein beansprucht, müsste rasch beantworten, welche Nation gemeint ist, um vom rechten Nationalismus unterschieden werden zu können: die ethnisch-völkische oder die republikanische? Wer auf Zulauf auch aus der AfD-Wählerschaft setzt, wird auf eine Klärung lieber verzichten. Damit läuft die Positionierung der SW-Partei auf der Oben-unten-Achse auf eine weitere Ausgrenzung hinaus: die Ausgrenzung ausländischer Arbeiterinnen und Arbeiter. Spätestens das hat mit linker oder progressiver Politik nichts mehr zu tun. Der Wohlstand des Landes verdankt sich zu einem erheblichen Teil der Arbeit hier ansässiger Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit. 14 Prozent der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten besitzen nicht die deutsche Staatsangehörigkeit. Ihr Anteil hat sich in den zurückliegenden zehn Jahren nahezu verdoppelt und wird weiter steigen. In Bayern, Hessen und Baden-Württemberg – den Ländern, die in den Finanzausgleich einzahlen – liegt der Anteil bei 17 bis 19 Prozent. In etlichen Städten liegt der Ausländeranteil an den sozialversicherten Beschäftigten sogar bei einem Viertel bis zu einem Drittel.[10] Ihre Position in der beruflichen Arbeitsteilung zeigt die klassischen Merkmale einer anhaltenden, in der Tendenz rassistischen Unterschichtung des deutschen Arbeitsmarktes. Es stehen sich nicht einfach Arm und Reich, Volk und Elite gegenüber, vielmehr ist das Heer der Reichtumsproduzenten, die Steuern und Sozialbeiträge zahlen, überaus divers. Es gibt „Einheimische“ und „deutsche Einheimische“, an wen soll „zuerst“ gedacht werden? Einem republikanischen Verständnis von Nation wird „taxation without representation“ zum Skandal: Wenn von einer Lücke der Repräsentation der Arbeiterschaft und ihrer Anliegen in den Parlamenten gesprochen wird, dann darf über das fehlende Wahlrecht für nichtdeutsche Arbeiterinnen und Arbeiter nicht geschwiegen werden.
In der kulturkämpferischen Wir-Sie-Positionierung der Wagenknecht-Anhänger haben diese Arbeiter freilich keinen Platz. Hier geht es gegen urbane Milieus, großstädtische Besserverdiener, Linksliberale und Lifestyle-Linke und um Menschen mit kleinen Einkommen, um die Mehrheit der Arbeitenden, um die „normalen Leute“. Diese Rhetorik bewirtschaftet Ressentiments gegenüber Besserverdienenden, akademisch Sozialisierten und neuen Bildungsbürgerinnen.
Ohne Antwort auf den gesellschaftlichen Wandel der Arbeit
Den Nährboden für den relativen Erfolg dieser Positionierung bilden langfristige Veränderungen in der Sozialstruktur, deren soziokulturelle und sozialpsychologische Folgen im linken politischen Spektrum insgesamt übersehen und politisch nicht bearbeitet wurden. In Zeiten der frühen Bundesrepublik, als die Hälfte der Erwerbstätigen den Sozialstatus „Arbeiter“ inne hatte und weniger als ein Zehntel über einen Hochschulabschluss verfügte, blickte eine selbstbewusste Mehrheit auf eine bessergestellte Minderheit. Doch der sozialdemokratische Weg des sozialen Aufstiegs aus proletarischen Lebenslagen und der sozialen Öffnung des Bildungswesens sowie der technologische Wandel veränderten die gesellschaftliche Arbeitsteilung gravierend. Manuelle Tätigkeiten vom Helfer bis zum versierten Hand-Werker verloren massiv an gesellschaftlicher Wertschätzung, Handarbeit als Schöpferin des gesellschaftlichen Reichtums geriet in eine Minderheitenrolle, gerade noch ein Sechstel zählt in der Sozialstatistik heute als „Arbeiter“. Begleitet wird der Wandel von einem Diskurs, wonach die Zukunft des gesellschaftlichen Wohlstands in der Hand von Akademikern liege. Wer nicht mindestens das Abitur geschafft hat, gilt in der meritokratischen Hierarchie als Versager, der selbstverschuldet weiter unten steht.
Diese gesellschaftliche Abwertung trägt ihren Teil dazu bei, dass gerade unter Produktions- und Dienstleistungsarbeitern mit niedriger bis mittlerer Qualifikation der größte Anteil an Nichtwählern zu finden ist. Verteilungspolitik, die kommunikativ auf rein materielle Ungleichheit und ihre Milderung abstellt, wird dagegen nicht ankommen. Denn es braucht immer gute, legitime Gründe, warum einem zu Recht etwas zusteht; diese bilden die Basis von Selbstbewusstsein und Identität. Die AfD bietet die Zugehörigkeit zum deutschen Volk als Grund, berechtigte Ansprüche zu stellen. Ein linker Gerechtigkeitsdiskurs fehlt dagegen weitgehend. Übersehen scheint, dass politische Kämpfe dann erfolgreich sind, wenn sie sich auf ein Identitätsmerkmal konzentrieren und angemessene Rechte einfordern – das machte die Arbeiterbewegung als Bewegung der wahren „Produzenten des Reichtums“ nicht anders als heute die angeblich „skurrilen Minderheiten“.
Wie kann man als Nichtakademikerin mit einem einfachen oder mittleren Schulabschluss ein respektiertes und politisch gleichwertiges Leben führen? Kurzzeitig wurde diese Repräsentationslücke während der Pandemie offenbar, als von „systemrelevanten Berufen“ und jenen, die „den Laden am Laufen halten“, die Rede war. Wagenknecht und ihre Anhänger haben als Antwort jedoch nicht neues Selbstbewusstsein, sondern bloß Ressentiments und Spaltung im Angebot. Sie ignorieren dabei auch, dass zum Erfolg von Arbeiterbewegungen immer ein Bündnis mit urbanen Schichten beigetragen hat. In der Außenpolitik verknüpft die sich abzeichnende SW-Partei zudem Nationalismus und materiellen Wohlstand. Weil der „Wirtschaftskrieg“ gegen Russland der „eigenen Bevölkerung“ mehr schade und die Folgen nur die „deutsche Wirtschaft“ ruinieren würden, werden Sanktionen gegen Russland abgelehnt. In der Außenpolitik komme es auf wirtschaftliche Interessen, nicht auf Werte an, rufen Wagenknecht und Co. in Richtung Ampelregierung. Dabei „vergessen“ sie, dass es bei der Unterstützung der Ukraine auch darum geht, ob völkerrechtliche Verträge und entsprechende Rechtssicherheit gelten, woran Deutschland ein eminentes wirtschaftliches Interesse hat. Die Trennung zwischen Werten und Interessen entpuppt sich damit als künstlich.
Die tatsächliche Leerstelle besteht links
Innenpolitisch wird mit der Angst vor einer drohenden Deindustrialisierung Deutschlands gegen die Energiewende polemisiert, die aus biophysikalischer Sicht zu spät und zu langsam umgesetzt wird. In beiden Fällen erscheinen die Grünen, im Gleichklang mit der rechten Opposition, als Hauptgegner, als „die gefährlichste Partei“ (Wagenknecht) im Bundestag.
Materielle „Besitzstandswahrung first“ – im Gewand der Sorge um den deutschen Wirtschafts- und Industriestandort – ermöglicht es, das in Teilen der Bevölkerung verbreitete Unbehagen politisch zu bewirtschaften. In einer von Verlustängsten geprägten Gefühlslage wird gewusst oder zumindest geahnt, dass der westliche Lebensstandard angesichts der planetaren Grenzen nicht für alle Menschen möglich ist, aber dennoch von diesen erstrebt wird, weshalb sich die Migration nicht wird stoppen lassen. Es wird gewusst, dass die biophysikalische Existenzkrise rasche Veränderungen in der eigenen Produktions- und Konsumweise erfordern wird, die schnell als Überforderung wahrgenommen werden können. Verteidigung des Status quo gegen Ansprüche von außen und aus der Zukunft, Verhärtung und Panzerung gegen Empathie werden zu einer Grundhaltung überall dort, wo die Wahrnehmung vorherrscht, ein schutzloses Objekt komplexer, undurchsichtiger Prozesse zu sein. Parolen wie „Fluchtursachen bekämpfen“ wirken da nicht, sie bieten Linderung bestenfalls in 20 Jahren, aber nicht heute und morgen. Diese Gefühlslage ließe sich vielleicht auflösen mit einer Vorstellung davon, wie eine bessere Zukunft jenseits des „Mehr vom Gleichen“ aussehen könnte. Aber solche konkreten Utopien führen ein Schattendasein. Von der SW-Partei ist dergleichen nicht zu erwarten und auch nicht, dass sie irgendetwas zur Wiederherstellung progressiver politischer Mehrheiten beitragen würde. Ebenso wenig steht zu hoffen, dass ihre Gründung zu einer Zivilisierung der öffentlichen Debatte führt. Im Gegenteil: Die wahlpolitische Konkurrenz in der Angst- und Wutbewirtschaftung benötigt und erzeugt immer wieder neue Ängste und Wut. Die tatsächliche politische Leerstelle bleibt daher links: eine progressive Partei, die keine Wunder verspricht, die vertrauenswürdig und regierungsfähig ist und Antworten auf die Fragen der Zeit geben kann.
[1] Sahra Wagenknecht im Interview für die „Rheinpfalz“, 2.3.2023.
[2] „Das ist ein Affront gegen einen relevanten Teil der Partei“, sz.de, 27.6.2022.
[3] Timo Lehmann und Marc Röhling, Kurz vor links draußen, spiegel.de, 17.11.2022.
[4] Carsten Braband, Wo liegt das Potenzial einer Wagenknecht-Partei?, jacobin.de, 9.6.2023.
[5] Sarah Wagner et al., Bridging Left and Right? How Sahra Wagenknecht Could Change the German Party Landscape, in: „Politische Vierteljahresschrift“, 3/2023, S. 621-636. Die folgenden Zitate aus dem englischen Original in eigener Übersetzung.
[6] Robert Vehrkamp, Gesamtdeutsche Konfliktlinie oder neue Ost-West-Spaltung?, Gütersloh 2019.
[7] Thomas Lux u.a., Neue Ungleichheitsfragen, neue Cleavages? Ein internationaler Vergleich der Einstellungen in vier Ungleichheitsfeldern, in: „Berliner Journal für Soziologie“, 11/2021, S. 173-212.
[8] Steffen Mau, Kamel oder Dromedar? Zur Diagnose der gesellschaftlichen Polarisierung, in: „Merkur“, 874/2022, S. 5-18.
[9] Sahra Wagenknecht im „Tagesspiegel“-Interview, 10.9.2023.
[10] Datenbank Beschäftigung, statistik.arbeitsagentur.de, Stand: 31.12.2022.