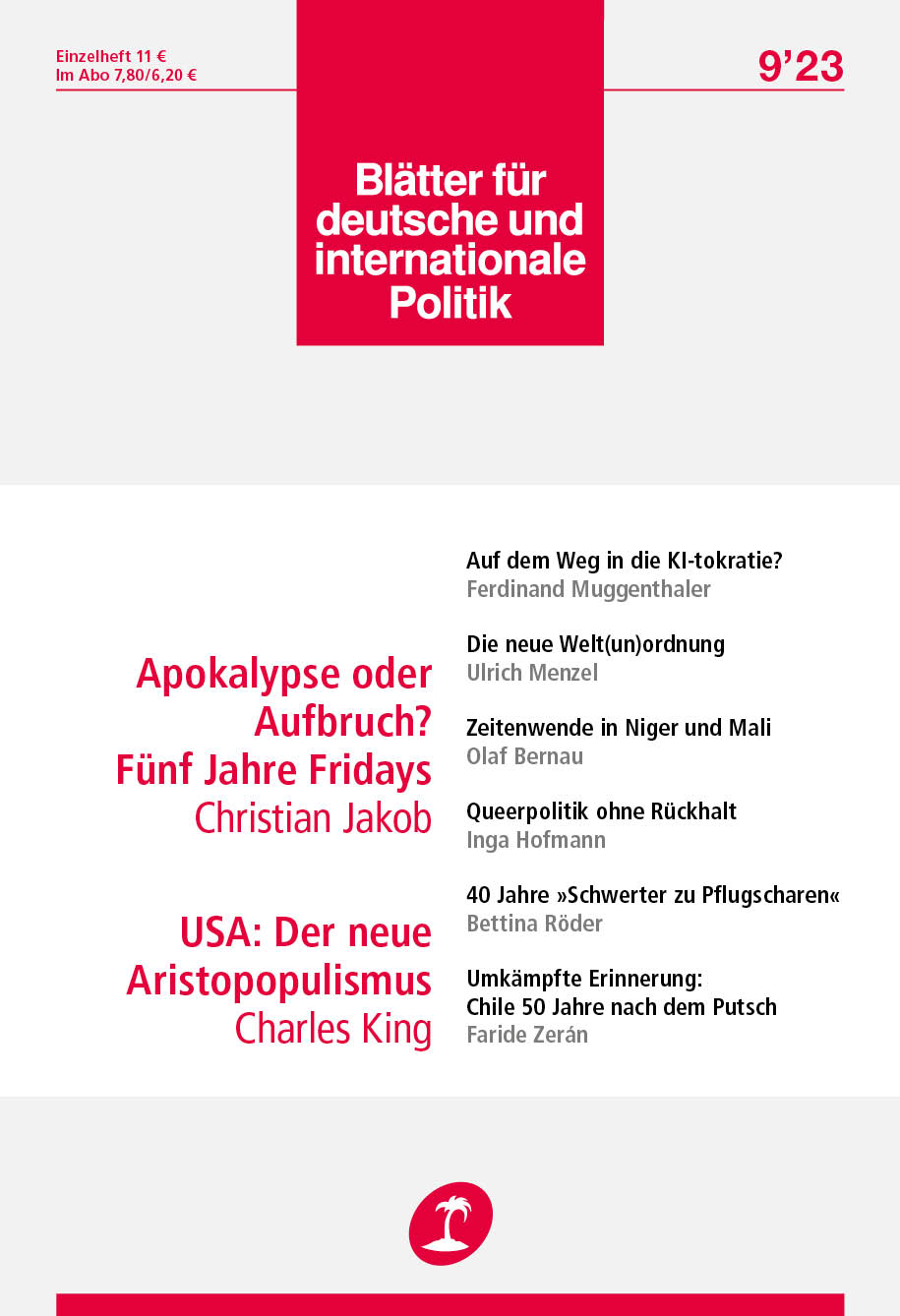Fünf Jahre Fridays for Future und die Chancen der Klimabewegung

Bild: Brände in der Mojave National Preserve, Kalifornien, 28.7.2023 (IMAGO / ZUMA Wire / National Park Service)
Vier Monate bevor sie vor jetzt fünf Jahren, am 20. August 2018, ihren berühmten „Schulstreik für das Klima“ startete, hatte Greta Thunberg getwittert: „Ein führender Klimawissenschaftler warnt, dass der Klimawandel die gesamte Menschheit auslöschen wird, wenn wir in den nächsten fünf Jahren nicht aufhören, fossile Brennstoffe zu nutzen.“ Sie bezog sich dabei auf den Harvard-Geophysiker James Anderson. Der hatte bei einer Rede an der Universität von Chicago im Januar 2018 allerdings nur gesagt, dass die Welt bis 2023 aufhören müsse, fossile Brennstoffe zu verwenden. Sonst seien die Auswirkungen auf die Polkappen irreversibel.
Thunberg löschte den Tweet später. Doch er war symptomatisch für diese Zeit. 2018 war wohl das Jahr, in dem vielen Menschen erstmals, dafür aber mit voller Wucht, klar wurde, wie dramatisch die Klimakrise ist. Szenarien deuteten auf eine Erwärmung von bis zu fünf Grad bis zum Jahr 2100 hin und stellten menschliches Überleben infrage. Weil gleichzeitig von extrem kurzen Zeitfenstern zum Gegensteuern die Rede war, entstand das Bild von der Lage, die für viele kaum noch rational zu erfassen, geschweige denn rechtzeitig gesellschaftlich zu verhandeln schien.
»Eine Welt, in der die Sonne uns kocht«
David Wallace-Wells’ Artikel „Die unbewohnbare Erde“ über eine Welt, „in der die Sonne uns kocht“, 2017 im New York Magazine und 2019 als Buch erschienen, war eines der wohl einflussreichsten Dokumente dieser Zeit. Was die realen Gefahren der Erwärmung angehe, „leiden wir an einem unglaublichen Versagen der Vorstellungskraft“, klagte Wallace-Wells und versuchte, ebenjener Vorstellungskraft auf die Sprünge zu helfen: Die Welt werde voller Stürme sein, „so stark, dass wir neue Kategorien zu ihrer Beschreibung erfinden müssen“. Miami und Bangladesch hätten „keine Chance zu überleben“. Die Erde habe vor dem derzeitigen bereits fünf frühere Massenaussterben erlebt, die jeweils „die Evolutionsgeschichte so vollständig ausgelöscht haben, dass sie wie ein Zurückstellen der planetarischen Uhr wirkten“. Es gehört nicht viel Fantasie dazu, sich vorzustellen, welche Wirkung solche Aussagen auf viele Menschen haben.
Eine neue Klimawirklichkeit
Erstaunlicherweise war es genau derselbe Autor, der nur vier Jahre später einen ähnlich einflussreichen Text verfasste, der zwar keine Entwarnung gab, aber doch die Apokalypse absagte: Sein Artikel „Jenseits der Katastrophe. Eine neue Klimawirklichkeit kommt ins Blickfeld“ erschien Ende Oktober 2022 in der New York Times. Der Kern des mehrseitigen Essays: Seit der Pariser Klimakonferenz 2015 und vor allem mit dem Aufkommen von Fridays for Future 2018 nahm der globale Klimaschutz in einer Weise Fahrt auf, dass die apokalyptischsten Szenarien nicht mehr wahrscheinlich sind. Statt auf plus fünf Grad steuert die Menschheit heute wohl auf plus zwei bis plus drei Grad zu. Wallace-Wells öffnete Raum für Hoffnung. Die New York Times publizierte seinen Text einige Tage vor der Weltklimakonferenz COP27 in Ägypten. Die „Klimazukunft sieht sowohl besser als auch schlechter aus als noch vor ein paar Jahren“, so Wallace-Wells. Die schrecklichsten Vorhersagen seien durch die nun angelaufene Dekarbonisierung unwahrscheinlich geworden, die hoffnungsvollsten hingegen seien durch tragische Verzögerungen praktisch ausgeschlossen.
Die Bandbreite möglicher Zukunftsszenarien für das Klima werde immer kleiner, und so entstehe ein klareres Bild dessen, was auf uns zukommt: „Eine neue Welt voller Umbrüche, in der Milliarden von Menschen weit entfernt von jeder Klimanormalität leben, die aber gnädigerweise nicht unmittelbar vor einer echten Klimaapokalypse steht.“ Dass die schlimmsten Temperaturszenarien nun viel weniger plausibel seien, stelle „in einer Zeit der Klimapanik und Verzweiflung ein unterschätztes Zeichen für einen weltgestaltenden Fortschritt dar“, so Wallace-Wells.
Die Erkenntnis, dass eine „wirklich apokalyptische Erwärmung“ heute wesentlich unwahrscheinlicher sei als noch vor ein paar Jahren, „entreißt die Zukunft dem Reich der Mythen und holt sie auf die Ebene der Geschichte zurück: umkämpft, kämpferisch, mit einer Mischung aus Leiden und Gedeihen – wenn auch nicht für alle Gruppen gleichermaßen“. Immer noch lägen die wahrscheinlichsten Zukunftsaussichten über Schwellenwerten, die als katastrophal eingestuft wurden – was einem Scheitern der globalen Bemühungen gleichkomme, die Erderwärmung auf ein „sicheres“ Niveau zu begrenzen. „Da wir jahrzehntelang nur minimale Maßnahmen ergriffen haben, haben wir diese Chance vertan“, so Wallace-Wells. Vielleicht sei es noch beunruhigender, dass die Erwärmung selbst auf relativ moderatem Niveau immer gravierend scheine, je mehr man über sie herausfinde.
Aber noch vor fünf Jahren kannte niemand Greta Thunberg, Schulstreiks, Fridays for Future oder Extinction Rebellion, schreibt Wallace-Wells. Es gab keine ernsthafte Debatte über den Green New Deal der US-Demokraten, das Klimaschutzpaket der Biden-Regierung, den European Green Deal und Fit for 55 der EU oder das Versprechen Chinas, die Emissionen bis 2030 zu senken. Kaum ein Land der Welt habe ernsthaft über Net-Zero gesprochen, viele nicht einmal über Emissionsreduktion. „Heute unterliegen mehr als 90 Prozent des weltweiten Bruttoinlandsprodukts und mehr als 80 Prozent der globalen Emissionen Netto-Null-Zusagen unterschiedlicher Art, die alle eine umfassende Dekarbonisierung in historisch beispielloser Geschwindigkeit versprechen.“ Es scheint, als hätte die Menschheit sich in diesen letzten Jahren einen gewissen Gestaltungspielraum zurückerobert.
Transapokalypsen – die künftige Normalität?
„Es geht nicht um alles oder nichts“, sagt der Klimaforscher Zeke Hausfather. „Es geht nicht darum, ob wir den Klimawandel in den Griff bekommen oder nicht, sondern darum, dessen Auswirkungen abzumildern.“ Es dürfe sich nicht die Vorstellung verfestigen, „dass wir entweder gerettet oder dem Untergang geweiht sind“. Tatsächlich würden alle in Zukunft unter der Erderwärmung leiden, weil die Emissionen nicht sofort zu stoppen seien, egal was geschehe. „Die Frage ist, wie viel Leid wir haben und wie viel wir retten können.“ Von der allgemeinen menschlichen Entwicklung sei dies nicht zu trennen. Die Fähigkeit der Gesellschaften, auf den Klimawandel zu reagieren, sei mit der Lösung aller anderen großen Probleme verbunden: Globale Gleichberechtigung, stärkere globale Institutionen, die Verteilung des Wohlstands seien der Schlüssel.
Der Blick auf die Prognosen der Vergangenheit zeigt vor allem eins: Kaum etwas tritt so ein, wie es vorhergesagt wurde. Was also erwartet die Menschheit? Die künftige Normalität lässt sich mit Alex Steffens Begriff der „Transapokalpyse“ gut beschreiben: Wir werden in einem Zustand leben, in dem die Menschen sich dauerhaft gegen erodierende Lebensbedingungen stemmen müssen. Ein heroischer Ansatz nach dem Motto „Wenn wir scheitern, bedeutet das für uns das Ende von allem“ bringe uns nicht weiter, so Steffen. Leben und Gesellschaft könnten in Zukunft nur dann gelingen, wenn „wir uns zu Menschen formen, die auf einem Planeten, der sich in einer Dauerkrise befindet, erfolgreich sein können. Wir werden für den Rest unseres Lebens in Diskontinuität leben. Das ist jetzt unser Zuhause.“
Man werde mit Wohlstandsverlusten bezahlen, wenn Stürme über das Land fegen, wenn ein Kälteeinbruch ein ganzes Land in die Dunkelheit stürzt oder wenn ein neuartiges Fledermausvirus eine globale Pandemie auslöst. „Noch mehr aber werden wir alle unter dem ständigen Ausbluten der Ressourcen leiden: wenn die Kosten für Lebensmittel steigen, wenn Dürren zunehmen, wenn Wasser rationiert wird, oder wenn wir Klimaanlagen und Luftreiniger kaufen müssen, um die bisher immer sonnigen, klaren Sommer zu überstehen, die jetzt aber glühend heiße, rauchgeschwängerte Monate sein können“, schreibt Steffen.
Doch die Erfahrung, dass einige der zurückliegenden Krisen unterm Strich nicht allzu schlecht ausgingen, kann dabei helfen, sich auf diese Situation einzustellen. Viele staatliche Antworten auf die Covidpandemie waren letztlich trotz aller Schwierigkeiten nicht falsch. Weitere Pandemien werden folgen, auf die gemachten Erfahrungen und Forschungsergebnisse lässt sich aufbauen. Auch die befürchtete globale Wirtschaftskrise und ein Gasmangel durch den Krieg in der Ukraine wurden halbwegs verhindert. Das gesteigerte Bewusstsein für die Gefahren von großer Hitze und das neu verbreitete Wissen um die damit verbundene Übersterblichkeit zogen schon bald eine große Debatte um Maßnahmen wie Hitzeschutzpläne nach sich.
Viele, die Krisen erforschen, weisen auf ihr unvorhersehbares Potential für Veränderungen hin. Die Ölkrise von 1973 etwa hatte zur Folge, dass vermehrt AKW gebaut wurden. Das wiederum ließ eine starke Umweltbewegung entstehen, auf deren Druck viele der ökologischen Verbesserungen der 1980er Jahre zurückgehen. Die Umweltbewegung wird künftig mit dem Widerspruch umgehen müssen, dass heute immer neue Technologien die von ihr geforderte notwendige Transformation möglich machen, diese Technologien aber gleichzeitig dazu instrumentalisiert werden, um Menschen zu suggerieren, sie könnten ihren Lebensstil unangetastet lassen.
„Wer in Afrika lebt, ist jeden Tag mit Katastrophen konfrontiert“, sagte mir meine in Uganda lebende taz-Kollegin Simone Schlindwein. Seit 15 Jahren berichtet sie über die Region der großen Seen, in der sich Kriege, Armut, Vertreibung, Epidemien und Naturkatastrophen ballen. „Die Europäer haben sich an eine Sicherheit gewöhnt, die anderswo auf der Welt keineswegs normal ist. Sie werden sich umgewöhnen müssen.“
Dazu gehört, sich der Verdummungsmaschinerie zu verweigern, die den Menschen einredet, sich schon als Klimaretter aufspielen zu können, wenn sie bloß den Stromanbieter wechseln. Dazu gehört auch, sich der Tatsache zu stellen, dass Wohlstand und Sicherheit schrumpfen werden und es nicht mit Wärmepumpen und Elektroautos getan sein wird.
Das wird schwierig. Aber es ist nicht das Ende der Welt.
Wer mündig bleiben will, glaubt an seine Zukunft
Als der Kibbuz Chazerim 1946 gegründet wurde, war die Negev Wüste ein unwirtlicher Ort. Dort, wo die klassenlose Agrargemeinschaft jüdischer Siedler:innen entstehen sollte, fielen nur gut 100 Millimeter Regen im Jahr. Für Landbau zu wenig. Doch die Kibbuzim spezialisierten sich auf neue Bewässerungstechnologien, und 1959 konnte Simcha Blass, ein in Chazerim lebender Ingenieur, ein neuartiges System zur Tröpfchenbewässerung vorstellen. Mitten in der Wüste vermochte der Kibbuz damit ein bis heute grünes Meer aus Jojobasträuchern zu schaffen. Das dem Kibbuz gehörende Bewässerungsunternehmen Netafim stieg zum Weltmarktführer auf, die rund 800 Mitglieder halten bis heute an ihren sozialistischen Idealen fest. Während andere Kibbuzim privatisiert sind, wird in Chazerim Wäsche in einer Gemeinschaftswaschküche gewaschen, die Bewohner:innen essen gemeinsam im Speisesaal, das Kollektiv trägt Verantwortung für alle Mitglieder.
Es kann nicht schaden, an solche Geschichten zu erinnern. Denn die Siedler:innen hatten genau das, was vielen heute fehlt: Die Vorstellung von einer guten, gemeinsamen Zukunft in und trotz einer widrigen Umwelt – und die Kraft, diese Zukunft kollektiv zu gestalten.
Wen überzeugt noch der Fortschritt?
Unsere Gegenwart beschreibt die Gruppe Nevermore indes als einen steten Schwund von Zukunft. Dem „Spektakel des Untergangs“ sei Geschichte als „Chance der Entfaltung humaner Kräfte bis zu ihrem Optimum“ entgegenzustellen. Der Glaube an eine solche fortschrittliche Zukunft ist ein urlinkes Thema: Die Proletarier:innen hätten „eine Welt zu gewinnen“, schrieb Karl Marx im Kommunistischen Manifest. Heute, da der „Verlust der vertrauten Welt“ droht, gilt das vielleicht mehr denn je. Marx öffnete den gedanklichen Raum für eine selbstbestimmte Weltgestaltung, und mit der sich im 19. Jahrhundert entwickelnden Technik, der neuen Rolle der Universitäten, die nicht bloß altes Wissen weitergeben, sondern neues schaffen sollten, der Professionalisierung und Arbeitsteilung, entstand ihre praktische Grundlage.
Nicht einmal 200 Jahre später ist vielen aber eine gute Zukunft kaum mehr vorstellbar. Veränderungen erscheinen vielen Menschen nicht als Folge von Weltgestaltung, sondern als Zerstörung und Zerfall, die sich ihrem Einfluss entzogen haben. In den apokalyptischen Bildern und Projektionen fehlen Hoffnung und Zuversicht, es fehlt die Möglichkeit von Glück. Und die vielen kaum mehr fassbar scheinenden Krisendynamiken verdrängen das Bewusstsein für das, was Fortschritt und soziale Kämpfe bis heute möglich machten. Vor 200 Jahren lag die durchschnittliche Lebenserwartung in Europa bei etwa 33 Jahren. Heute sind es global 73 Jahre. Vor 200 Jahren lebten 96 Prozent der Weltbevölkerung in extremer Armut, heute sind es rund acht Prozent. In allen Weltregionen ist die Bevölkerungszahl enorm gestiegen, der Anteil Armer fiel überall stark. Vor 100 Jahren mussten Menschen in Deutschland im Schnitt fast zwei Drittel ihres Einkommens für Essen ausgeben, heute ist es rund ein Siebtel. 1903 gab es zum ersten Mal überhaupt bezahlte Urlaubstage – und zwar drei pro Jahr. Heute haben Menschen in Deutschland im Schnitt 32,1 Tage pro Jahr frei – ohne Feiertage. Wer zur Zeit des Zweiten Weltkriegs geboren wurde, arbeitete zu Beginn seines Arbeitslebens regulär etwa 2500 Stunden im Jahr. Heute macht eine volle Stelle 1700 Stunden im Jahr aus – das sind rund 100 Achtstundentage weniger.
Immer mehr Menschen erscheint es heute unmöglich, diese spektakuläre Erfolgsgeschichte sozialer Kämpfe und technischen Fortschritts für die Zukunft weiterzudenken: Weil sich die Macht des Menschen über den Planeten, die den Fortschritten zugrunde liegt, vor allem wegen seines Energiehungers als zunehmend zerstörerisch erweist. Und weil die Fortschrittsgewinne seit jeher ungleich verteilt sind und der Neoliberalismus diese Ungleichheit in jüngster Zeit weiter radikalisiert hat – innerhalb von Gesellschaften ebenso wie global. Das triggert Ängste vor Abstieg, Wohlstandsverlust – und nicht zuletzt auch vor Geflüchteten.
Doch weder Zerstörungen noch die Tatsache, dass die Lebenschancen zwischen heute Geborenen in Baden-Baden und in Bamako kaum ungleicher verteilt sein könnten, sind naturgegeben. Zu viele aber scheitern daran, sich die Veränderbarkeit dieser Dinge bewusst zu halten. Oder sie glauben, dass die Zeit nicht mehr ausreicht, um die Dinge zum Besseren zu wenden.
Die Zukunft ist offen
Wissenschaftliche Vorhersagen scheinen in ihrer rationalen Autorität unerbittlich. Doch so umfangreich das gesammelte Wissen heute auch sein mag – nicht alles tritt genauso ein wie vorhergesagt.
Der Wunsch, Wissen über die Zukunft zu generieren, treibt die Menschheit seit den Anfängen ihrer Geschichte an. Rolf Scheuermann vom Heidelberger CAPAS erinnert daran, dass die Menschen seit jeher glauben, bei Prognosen die Forschung auf ihrer Seite zu haben – auch, als sie sich noch auf Prophezeiungen oder Astrologie verließen. Auch darin habe einst viel mathematische Berechnung gesteckt. „Später wird man vielleicht auf die Prognosekräfte von heute genauso schauen wie wir jetzt auf die alten“, sagt Scheuermann. Denn nicht nur der Stand der Wissenschaft verändere sich stetig, sondern auch die Vorstellung davon, was Wissenschaft ist.
An der Notwendigkeit, auf Grundlage des heutigen Wissensstandes gegen die Klimakrise vorzugehen, ändert das nichts. Doch kann der Gedanke an die begrenzte Aussagekraft düsterer Prognosen allemal dabei helfen, sich von ihnen nicht lähmen zu lassen und Vertrauen in den Selbsterhaltungstrieb der Menschheit zu bewahren.
Der Historiker Stefan Brakensiek hat erforscht, wie frühere Gesellschaften angesichts einer als unsicher wahrgenommenen Zukunft gehandelt haben. Schon vormoderne Gesellschaften hätten „Kontingenzmanagement“, also eine Vorbereitung auf mögliche Risiken betrieben. „Für die meisten Gesellschaften war das handlungsleitend.“ Und das Potenzial, das Handeln an krisenhafte Erscheinungen anzupassen, sei zuletzt „extrem gewachsen“, sagt Brakensiek. Eigentlich gute Voraussetzungen für die Krisen von heute also. Und trotzdem erscheint die angemessene „Vorbereitung auf das Mögliche“ heute vielen unrealistisch: Wie soll etwa die Macht der Fossillobby gebrochen werden, wenn sie selbst bis an die Spitze der Weltklimakonferenz reicht und die COP28 im Dezember 2023 in Dubai vom Chef des staatlichen Ölkonzerns von Abu Dhabi geleitet wird?
Die „offene Zukunft“, also eine, die in der eigenen Hand liegt, habe für das Selbstverständnis der europäischen Gesellschaften des 19. Jahrhundert eine wichtige Rolle gespielt, sagt Brakensiek – was vor allem eine Folge der Aufklärung gewesen sei. Doch der Gedanke an die offene Zukunft kannte auch damals schon eine Nachtseite: „Apokalyptisches Denken scheint im Imaginarium Europas tief verwurzelt und hat Aufklärung und Säkularisierung ziemlich unbeschadet überstanden.“
Wachsende Skepsis trotz zahlreicher Erfolge
Einiges deutet darauf hin, dass sich dies in den vergangenen Jahrzehnten verstärkt hat. Das Hamburger Institut für Sozialforschung hat den Wandel des Fortschritts- und Zukunftsverständnisses der westdeutschen Linken seit 1980 untersucht. Diese Phase der „Geschichte nach dem Boom“ der 1950er bis 1970er Jahre sei gekennzeichnet von „wachsender Fortschrittsskepsis“ und einem „schwindenden Glauben an große Sozialutopien“, schreiben die Forscher:innen. „Der Zukunftsoptimismus, der bis dahin das moderne Denken gekennzeichnet hatte, schien durch Vorstellungen ersetzt zu werden, in der die Zukunft einer Gestaltung durch den Menschen entzogen war.“ Das stellte die ideengeschichtlichen Wurzeln der Neuen Linken infrage: den Fortschrittsglauben des Sozialismus.
Zwei Faktoren waren dafür zusammengekommen: Ein gewachsenes Bewusstsein für die Gefahren der technischen Moderne und die Unfähigkeit, nach dem Zusammenbrechen des Sozialismus 1989 ein zugkräftiges Gegenmodell zum Neoliberalismus zu entwickeln. Die mexikanischen Zapatistas vermochten mit ihrem Aufstand 1994 kurzzeitig Aufbruchstimmung zu verbreiten. Doch ihre Idee von einer alternativen Globalisierung hatte in der Zeit des „Kampfes gegen den Terror“ nach 2001 keinen Bestand. In diesem Vakuum machte sich die Zukunftsskepsis breit – und hält sich.
Die guten Nachrichten von heute verhallen da schnell. Wer spricht schon davon, dass in Deutschland Mitte Juni 2023 nur halb so viel Kohlestrom wie in der gleichen Woche im Vorjahr produziert wurde? Dass die Solarstromproduktion exponentiell wächst? Dass 2023 die Ökostromerzeugungskapazität weltweit um mehr als ein Drittel ausgebaut wird – und 2024 noch einmal? Dass es im globalen Automobilmarkt einen „Kipppunkt weg vom Verbrenner“ gibt? Dass es Forscher:innen kürzlich gar gelang, Strom aus Luftfeuchtigkeit zu gewinnen?
An den Filterblasen und Timelines vieler, denen solche Nachrichten neuen Mut geben könnten, rauschen sie einfach vorüber. Was hängen bleibt, sind die steten Negativrekorde. Über die Vorbereitung auf die Klimakonferenz COP28 in Dubai schrieb der Journalist und Klimaexperte Bernhard Pötter: „Wenn wir denken, dass es aus ist, dann ist es wirklich aus.“ Und vielleicht heißt das auch: Erst wenn wir denken, dass es aus ist, ist es wirklich aus.
Mit Fridays for Future wurde die globale Klimabewegung in nur wenigen Jahren zur größten sozialen Bewegung überhaupt. Ohne eine solche wird es nicht gelingen, den notwendigen politischen Druck aufzubauen, um die Lobbymaschinerie der Fossilindustrie zu stoppen und sie daran zu hindern, die verbleibenden Brennstoffe aus der Erde zu holen. Es braucht die Klimabewegung, um gleichzeitig das legitime Interesse an billiger Energie vor allem im Globalen Süden mit ökologischen Erfordernissen in Einklang zu bringen.
Die globale Mobilisierung für das Klima gibt Hoffnung, die Welt vor ihrer Zerstörung schützen zu können. Gleichzeitig konkurriert sie mit autoritären Krisenantworten, die heute zunehmend Anklang finden: Eine kürzlich veröffentlichte Befragung des Progressiven Zentrums unter Teilnehmer:innen der sogenannten Montagsdemos in Gera und Chemnitz offenbarte ein „tief sitzendes Misstrauen gegenüber den politischen Akteur:innen“ sowie „Antiamerikanismus und Nationalismus“. Viele der Befragten sind der Meinung, klimapolitische Maßnahmen wie der schnelle Umstieg auf erneuerbare Energien würden „den Industriestandort Deutschland gefährden“. Verantwortung trage Deutschland zuallererst für das Wohlergehen der Deutschen. Verbreitet waren unter den Teilnehmenden auch die Ablehnung politischer Parteien und ein Wunsch nach Unmittelbarkeit, also ein autoritäres und antiliberales Politikverständnis. „Den Befragten dienen diese Elemente zur Interpretation der Vielfachkrise der letzten Jahre“, schreibt das „nd“.
Solche Einstellungen sind heute nicht nur in westlichen Gesellschaften weit verbreitet. Sie sind Ergebnis einer autoritären Wende und populistischer Agitation, die Krisen nur als Folge korrupten Elitenhandelns zu interpretieren imstande ist. Und sie lassen die Räume für fortschrittliche Antworten auf die Krisen dramatisch schrumpfen. Doch dem lässt sich entgegentreten. Etwa mit der Suche nach einem „Kosmopolitismus von unten“, dem Tasten nach neuen Formen einer globalen Demokratie, der Suche nach „gemeinsamen Welten“ und Formen solidarischen Zusammenwirkens als Gegenmodell zum autoritären Nationalismus.
Wohin soll die Veränderung führen?
Der Unterschied zwischen fortschrittlichen und autoritären Antworten auf die Krise lässt sich dabei nach der Politikwissenschaftlerin Nadja Meisterhans als Unterschied zwischen Dystopie und Apokalypse beschreiben: In der Dystopie steckt „ein latentes Moment der Utopie“. Im Gegensatz zum apokalyptischen Denken arbeite die Dystopie nicht mit Prophezeiungen des Weltuntergangs, Verschwörungsideen oder angeblichem absoluten Wissen. Sie sei vielmehr ein Weckruf, sie frage, was passiert, wenn die Macht- und Herrschaftsstrukturen nicht verändert werden. Die dystopische Erzählung könne das Unbehagen und manifeste Leiden „fantasievoll benennen“ und in der Kritik des Bestehenden zumindest implizit auf Veränderbarkeit zielen und diese so ermöglichen.
Die Philosophin Eva von Redecker glaubt, dass die Vorbereitung auf das Kommende nur darin bestehen könne, das Teilen zu üben. Das Privileg des 21. Jahrhunderts werde sein, nicht reisen, auswandern oder gar fliehen zu müssen. Sondern einen Ort zu haben, der bestehen bleibt, von dem man nicht weg muss. Andere, wie der Soziologe und „Blätter“-Mitherausgeber Ulrich Brand, verweisen auf die Notwendigkeiten des Umbaus der Ökonomie, für den es nach einem „Vierteljahrhundert neoliberaler Gehirnwäsche“ jedoch vielfach an Vorstellungskraft und Akzeptanz mangele. „Die Orientierung an ökonomischem Wachstum ist tief in die Institutionen und Denkweisen kapitalistischer Gesellschaften eingelassen“, schreibt Brand. Dem sei nicht mit abstrakten Ideen wie „weniger Wachstum ist besser“ zu begegnen, sondern nur mit einer Infragestellung von „tief verankerten gesellschaftlichen Sinnzusammenhängen“, etwa der Auto-Mobilität. Nur so könne der „stumme Zwang der ökonomischen Verhältnisse“ in einen demokratischen Prozess stärkerer Planung überführt werden. Brand schrieb das schon 2005. Die Reaktionen etwa auf das Gebäudeenergiegesetz der Ampelregierung im Mai 2023 zeigen, wie recht er hatte: Der Versuch einer an den ökologischen Notwendigkeiten orientierten politischen Planung konnte allein mit der Aktivierung fehlgeleiteter Affekte („Heiz-Stasi“, „Freiheit“) zurückgeschlagen werden.
Eine andere Möglichkeit von Fortschritt und Veränderung, die weniger auf der gesamtgesellschaftlichen als auf individueller Ebene angesiedelt ist, hat der schwedische Arzt Hans Rosling beschrieben. In seinem 2018 erschienenen Weltbestseller Factfulness verweist er auf die Fortschritte in der Welt – und wie sehr Menschen diese unterschätzen. Rosling versucht damit, Ängste zu lindern und Energien in konstruktives Handeln umzuleiten. Er bezeichnet sich als „Possibilisten“ und vertritt die Auffassung, dass der Fortschritt auch am Einzelnen hängt. Das trifft nicht nur auf Menschen wie Greta Thunberg zu. Schon ein Blick auf das, was die Zivilgesellschaft heute etwa an den europäischen Außengrenzen oder im Mittelmeer leistet, bestätigt Roslings Auffassung: Innerhalb weniger Jahre hat eine anfangs sehr kleine Gruppe Freiwilliger aus dem Nichts eine Infrastruktur zur Seenotrettung und Initiativen wie das Alarm-Phone aufgebaut. Seit 2015 dürfte dies Hunderttausenden das Leben gerettet haben. Es ist eine praktische und gleichzeitig zutiefst politische Antwort auf herrschendes Unrecht und ein Ausdruck gesellschaftlicher Gegenmacht, von der sich viel lernen lässt.
Ein Blick in die globale Zivilgesellschaft zeigt viele solcher Beispiele. Oft geht es dabei darum, Rechte einzufordern – soziale Menschenrechte etwa, wie das Recht in einer „sicheren, sauberen, gesunden und nachhaltigen Umwelt“ zu leben.
Das Recht auf Zukunft
Der Humangeograf Carsten Felgentreff von der Universität Osnabrück erforscht seit Jahrzehnten die sozialen Folgen sogenannter Naturrisiken, also etwa Dürren, Brände, Überschwemmungen – all das, was der Klimawandel in noch stärkerer Intensität mit sich bringt. Für ihn liegt der Schlüssel zur Anpassung daran auf der Ebene des Rechts. „Wenn man Menschenrecht ernst nehmen würde, würden sich viele andere Debatten erübrigen“, sagt er. „In Staaten, in denen Politiker sich in freien Wahlen legitimieren lassen müssen und wo eine freie Presse offen über Unrecht berichtet, dort verhungern Menschen nicht massenhaft.“ Felgentreff bezieht sich dabei auf den Ökonomen Amartya Sen, der sich umfassend mit dem Zusammenhang von politischer Freiheit und sozialer Entwicklung befasst hat. Die beste Antwort auf die Klimakrise seien demnach „rechtebasierte Ansätze für alle“. Denn die Härte, mit der bestimmte Krisen einzelne Menschen treffen, ist extrem ungleich verteilt. Und dies hat viel mit ihrer gesellschaftlichen Stellung zu tun. Diese zu verbessern sei künftig noch „wichtiger als Technologie“.
Vernetzung statt Verzweiflung
Positive Beispiele dafür gibt es – etwa die erfolgreichen Klimaklagen von Fridays for Future, oder die Klagen des European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) in Berlin, das mit juristischen Mitteln gegen Menschenrechtsverletzungen vorgeht. So ist die Durchsetzung des „Rechts auf Rechte“ heute die angemessene Antwort auf die gefährliche Entwicklung der Erde. Doch weiter vorstellbar ist das nur, wenn zivilgesellschaftliche Gestaltungsmacht und Selbstwirksamkeit nicht verkümmern.
Der Wissenschaftshistoriker Jürgen Renn glaubt, dass es nicht darum geht, zwischen „Beschwörung der Apokalypse und andererseits Fortschrittsglauben zu wählen“. Beides sei ein Glauben an Automatismen. Gestaltungsmacht könne sich auch nicht in Technologie erschöpfen. Die Herausforderung sei, „die Gesellschaft so zu organisieren, dass sie auf Krisen Antworten findet“. Zum Beispiel müsste hierzulande um eine Antwort auf die ungelöste Frage gerungen werden, wie die „Energiewende made in Germany“, an der sich heute so viele Debatten aufhängen, „global skalierbar“ werde. „Diese Zusammenhänge zu denken, öffentlich zu diskutieren, dafür Handlungsmöglichkeiten zu finden“ – darin sieht Renn die besten Chancen für eine wiederzuentdeckende Selbstwirksamkeit.
Würde die Gesellschaft sich „in aller Ehrlichkeit der Wirklichkeit stellen“, dann wäre das „kein Moment der Verzweiflung, sondern ein Moment der Befreiung“, sagt Luisa Neubauer, die deutsche Sprecherin von Fridays for Future. Es würde ermöglichen, für echte Lösungen einzustehen.
Die heutige Generation ist nicht die erste, die Krisen von überwältigender Dramatik erlebt und glaubt, keine Zukunft zu haben. Wirklich neu sind aber ihre Möglichkeiten, sich in noch nicht gekannter Weise zu vernetzen – und so Einfluss auf die Zukunft zu nehmen.
Das erfordert mehr als bloße Anpassung an die kommenden Katastrophen. Es verlangt die demokratische Kontrolle von Wirtschaft und Ressourcen sowie den Schutz der Natur. Denn dass dies gestern nicht gelang, hat die Probleme von heute erst so groß werden lassen. Es verlangt, Solidarität zu erhalten und zu stärken, wenn um uns herum die Ressourcen erodieren. Es verlangt, Fortschritt, Rationalität und Offenheit zu behaupten gegenüber Autoritarismus und Populismus, die das Heil in der Abschottung suchen, aber nicht finden werden. Es verlangt Fantasie für neue Ideen von einem guten Leben, das mit weniger auskommt. Es erfordert, Akzeptanz zu schaffen für Einschränkungen, vor allem aber für Umverteilung. Denn das Überleben, das so viele infrage gestellt sehen, ist heute in erster Linie eine Frage der globalen Gerechtigkeit.
Der Beitrag basiert auf dem neuen Buch des Autors „Endzeit: Die neue Angst vor dem Weltuntergang und der Kampf um unsere Zukunft“, das jüngst im Ch. Links Verlag erschienen ist. Darin finden sich auch die Quellenangaben.