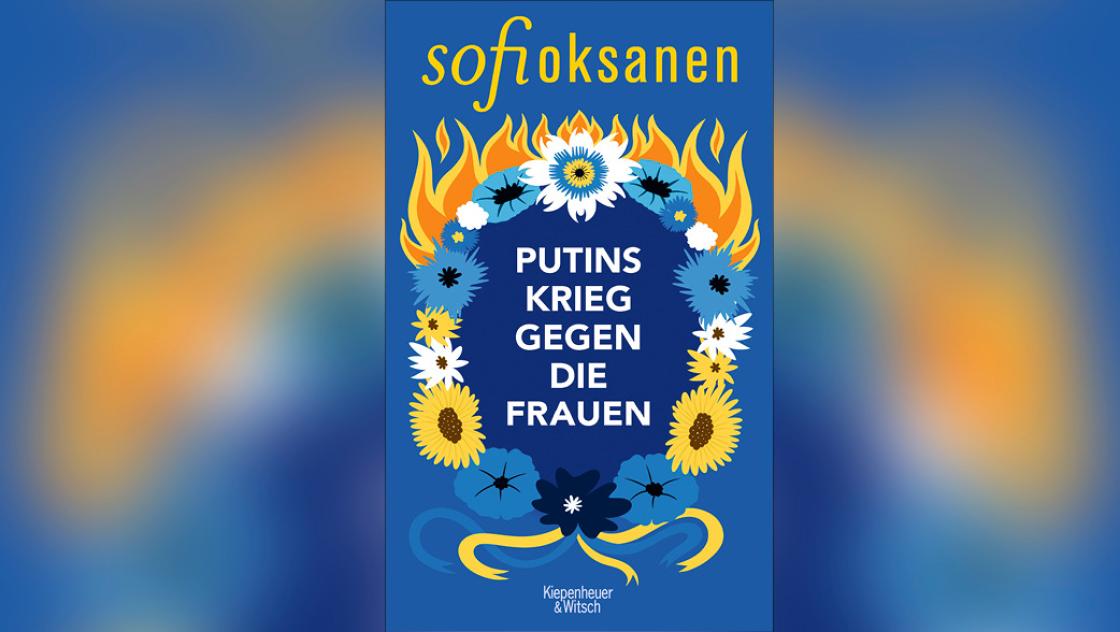
Bild: Sofi Oksanen, Putins Krieg gegen die Frauen, Cover: Verlag Kiepenheuer und Witsch
Die Brutalität der Vergewaltigungen, mit denen die russische Armee bei ihrem Angriff auf die Ukraine Städte und Dörfer überzogen hat, ist viel diskutiert worden. Die finnisch-estnische Schriftstellerin Sofi Oksanen zeigt in ihrem politischen Essay „Putins Krieg gegen die Frauen“, dass dahinter nicht nur die in militärischen Kontexten übliche Enthemmung und sexualisierte Gewalt stecken, sondern eine systemische Frauenfeindlichkeit, die das Putin-Regime kennzeichnet.
In ihren gründlich recherchierten Romanen erzählt Oksanen schon seit langem Geschichten, die in den postsowjetischen Gesellschaften Osteuropas spielen. Ihr jüngster Roman „Hundepark“ aus dem Jahr 2019 beispielsweise gibt Einblicke in die Reproduktionsindustrie der Ukraine und in die prekären Lebensumstände der Bevölkerung in den jetzt von Russland okkupierten östlichen Regionen des Landes.
Nun hat Oksanen erstmals ein politisches Buch geschrieben, fast schon ein Manifest, in Reaktion auf den Eroberungskrieg gegen die Ukraine. Ihr leidenschaftlicher Appell an Westeuropa, die Gefahren des russischen Imperialismus ernst zu nehmen, hat auch mit ihrer Familiengeschichte zu tun: Eine Großtante wurde zu Sowjetzeiten vergewaltigt, und die bedrückende Atmosphäre der Besuche bei ihrer Großmutter im sowjetisch besetzten Estland hat sich in ihre Kindheitserinnerungen eingeprägt.
Das Thema des Buches ist deutlich breiter angelegt, als es der Titel vermuten lässt. Oksanen entfaltet auf 300 Seiten die These, dass Russland im Westen oft deshalb missverstanden wird, weil man seinen Grundcharakter nicht wahrnimmt, nämlich ein Kolonialreich zu sein. Während sich die postkolonialen Studien westlicher Universitäten ausführlich mit der Ausbeutung Afrikas und Amerikas beschäftigen, nahmen sie die von Russland ebenfalls bereits im 18. und 19. Jahrhundert kolonialisierten Gebiete, etwa in Sibirien oder auf der Krim, bislang fast gar nicht in den Blick. Dabei gibt es viele Parallelen, insbesondere die Unterwerfung indigener Bevölkerungen, die Zerstörung ihrer Kulturen und die Ausbeutung von Arbeitskraft und Rohstoffen. Das Sowjetreich gründete sich durch die militärische Niederschlagung von Befreiungskämpfen im Baltikum und in der Ukraine. Die Bevölkerungen dieser Regionen wurden „russifiziert“ und ihre kulturellen Identitäten brutal unterdrückt oder als russisch ausgegeben. Die Ausbeutung von Menschen und Rohstoffen durch die Zentralregierung in Moskau galten als „brüderliche Kooperation“ und damit als legitim. Im Gegensatz zu den Kolonien Westeuropas wurden die russischen Kolonien nie dekolonialisiert. Während der europäische Kolonialismus im 20. Jahrhundert endete, bestand der russische unter dem Deckmantel einer vermeintlich sozialistischen Sowjetunion fort.
Oksanen wirft dem Westen nun vor, die russische Sichtweise übernommen zu haben: Künstler unterschiedlicher ethnischer Herkunft werden bis heute als „russisch“ eingeordnet, das Streben nach nationaler Eigenständigkeit wird diskreditiert: „Die von Russland miserabel behandelten Völker haben im kulturellen Bewusstsein des Westens kein international erkennbares Gesicht: keine Anne Frank aus den vergangenen Jahrzehnten, keinen George Floyd aus dem vergangenen Jahrhundert“, schreibt Oksanen. Möglich war das auch, weil der russische Kolonialismus nicht auf einem biologisch begründeten Rassismus fußte: Wer in die Russifizierung einwilligte und auf die eigene Kultur, Sprache und Tradition verzichtete, auf demokratische Rechte, ökonomische Freiheit und die Möglichkeit, politische Meinungen zu äußern, konnte sich assimilieren.
Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion gab es eine kurze Phase der Liberalisierung und die Möglichkeit nationaler Unabhängigkeit für Länder wie Lettland, Litauen, Estland, die Ukraine, Moldau, Georgien und andere. Doch mit dem Aufstieg des Putin-Regimes ab 2001 bildete Moskau erneut imperialistische Ambitionen aus, die allerdings, wie Oksanen kritisiert, bis zum Tag des Einmarsches russischer Truppen in die Ukraine im Februar 2022 in Westeuropa ignoriert wurden, allen Warnungen aus osteuropäischen Ländern zum Trotz: „Die Unlust des Westens, den russischen Imperialismus zu sehen, hat zu einer Situation geführt, in der Russland sich jahrelang auf Krieg und Völkermord vorbereiten konnte, ohne dass das im Westen verstanden wurde.“
Ein Grund dafür ist das Unverständnis für russische Propaganda und für die Art und Weise, wie sie Begriffe prägt und Erinnerungen lenkt. Dass etwa der Zweite Weltkrieg in Russland als „Großer vaterländischer Krieg“ bezeichnet wird, sei keine bloße Semantik: In russischer Logik war das Verbrechen der Deutschen nicht der Holocaust, sondern der Angriff auf die Sowjetunion. „Entnazifizierung“ bedeutet dementsprechend nicht den Kampf gegen Totalitarismus oder Antisemitismus, sondern gegen alles, was die Integrität des russischen Imperiums gefährden oder infrage stellen könnte. Der Begriff „Faschismus“, so Oksanen, diene als Metapher für alle, die sich der Glorifizierung Russlands widersetzen oder sich nicht „russifizieren“ lassen wollen. Deshalb werde bereits der Bezug auf eine eigene, nichtrussische Kultur als „faschistisch“ gebrandmarkt und diene als Legitimation für Unterwerfung und Brutalität. Wenn Putin den Krieg gegen die Ukraine als Kampf gegen den Faschismus bezeichnet, habe das also nichts mit rechtsextremen politischen Kräften zu tun. Solche Kräfte gibt es in der Ukraine genauso wie in allen demokratischen Ländern Europas, aber das ist nicht das, was Putin meint.
Das Unverständnis des Westens
Im Westen werden Äußerungen Putins oder moskautreuer Medien oft als irrational beschrieben. Doch die langfristig angelegten Desinformationskampagnen funktionieren und prägen Meinungen. In Bezug auf die Ukraine begannen sie unmittelbar nach der „Orangen Revolution“ von 2004. Oksanen konstatiert eine Kontinuität zwischen dem Putin Regime und der Sowjetunion, letztlich sogar bis zurück ins Zarenreich. Nach 1990 habe sich lediglich das übergreifende Narrativ verändert, mit dem Moskau Verbündete im Ausland sucht und findet: Was zu Sowjetzeiten die weltumspannende sozialistische Solidarität war, ist heute die Bewahrung vermeintlich naturgegebener Familienformen und Geschlechterbeziehungen. Die Ablehnung einer „westlichen Genderpolitik“ sichert Putin nicht nur die Unterstützung der orthodoxen Kirche, sondern auch die von Autokraten, rechtsextremen Parteien und christlich-fundamentalistischen Netzwerken weltweit.
Ein besonders frauenfreundliches Land war Russland zwar nie, und die frühen sowjetischen Versuche, patriarchale Geschlechterverhältnisse aufzulösen, wurden schon unter Stalin größtenteils wieder zurückgedreht. Doch eine zentrale Rolle in der imperialistischen Strategie spielt das Thema erst seit Putins Amtsantritt im Jahr 2001. Zu diesem Zeitpunkt hatten russische Männer eine sehr geringe Lebenserwartung und die Geburtenrate war äußerst niedrig. Gleichzeitig hatte das „Antigender“-Narrativ, das der Vatikan 1995 bei der Weltfrauenkonferenz in Peking etabliert hatte, bereits in autoritären und fundamentalistischen Bewegungen Fuß gefasst. Als Putin versprach, das „Chaos“ der 1990er Jahre zu beenden und in Russland wieder geordnete Verhältnisse herzustellen, spielte die Betonung traditioneller Familien- und Geschlechterverhältnisse eine Schlüsselrolle. Es war kein Zufall, dass sich die ganze Härte der staatlichen Verfolgung dissidenter Bewegungen gegen die feministische Gruppe Pussy Riot richtete, deren regimekritische Aktionen 2011 für Aufsehen sorgten. Seither wurden feministische oder LGBTQ-Projekte und Bewegungen in Russland systematisch zurückgedrängt und ist insbesondere auch Gewalt gegen Frauen wieder gesellschaftsfähig geworden. 2017 sorgte ein neues Gesetz für die weitgehende Entkriminalisierung häuslicher Gewalt. Jede Kritik an solchen Verhältnissen, so Oksanen, werde als westliche Indoktrination gebrandmarkt.
Immerhin sei infolge des Kriegs gegen die Ukraine im Westen ein Bewusstsein für die imperialistischen Ansprüche Russlands gewachsen. Oksanen deutet das als Hoffnungszeichen: „Vielleicht ist die Linse des Exotismus und des westlichen Orientalismus über Osteuropa und dem Baltikum endlich zerborsten. Das hat erst der tapfere Widerstand der Ukraine geschafft, und in diesem Widerstand höre ich die Stimme meiner Großtante.“
Sofi Oksanen, Putins Krieg gegen die Frauen. Kiepenheuer und Witsch, Köln 2024, 336 Seiten, 24 Euro.









