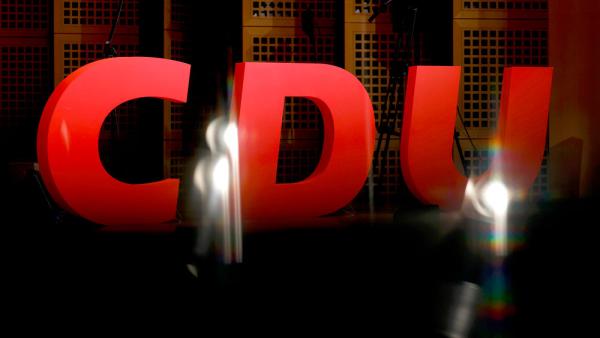Lehren aus der Geschichte des Austrofaschismus

Bild: Herbert Kickl auf seiner »FPÖ-Heimattour« im Freizeitpark Micheldorf, 24.10.2023 (IMAGO / Rudolf Gigler)
Österreich wählt 2024 und alle Umfragen sehen die FPÖ, an deren Spitze sich Herbert Kickl bereits als künftiger „Volkskanzler“ inszeniert, auf Platz eins. Die Partei, in vielen Aspekten der deutschen AfD ähnlich, hat schon mehrmals mitregiert. Aber bewahrheiten sich die Umfragen, dann könnte die FPÖ dieses Mal sogar tatsächlich den Kanzler stellen, denn die konservative ÖVP schließt eine Koalition mit ihr nicht aus.
Bisher scheint Kickls autoritäres Drehbuch aus Kulturkampf und Institutionenverachtung zu funktionieren. Das hat verschiedene Ursachen. Eine davon: Das Land hat sich nie seiner genuin austrofaschistischen Geschichte gestellt, die vor genau 90 Jahren in den Bürgerkrieg führte. Die damalige Zerstörung der Demokratie war von einer langen Latenzperiode geprägt, die ihren ersten Höhepunkt mit der Verfassungsnovelle von 1929 erreichte. Sie bewirkte eine Machtverschiebung vom Parlament zur Regierung, stattete den Bundespräsidenten mit autoritärer Gewalt aus und entledigte sich durch eine „Umpolitisierung“ der Richterschaft der lästigen Kontrollfunktion des Verfassungsgerichtshofes (VfGH). Hans Kelsen, bis dahin Mitglied des VfGH, bezeichnete die Novelle als „den Beginn einer politischen Evolution, die unweigerlich in den Faschismus führte“.[1] Nach 1945 griff Österreich auf diese Verfassung zurück. Das Amt des Bundespräsidenten ist seither eine „tickende Zeitbombe“[2], deren Explosivität sich die FPÖ bewusst ist.
Das Jahr 1934 zählt nach wie vor zu den umstrittensten Kapiteln österreichischer Geschichte. Im Schulunterricht vieler Generationen war und ist es dem Thema „Zwischenkriegszeit“ untergeordnet, die wiederum in ihrer wirtschaftlichen und politischen Zerrüttung als unweigerlich in den Nationalsozialismus führend gelesen wird. Auf die Weltwirtschaftskrise 1929 folgte im Geschichtsbuch auch schon der „Anschluss“ Österreichs an Nazideutschland 1938: das „erste Opfer“.[3] Über die Jahre dazwischen wusste lange nur Bescheid, wer in einem sozialistisch geprägten Arbeiterhaushalt aufwuchs und die Traumatisierung des Bürgerkriegs als Teil der Familiengeschichte rezipierte. Der „verdrängte Bürgerkrieg“ vom Februar 1934 und das durch die „Maiverfassung“ gefestigte diktatorische Regime, das heute viele Namen hat, bilden in ihrer Ausblendung eine latente Konstante in der Politik der Zweiten Republik seit 1945.[4] Das 2018 zum 100. Jahrestag der Gründung der Ersten Republik eröffnete Haus der Geschichte Österreich bezeichnet jene Zeit nach langen Diskussionen als „Dollfuß-Schuschnigg-Diktatur“, thematisiert allerdings auch die Begriffe „Austrofaschismus“, „Ständestaat“, „autoritärer Ständestaat“ sowie „Kanzlerdiktatur“.
Diese Auseinandersetzung um die Begriffsdefinition ist aber nur dann von Wert, wenn sie auch die Konstituierung des Regimes nachzeichnet, den Blick für die Zerstörung der Demokratie schärft und somit Orientierungswissen für gegenwärtige politische Vorgänge in Österreich, Deutschland, Italien etc. bietet. Schon werden in Anbetracht von „Polykrise“[5] und Wahlsiegen der AfD sowie einer FPÖ, die seit Monaten in allen Umfragen führt, Vergleiche mit den 1930er Jahren gezogen, mit der Beseitigung der Weimarer Republik oder der Ersten Republik Österreich. Zu Recht: Auch wenn es markante situative Unterschiede gibt, liefern diese beiden vergangenen Republiken wichtige Anhaltspunkte für die Übergänge von Demokratien in Autokratien. Denn es gibt nicht nur einen Moment des Regimewechsels, sondern der Wandel erfolgt schrittweise, oft schleichend und anfangs für die Mehrheit der Bevölkerung unmerklich, weswegen die politikwissenschaftliche Einteilung längst nicht mehr in Gegensatzpaaren wie Demokratie und Diktatur erfolgt, sondern in hybriden Regimen von der liberalen Demokratie über die Wahldemokratie zur Wahlautokratie (bzw. „illiberalen Demokratie“[6]) bis schließlich zur geschlossenen Autokratie.
Demokratiezerstörung nach Plan
Machtübernahme, Staatsum- und Demokratieabbau, wie man sie im vergangenen Jahrzehnt bereits in Ungarn und Polen, in der Türkei, in Indien und in Donald Trumps USA beobachten konnte, folgen einem Drehbuch, einem „Playbook des Autokratismus“[7]: Wie damals sind heute wieder Abstiegsangst, „Verlustwut“[8] und ein rasend schneller gesellschaftlicher Wandel die eigentlichen Treiber für den Aufstieg der Rechtsautoritären.[9] Denn die Stabilität der Demokratie hängt von ihrer Leistungsfähigkeit ab, soziale Sicherheit zu organisieren und den gesellschaftlichen Wandel mit den aktuellen Themen von Integration der Flüchtlinge bis sozialökologischer Transformation angesichts der Klimakrise zu moderieren. Abermals sind vor allem rechtskonservative Parteien wie CDU/CSU und ÖVP gefordert, als Wächterinnen gegenüber den Rechtsextremen und Autoritären – aus den eigenen Reihen und als Koalitionspartner – zu fungieren, und scheitern daran. „Radikalisierter Konservatismus“[10] ist Ausdruck der Krise programmatisch erschöpfter Mitteparteien, die das Verhalten der Rechtspopulisten kopieren, ihnen die Verantwortung für Staatsämter übertragen und sie dadurch bei der Wählerschaft legitimieren.[11]
Beginnend mit der Finanz- und Eurokrise 2008, gefolgt von Flüchtlingskrise, Pandemie und Ukrainekrieg mitsamt Teuerung und Rezession, sind Polykrisen Brandbeschleuniger für autokratische Bestrebungen; der Ruf nach einem starken Mann bleibt nicht ungehört. Der „Tatmensch“ nach dem Muster Carl Schmitts räumt endlich auf, mistet aus, auf Kosten demokratischer Prinzipien. Er greift auf populistische Weise gesellschaftsinhärente Konflikte auf, aber nicht um sie moderierend einer Lösung zuzuführen, sondern um sie parteipolitisch auszuschlachten. Erst einmal an der Macht, werden Kontrollorgane, und allen voran die Höchstgerichte, umgebaut und mit treuen Gesinnungsgenossen besetzt, Medienhäuser aufgekauft, noch verbliebene kritische Journalisten mit Einschüchterungsklagen mundtot gemacht, das Wahlrecht geändert, Wahlkreise neu zugeschnitten, durch völkisch begründete Doppelstaatsbürgerschaften zusätzliche Wahlberechtigte geschaffen, das Parlament mit einer neuen Geschäftsordnung versehen, um die Opposition zu fesseln;[12] Institutionen, die sich dem direkten Zugriff entziehen (wie die EU), werden als „fremde Mächte“ und Staatsfeinde diskreditiert.[13]
Kulturkampf als Einstiegsdroge
Der Staatsumbau findet aber nur dann bei Wahlen Zuspruch, wenn der vorpolitische Raum bereits erfolgreich bearbeitet ist. Hier zeigen sich die eindrücklichsten Parallelen zu den Krisenjahren der Ersten Republik Österreich und der Weimarer Republik: Die Zerstörung der Demokratie bedarf der Polarisierung, die wiederum auf Diskurszerstörung mittels Kulturkampf beruht, die zuerst in Vereinen und Bürgerinitiativen, heute auf Social Media ausgetragen wird.[14] Abermals sind es Themen wie die Stellung der Frau in der Gesellschaft, ihr Zugang zu Verhütung, Abtreibung und selbstbestimmter Sexualität, die Rechte von Homosexuellen und LGBTQ-Personen, die von rechten Parteien identitätspolitisch aufgeladen und schließlich an der Wahlurne verhandelt werden. Wie der österreichische Bundeskanzler und Prälat Ignaz Seipel (1926-1929) unter dem Mantra der „wahren Demokratie“ einst Maßnahmen „zur Bekämpfung von Schmutz und Schund“ in der Sittlichkeitsdebatte der 1920er Jahre setzte, führte die PiS unter Jarosław Kaczyn´ski in Polen 2019 „LGBT-freie Zonen“ ein und verabschiedete das ungarische Parlament 2021 mit Stimmen von Fidesz und Jobbik ein Gesetz, das die Rechte von Homosexuellen und Transgenderpersonen einschränkt.
Es sind vor allem jene liberalen Komponenten der Demokratie, auf die der Kulturkampf abzielt. „Für bürgerliche Kreise sind Kulturkampfthemen die Einstiegsdroge in den Rechtspopulismus“, stellt Jan-Werner Müller fest.[15] Die Definition des Wir erfolgt nicht pluralistisch-liberal, sondern ist von Ausschlüssen gekennzeichnet, die sich aus einer bestimmten Vorstellung davon ableiten, wie ein Deutscher oder Österreicher zu sein, auszusehen, sich zu verhalten habe. Wird das Volk als homogene Einheit gedacht, mutiert die Familien- und Geschlechterpolitik zum Hebel, mit der der Nation ihr behaupteter ursprünglicher Charakter oder ihre behauptete einstige Größe wiedergegeben werden soll.[16] „Make America great again“ trifft auf „Dio, patria e famiglia”[17]. Der Übergang von reaktionären zu faschistoiden Erzählungen vollzieht sich allmählich und dient dazu, den Diskursraum ideologisch vorzubereiten, in dem ein „Volkskanzler“ später Verfassungsgerichte beschneidet, Grund- und Freiheitsrechte aussetzt und endlich das Parlament ausschaltet.
Projekt »Volkskanzler«
Der „Volkskanzler“[18] ist in Deutschland als dystopisches Szenario bekannt und dient – ähnlich wie das „Thüringen Projekt“[19] – dazu, die Gefahren durch eine autoritär-populistischen Partei zu verdeutlichen. In Österreich jedoch inszeniert sich FPÖ-Chef Herbert Kickl seit seinen Auftritten bei den Corona-Demonstrationen offen als „Volkskanzler“; der offizielle Plan der FPÖ zum Sieg bei den österreichischen Nationalratswahlen, die spätestens im Herbst 2024 stattfinden, heißt „Projekt Volkskanzler“. Da die FPÖ in sämtlichen Umfragen bei 30 Prozent und darüber liegt, ist es nicht unwahrscheinlich, dass der Plan aufgeht. Wie rasch Kickl den Staatsumbau in Angriff nehmen würde, zeigte er schon 2017, als ihn Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) als Innenminister in seiner Regierung begrüßte.
Allerdings könnte ihm Bundespräsident Alexander Van der Bellen den Weg ins Kanzleramt verstellen. Da dem direkt gewählten Bundespräsidenten die Ernennung des Bundeskanzlers zukommt und er in seiner Entscheidung vollkommen frei ist, stellt dieses Amt eine Hürde dar, die die FPÖ schon 2016 nehmen wollte. Damals standen Van der Bellen (Grüne) und Norbert Hofer (FPÖ) einander in der Stichwahl gegenüber und Hofer fiel durch sein ungewöhnliches Amtsverständnis auf. Während Österreichs Bundespräsidenten der Zweiten Republik aus den Vorkommnissen der 1930er Jahre Konsequenzen gezogen hatten und im Amt trotz autoritärer Befugnisse in vielerlei Fragen Rollenverzicht übten, meinte Hofer zu seinem Amtsverständnis befragt: „Sie werden sich noch wundern, was alles möglich ist.“[20] Er spielte auf die umfänglichen Rechte an, die die Verfassung seit ihrer Novelle von 1929 für Bundespräsidenten bereithält, die aber der Wählerschaft nicht bewusst sind.
»Wahre Demokratie«
Das Jahr 1929 ist für die Zerstörung der Demokratie weitaus bedeutender als die Österreich umtreibende Frage, wie denn nun das Regime der 1930er Jahre genannt werden darf. Krisen und Kulturkampf hatten die Gesellschaft erfolgreich polarisiert und den ideologischen Raum für die Verfassungsnovelle vorbereitet, die alle Macht an die Konservativen band und die Gewaltenteilung weitgehend aufhob. All dies war möglich, weil die liberale, rechtsstaatliche Demokratie ausgehöhlt worden war, indem man ihr Ansehen in der Bevölkerung beschädigt und „das Volk“ gegen die rechtsstaatlichen Sicherungsinstrumente einer repräsentativen Demokratie ausgespielt hatte.
Auf dieser Klaviatur spielt in der Zweiten Republik die FPÖ munter weiter: Jörg Haider griff den VfGH immer wieder an, bezeichnete ihn als „Islamistenlobby“, bezichtigte seinen Präsidenten des „unwürdigen und unpatriotischen Verhaltens“ und meinte schließlich: „Das Volk steht über dem VfGH.“[21] In die gleiche Kerbe schlug Hofer, der 2016 als Bundespräsidentschaftskandidat „Das Recht geht vom Volk aus“ plakatieren ließ und den Artikel 1 der Bundesverfassung bewusst falsch zitierte. Dort heißt es nämlich: „Österreich ist eine demokratische Republik. Ihr Recht geht vom Volk aus.“ – Ihr Recht, das Recht der Republik als Summe aller Institutionen und Rechtsnormen. Was Haider, Hofer und heute Kickl aber insinuieren wollen, ist, dass das Recht laut Verfassung direkt vom Volk ausgehe und der „wahre Volkswille“ von Parlament und VfGH verwässert würde. Mittlerweile ist die „Haiderisierung“[22] und ihre Volksrhetorik nicht nur in vielen anderen Staaten wie Ungarn, Polen, Italien und inzwischen Deutschland erfolgreich, sondern ergreift auch wieder die konservativen Parteien. So plakatierte Sebastian Kurz 2019 nach dem parlamentarischen Misstrauensvotum im Zuge des Ibiza-Skandals: „Das Parlament hat bestimmt, das Volk wird entscheiden“ – und spielte den Nationalrat gegen die „wahre Demokratie“ aus.
Der Ibiza-Skandal und die darauf folgende Regierungskrise führten vielen Österreichern erstmals die Machtfülle des Bundespräsidenten vor Augen, der damals eine Expertenregierung seines Vertrauens einsetzte. Der Historiker Oliver Rathkolb vermutet, dass sich Herbert Kickl bei seinem voraussichtlichen Wahlsieg 2024 nicht die Blöße geben wird, auf seine Berufung als „Volkskanzler“ zu hoffen, sondern eher einen sympathischeren Stellvertreter – oder noch besser eine Stellvertreterin – vorschickt, während er sich auf die nächsten Bundespräsidentschaftswahlen vorbereitet: Volkspräsident Kickl. Es braucht nämlich letztlich beide Ämter, um den Staatsumbau nachhaltig zu gestalten und die Parteiideologie ins System einzubauen. Dies kann aktuell an Polen beobachtet werden, wo zwar die PiS abgewählt ist, aber Präsident Andrzej Duda seine Verzögerungs- und Blockadetaktik gegenüber Donald Tusks neuer Regierung erkennen lässt.
Während Deutschland im Grundgesetz Lehren aus der Geschichte zog und die Macht des Bundespräsidenten begrenzte, griff Österreich als „erstes Opfer“ nach 1945 auf seine alte Verfassung in der Fassung von 1929 zurück. Somit gilt weiterhin, dass der Bundespräsident „die Republik jederzeit mit vier aufeinanderfolgenden Entschließungen in eine ganz andere Lage bringen kann“, wie der Justizminister in der Expertenregierung von 2019, Clemens Jabloner, mahnt.[23] Dazu müsste er mit der ersten Entschließung die gesamte Bundesregierung entlassen, mit der zweiten eine ihm genehme Person als Bundeskanzler bestellen, mit der dritten auf dessen Vorschlag die übrigen Bundesminister und mit der vierten auf Vorschlag dieser neuen Bundesregierung die Auflösung des Nationalrats verfügen, was Neuwahlen nach sich zieht, die – so der Plan – nun der Volkskanzler gewinnt.
Im Jahr 1930 war unter Bundespräsident Wilhelm Miklas (Christlichsoziale Partei, CSP) genau dies geschehen.[24] Damals verlor jedoch die CSP, die die Auflösung betrieben hatte, die Wahlen; die Sozialdemokratische Arbeiterpartei holte die Mehrheit, wurde aber, wie schon durchgehend seit 1920, von der Regierungsbeteiligung ausgeschlossen. Da das Bundespräsidentschaftsmanöver gescheitert war, kam der nächste Plan zum Zug, die Ausschaltung des Parlaments. Kurt Schuschnigg, später diktatorischer Bundeskanzler, stellte als Justizminister bereits im Juni 1932 Überlegungen zur Parlamentsausschaltung an.[25] Geschäftsordnungsprobleme bei der Nationalratssitzung am 4. März 1933 boten die Gelegenheit, diese auch zu realisieren. Als das Vorhaben schließlich in die Tat umgesetzt wurde, verzichtete Bundespräsident Miklas darauf, seine Rechte diesmal für die Rettung der Demokratie einzusetzen, und agierte auf Linie seiner Partei. Damit hatte er den Weg ins diktatorische Regime und in den Bürgerkrieg geebnet.
Das Verbot von Opposition, freier Meinungsäußerung und aller liberalen Errungenschaften der Ersten Republik ermöglichte die Einübung in den Faschismus, wodurch Österreich dem Nationalsozialismus am Ende nicht mehr viel entgegenzusetzen hatte.
[1] Im Original: „the beginning of a political evolution which inevitably had to lead to Fascism“, Hans Kelsen, Judicial Review of Legislation, in: „The Journal of Politics”, 4/1942, S. 184.
[2] Interview mit Oliver Rathkolb, „…was alles möglich ist“, in: „Falter“, 38/2023, S. 12-15.
[3] Vgl. Heidemarie Uhl, Das „erste Opfer“, in: „Österreichische Zeitschrift für Politikwissenschaft“, 31/2001, S. 19-34.
[4] Anton Pelinka, Der verdrängte Bürgerkrieg, in: Anton Pelinka und Erika Weinzierl (Hg.), Das große Tabu. Österreichs Umgang mit seiner Vergangenheit, Wien 1987, S. 143-153.
[5] Adam Tooze, Welcome to the world of the polycrisis, in: „Financial Times”, 28.10.2022.
[6] Die Wendung „illiberale Demokratie” wurde von Fareed Zakaria in die Diskussion eingebracht, vgl. Fareed Zakaria, The Rise of Illiberal Democracy, in: „Foreign Affairs“, 6/1997, S. 22-43. Viktor Orbán sprach 2014 von einem „illiberalen Staat”.
[7] Stefan Benedik, Tamara Ehs, Katharina Prager und Michael Schwarz, Debatte: Playbook des Autokratismus, in: Bernhard Hachleitner et al. (Hg.), Die Zerstörung der Demokratie. Österreich. März 1933 bis Februar 1934, Wien 2023, S. 313-321.
[8] Andreas Reckwitz, Das Ende der Illusionen. Politik, Ökonomie und Kultur in der Spätmoderne, Berlin 2019.
[9] Vgl. Albrecht von Lucke, Die verunglückte Demokratie, in: „Blätter“, 5/2019, S. 75-83.
[10] Natascha Strobl, Radikalisierter Konservatismus, Frankfurt a. M. 2021.
[11] Vgl. Daniel Bischof und Markus Wagner, Do Voters Polarize When Radical Parties Enter Parliament? in: „American Journal of Political Science”, 4/2019, S. 888-904.
[12] Vgl. Anna von Notz, How to abolish democracy: electoral system, party regulation and opposition rights in Hungary and Poland, in: Verfassungsblog, 10.12.2018, verfassungsblog.de.
[13] Vgl. Stephan Haggard und Robert Kaufman, The Anatomy of Democratic Backsliding, in: „Journal of Democracy”, 4/2021, S. 27-41.
[14] Vgl. Milan Svolik, Polarization versus Democracy, in: „Journal of Democracy”, 3/2019, S. 20–32.
[15] Jan-Werner Müller im Interview mit Nadia Pantel, Wie sich Europa verändert, in: „Spiegel“, 15.12.2023.
[16] Vgl. Stefan Benedik in der Debatte: Playbook des Autokratismus, S. 317.
[17] Vgl. Steffen Vogel, Giorgia Meloni und der schleichende Weg in den autoritären Staat, in: „Blätter“, 1/2024, S.13-16.
[18] Vgl. Maximilian Steinbeis, Ein Volkskanzler, in: „Süddeutsche Zeitung“, 6.9.2019.
[19] Verfassungsblog.de untersucht mit dem Thüringen Projekt, was bei einem Wahlsieg einer autoritär-populistischen Partei in Thüringen passieren könnte.
[20] Norbert Hofer, in: „ORF“, 21.4.2016.
[21] Vgl. Albert Otti und Michael Karsten Schulze, Die Gewalten auf Konfrontationskurs? Eine Fallstudie über das Verhältnis von VfGH und Regierung in den Anfängen der Wende, in: „Österreichische Zeitschrift für Politikwissenschaft“, 1/2004, S. 67-79.
[22] Vgl. Ruth Wodak, The Politics of Fear: What Right-Wing Populist Discourses Mean, London 2015.
[23] Clemens Jabloner im Interview mit Christa Zöchling, Macht und Einfluss des Bundespräsidenten, in: „Profil“, 22.4.2016.
[24] Vgl. Theo Öhlinger und Maximilian Steinbeis, Das wäre wohl so etwas wie eine Verfassungskrise, 25.4.2016, verfassungsblog.de.
[25] Vgl. Ministerratsprotokoll Nr. 808, S. 244, zit. nach: Emmerich Tálos und Wolfgang Neugebauer (Hg.), „Austrofaschismus“. Beiträge über Politik, Ökonomie und Kultur 1934-1938, Wien 1984, S. 39.