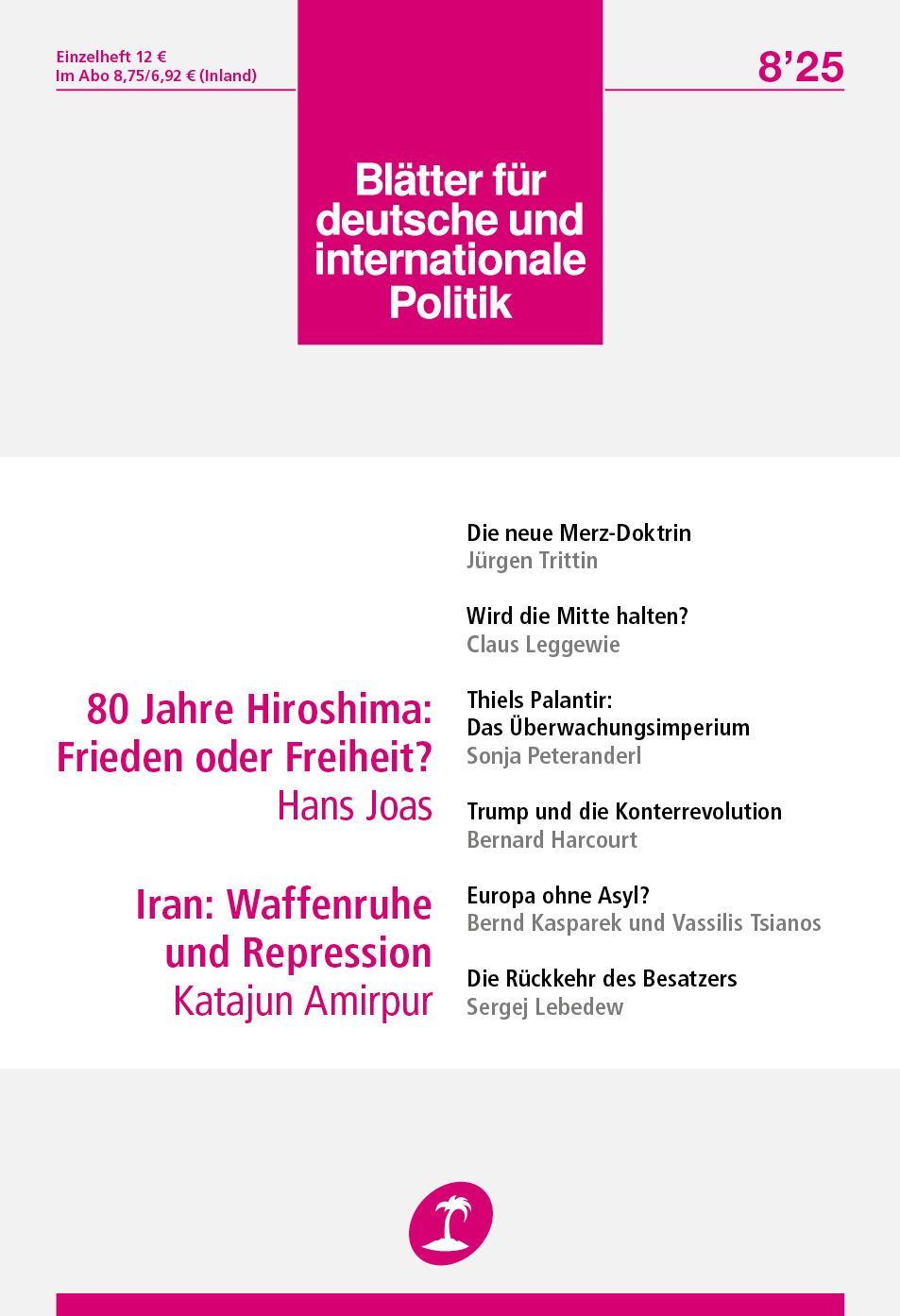Wie Europa das Asylrecht abwickelt

Bild: Flüchtende in Bussen am Bahnhof von Budapest, 5.9.2015 (IMAGO / newspix)
In diesem September jähren sich zum zehnten Mal jene Ereignisse, die wahlweise als „Sommer der Migration“[1] oder als „europäische Flüchtlingskrise“ in die Geschichte eingegangen sind. Die Darstellungen wie auch Bewertungen dessen, was sich im Sommer 2015 in Europa abspielte, sind noch immer umkämpft, und bilden den Kern des migrationspolitischen Streits in Deutschland, der mit Angela Merkels berühmt gewordenem Satz „Wir schaffen das!“ seinen Ausgang nahm. Unstrittig ist leider der Befund, dass die populistische und extreme Rechte in Europa durch die beständige Skandalisierung des Sommers 2015 nicht nur erhebliche Wahlerfolge erzielen konnte, sondern auch den migrationspolitischen Diskurs derart ins Repressive verschoben hat, dass sich dem auch konservative und sozialdemokratische Parteien nicht mehr entziehen wollen. Erklärtes Ziel der daraus folgenden neuen, neoautoritären Migrations- und Grenzpolitik ist es nicht allein, die protektiv-verschärfenden migrationspolitischen Reformen der vergangenen Jahrzehnte fortzusetzen. Vielmehr geht es den nationalradikalen Verfechter:innen einer elektoralen Autokratie in Europa (wie auch in den USA) darum, der Migration grundsätzlich ihre Legitimität abzusprechen, sie zu unterbinden und – in ihren brutalsten Phantasien, wie sie etwa im Begriff der Remigration zum Ausdruck kommen –, rückgängig zu machen.
Die populistische und extreme Rechte in Europa hat – angefangen mit dem Brexit-Referendum 2016 – zwar immer wieder Wahlerfolge in den Mitgliedstaaten und auch bei den Wahlen zum Europäischen Parlament erzielt, ein machtvolles migrationsskeptizistisches Kraftzentrum in Europa ist in den vergangenen zehn Jahren aber noch nicht entstanden. Dafür agierten die rechten Bewegungen zu heterogen, zu national-fixiert, und auch immer wieder zu stümperhaft, wenn es in Regierungsbeteiligungen an die Umsetzung ihrer migrationspolitischen Vorhaben ging – das zeigt etwa der Kollaps der niederländischen Regierung unter Beteiligung der extrem rechten Partei der Freiheit, aber auch das skandalträchtige Agieren Matteo Salvinis in Italien.
Das aber scheint sich nun zu ändern: Ende Juni dieses Jahres nahm Bundeskanzler Friedrich Merz während des EU-Gipfels an einer informellen migrationspolitischen Runde teil, die Italiens postfaschistische Ministerpräsidentin Georgia Meloni, Dänemarks sozialdemokratische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen sowie der niederländische Premierminister Dick Schoof im Oktober 2024 initiiert hatten und die „innovative Ideen“ entwickeln soll, um Migration nach Europa zu verringern. Mittlerweile beteiligen sich mehr als 15 Staats- und Regierungschefs an dieser Runde, inklusive EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.
Denn tatsächlich sind die rechten Vorstellungen einer „Migrationswende“ (Merz) leichter propagiert als umgesetzt. Nach zahlreichen Verschärfungen lassen das europäische wie auch das internationale Recht kaum weiteren Spielraum für restriktive Reformen. Mit der Europäisierung der Asyl- und Migrationspolitik nach dem Inkrafttreten des Vertrags von Amsterdam 1999 hat die EU mit dem Gemeinsamen Europäischen Asylsystem (GEAS) ein migrationspolitisches Rahmenwerk geschaffen, welches sich im Grundsatz an den Verpflichtungen orientiert, die aus Grund- und Menschenrechten erwachsen. Diese Verpflichtungen haben der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) wie auch der Europäische Gerichtshof (EuGH) in ihrer Rechtsprechung immer wieder bestätigt und teilweise auch vertieft. Damit sind Szenarien staatlicher Omnipotenz, wie sie in den Forderungen nach einer Abschaffung des Asylrechts oder Remigration zum Ausdruck kommen, objektive Hürden gesetzt, die sich nicht trivial umschiffen lassen. Die Rechte benötigt daher tatsächlich „innovative Ideen“, um ihre migrationspolitischen Ziele zu verfolgen. Dabei lassen sich drei Strategien identifizieren: erstens der Bruch mit dem Recht, zweitens externalisierende Drittstaatskonzepte sowie drittens die Verwendung der Kategorie der „Instrumentalisierung“ von Migration.
»Innovative Ideen« zur Migrationsbegrenzung: Der Bruch mit dem Recht
Die erste Strategie im Repertoire der Rechten ist die Propagierung eines Bruchs mit dem Recht. Diese Strategie ist nicht auf das Feld der Migrationspolitik beschränkt, sondern stellt den Kern der illiberalen und antidemokratischen Tradition rechter Bewegungen dar. Dies ist aktuell prototypisch in den USA zu beobachten. Im Feld der Migrationspolitik nimmt der Versuch, das Recht zu umgehen, verschiedene Formen an. Nicht nur die niederländische Regierung fordert eine Opt-out-Regelung, also die Möglichkeit eines Ausscherens aus der europäischen Innenpolitik, wie sie bereits für Dänemark gilt. Dabei wird jedoch übersehen, dass der dänische Sonderweg in einem Zusatzprotokoll des Vertrags von Amsterdam festgehalten ist. Selbstverständlich steht es Mitgliedstaaten der EU nicht frei, sich einfach aus vergemeinschafteten Politikfeldern zurückzuziehen.
Ein anderer Vorstoß, das grundrechtliche Rahmenwerk der Migrationspolitik abzuschütteln, zielt auf die Europäische Menschenrechtskonvention. In einem offenen Brief vom 22. Mai dieses Jahres haben neun europäische Staats- und Regierungschefs – Dänemark, Italien, Österreich, Belgien, die Tschechische Republik, Estland, Lettland, Litauen und Polen – zu einem „neuen und offenen Dialog“ über die Auslegung der Konvention durch den EGMR aufgerufen. Darin appellieren sie dezidiert an eine postliberale Auslegung des internationalen Völkerrechts: „Was einmal richtig war, ist vielleicht nicht die Antwort von morgen.“[2] Auch die neue Bundesregierung sucht nach Wegen, um das Europarecht zu umgehen und damit die Zurückweisung von Schutzsuchenden an deutschen Grenzen zu ermöglichen. Dabei beteiligt sich das Bundesinnenministerium gezielt an einer rechten Geschichtsschreibung zu den Ereignissen im September 2015. Schon am ersten Tag nach seiner Vereidigung ordnete Bundesinnenminister Alexander Dobrindt in einem nur wenige Zeilen langen Brief an den Präsidenten der Bundespolizei, Dieter Romann, die Zurückweisungen Asylsuchender an den deutschen Grenzen an. Dieser Brief fand seinen Weg in die Redaktion der „Bild“, die ihn prompt unter der Schlagzeile „Historisch: Diese Unterschrift beendet Merkels Grenz-Politik! Asyl-Stopp ab SOFORT“[3] veröffentlichte.
Stutzig macht in dem Schreiben jedoch bereits der erste Satz: „[H]iermit nehme ich die mündliche Weisung vom 13. September 2015 gegenüber dem Präsidenten des Bundespolizeipräsidiums zurück.“ Was aber hat es mit dieser mündlichen Weisung auf sich? In der rechten Geschichtsschreibung über den Sommer der Migration spielt sie eine zentrale Rolle. Der Journalist Robin Alexander beginnt sein 2017 erschienenes Buch „Report aus dem Inneren der Macht“ mit ihr: „Am 13. September 2015 wurde ein bereits fertiger Befehl, Asylbewerber an der deutschen Grenze abzuweisen, in letzter Minute geändert. Aus der Ausnahme einer Grenzöffnung für einige tausend Flüchtlinge wurde ein sechsmonatiger Ausnahmezustand, Hunderttausende kamen nach Deutschland.“[4] Detaillierter schreibt er an späterer Stelle: „Nach diesem Telefonat [mit dem SPD-Vorsitzenden Sigmar Gabriel – d.A.] […] ordnet de Maizière an, dass der Einsatzbefehl umgeschrieben wird. […] Statt Zurückweisungen ‚auch im Falle eines Asylgesuches‘ werden die Polizeidirektionen jetzt angewiesen, dass ‚Drittstaatsangehörigen ohne aufenthaltslegitimierende Dokumente und mit Vorbringen eines Asylbegehrens die Einreise zu gestatten ist‘. Es wird zwar kontrolliert, aber jeder, der Asyl sagt, wird hineingelassen – egal ob er aus einem sicheren Drittstaat oder einem sicheren Herkunftsland kommt.“[5] Für Robin Alexander ist diese Weisung der eigentliche Skandal. Der schon lange fertige Einsatzbefehl, der die ausnahmslose Zurückweisung aller Schutzsuchenden an den Grenzen Deutschlands vorsah, wurde kurzerhand entschärft – wie die Erzählung Alexanders suggeriert, als Ergebnis ominöser Telefonate auf höchster Ebene. Interessanterweise scheint allerdings nur Robin Alexander selbst den Inhalt dieser mündlichen Weisung zu kennen. Nicht einmal dem Bundesinnenministerium ist sie bekannt. Als Antwort auf eine Anfrage ließ es am 10. Juni 2025 mitteilen, dass „die von Ihnen erbetenen Informationen im BMI nicht vorliegen“.[6] In den Memoiren des damaligen Bundesinnenministers de Maizière wie auch in der Autobiographie der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel wird diese Begebenheit dezidiert anders, aber übereinstimmend geschildert: Im Lagezentrum des Bundesinnenministeriums wurde der Einsatzbefehl demzufolge ausgiebig diskutiert. Die Führung der Bundespolizei – schon damals war Dieter Romann ihr Präsident – pochte auf die Zurückweisung aller Schutzsuchenden, doch die Mehrheit der Jurist:innen im Innenministerium kam zu der Einschätzung, dass dies europarechtswidrig sei.[7] Die Ausführungen de Maizières darüber, wie es 2015 zur Abänderung des Einsatzbefehles kam, beschreiben nicht eine kurzfristige, willkürliche Entscheidung, sondern stellen diese als Ergebnis einer juristischen Prüfung dar, wie man sie sich von der Exekutive wünscht. In Dobrindts Brief hingegen wird das Fehlen jeglicher juristischer Begründung für den von ihm eingeleiteten Politikwechsel durch den Verweis auf die ominöse mündliche Weisung von 2015 zu kaschieren versucht. Der Rekurs auf diese erzeugt den gewollten Eindruck, dass hier nach fast zehn Jahren etwas Undokumentiertes, Anrüchiges und Illegitimes endlich beendet wird.
Doch das Gegenteil ist der Fall. Denn dass die Zurückweisungen von Schutzsuchenden an deutschen Grenzen europarechtswidrig sind, hat auch eine Kammer des Berliner Verwaltungsgerichts festgehalten.[8] In Beschlüssen vom 2. Juni 2025[9] bezüglich der Abweisung dreier somalischer Asylsuchender in Frankfurt/Oder hat dieses festgestellt, dass die Dublin-Verordnung – die ein ordentliches Verfahren zur Bestimmung des für das Asylgesuch zuständigen Mitgliedstaates vorsieht –, eine einfache Zurückweisung nicht erlaube und dass dieses Gesetz Vorrang vor dem deutschen Asylgesetz (AsylG) habe. Hervorzuheben ist, dass die Kammer zwar mit der Prüfung dreier Einzelfälle befasst war, in ihren Beschlüssen aber die rechtliche Lage auf grundsätzliche Art bestimmt hat. Dennoch sieht das Bundesinnenministerium keinen Anlass, die eigene Begründung für die Legitimität ihres Vorgehens an den Grenzen zu prüfen. Dies mag vor allem auch daran liegen, dass eine solche Begründung bisher nicht vorgelegt wurde – trotz gegenteiliger Versprechungen und Aufforderungen durch Deutschlands Nachbarstaaten. Damit aber zeigt sich: Die Strategie des Bundesinnenministeriums ist der fortgesetzte Rechtsbruch.
Ob derartige Strategien erfolgreich sein werden, lässt sich noch nicht abschließend bewerten. Festhalten lässt sich aber, dass der Bruch fundamentaler grundrechtlicher Normen zwar eine restriktive Migrationspolitik ermöglichen könnte, zugleich aber einen tiefgreifenden Schaden an Rechtsstaatlichkeit und Demokratie in Europa hinterlassen würde. Dies zeigt sich heute schon in den USA, aber auch in Ungarn und Polen.
Die zweite Strategie der rechten Migrationspolitik besteht in Drittstaatenlösungen. Auch hier gibt es verschiedene Ansätze. Eine alte Idee orientiert sich an der sogenannten Pazifischen Lösung der australischen Regierung um die Jahrtausendwende. Diese sieht vor, Schutzsuchende schon vor Erreichen europäischen Bodens festzusetzen. Schon Anfang der 2000er Jahre wurde dieser Ansatz als Blair-Schily-Plan bekannt.[10] Ein anderer Ansatz sieht vor, dass Asylsuchende nach Erreichen europäischen Territoriums in Drittstaaten verbracht werden, um dort den Ausgang ihres Asylverfahrens abzuwarten. Die britische Regierung unter Rishi Sunak verfolgte dieses sogenannte Ruanda-Modell, und auch die italienische Regierung unter Giorgia Meloni verfolgte eine solche Kooperation mit Albanien.[11] Eine dritte Variante sieht die Schaffung von Abschiebezentren in Drittstaaten vor, in die abgelehnte Asylbewerber:innen verbracht werden sollen, wenn eine Rückführung in ihre Herkunftsländer nicht möglich ist.
Praxisuntauglich und teuer: Drittstaatenlösungen
Bisher sind fast alle Versuche, solche Ansätze in der Praxis umzusetzen, durch Gerichte verhindert worden. Wo sie realisiert wurden, haben sie sich als wenig praktikabel, nicht nachhaltig und vor allem teuer erwiesen. Das einschlägige Beispiel ist der EU-Türkei-Deal, also das Übereinkommen, welches im März 2016 vereinbart wurde und das Ende des Sommers der Migration markierte. Die türkische Regierung versprach damals, die Abschiebung von syrischen Asylsuchenden aus Griechenland in die Türkei zu gestatten, und ließ sich dies mit der stolzen Summe von sechs Mrd. Euro vergüten. Dennoch haben die Abschiebungen nie in nennenswerter Weise stattgefunden. Vielmehr begab sich die EU in eine Abhängigkeit von der Regierung Erdog˘ans, die sich heute insbesondere an ihrem Unvermögen zeigt, die schleichende Entdemokratisierung der Türkei auch nur ansatzweise zu kritisieren. Hinzu kommt, dass der Oberste Staatsrat Griechenlands Ende Februar dieses Jahres den gemeinsamen Beschluss des griechischen Außen- und Einwanderungsministeriums aufgehoben hat, wonach die Türkei für Schutzsuchende aus Syrien, Afghanistan, Pakistan, Bangladesch oder Somalia als sicheres Land gilt, und alle weiteren Abschiebungen in das Land unterband. Anfang Juli teilte der griechische Premierminister Kyriakos Mitsotakis mit, dass für die nächsten drei Monate die Annahme von Asylanträgen in Kreta ausgesetzt werde – ein klarer Bruch mit EU-Recht.
Auch nach dem Inkrafttreten der GEAS-Reform 2026 würden Drittstaatenkonzepte einen schweren Stand haben, denn die Reform sieht für die Abschiebung von Asylsuchenden in sichere Drittstaaten ein Verbindungselement vor. Asylsuchende, die keine tiefgreifende Verbindung zu einem solchen Drittstaat haben – die reine Durchreise reicht dafür nicht aus –, können nicht in diesen verbracht werden. Im Mai hat die Kommission daher vorgeschlagen, das Verbindungselement zu streichen. Dies würde zwar den Weg für Drittstaatenkonzepte frei machen, es ist dennoch davon auszugehen, dass diese keine effektive Strategie für eine de facto Abschaffung des Rechts auf Asyl darstellen, denn es ist schwer vorstellbar, dass es ein oder mehrere Länder gibt, die dauerhaft ein externalisiertes Asylsystem für die Europäische Union zur Verfügung stellen wollen.[12] Zumindest würden sich diese Länder eine solche Dienstleistung mit erheblichen Summen vergüten lassen.
Langfristig gefährlicher erscheint daher die dritte Strategie: das neuartige Konstrukt der „Instrumentalisierung von Migration“. Diese Kategorie wurde seit dem Frühjahr 2020 zunehmend ins Gespräch gebracht und jüngst auch an zwei Stellen im europäischen Recht verankert: im Schengener Grenzkodex und in der Krisenverordnung der GEAS-Reform. Beide werden 2026 in Kraft treten. Laut der Asyl-Krisenverordnung wird Instrumentalisierung dabei als eine Situation verstanden, „in der ein Drittstaat oder ein feindseliger nichtstaatlicher Akteur Reisen von Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen an die Außengrenzen oder in einen Mitgliedstaat fördert oder erleichtert, mit dem Ziel, die Union oder einen Mitgliedstaat zu destabilisieren, wenn solche Handlungen wesentliche Funktionen eines Mitgliedstaats, einschließlich der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung oder des Schutzes seiner nationalen Sicherheit, gefährden könnten“.[13] Der Bezug auf die „Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung“ sowie den „Schutz der nationalen Sicherheit“ lässt aufhorchen. Die Formulierung rekurriert auf den aus der deutschen Debatte bekannten Art. 72 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV), der es einem Mitgliedstaat in einer Notlage erlaubt, vom Vorrang europäischen Rechts abzuweichen. Bisher gibt es jedoch keine klaren Kriterien für eine solche Notlage, und der EuGH hat die wenigen Versuche, Art. 72 zur Anwendung zu bringen, bisher immer zurückgewiesen. Nicht zufällig nimmt jedoch auch die Bundesregierung in ihrer Argumentation vor dem Berliner Verwaltungsgericht Bezug auf die Kategorie der Instrumentalisierung. Aufgrund des Reisewegs der drei Somalier:innen werden diese als „instrumentalisierte Migrant:innen” dargestellt, woraus die Bundesregierung ein Recht ableiten will, die Verfahrensgarantien für die betroffenen Personen weiter abzusenken.
Mit der Etablierung der neuen Kategorie der Instrumentalisierung nimmt eine legalistische Strategie der Delegitimierung des individuellen Rechts auf Asyl langsam Konturen an. Ihre Gefährlichkeit liegt darin, dass es sich dabei nicht um ein rein diskursives Konstrukt handelt.[14] In perfider Weise werden Migrant:innen als Kollektiv zu Opfern der Machenschaften von Staaten oder nichtstaatlichen Akteuren erklärt, um ihnen auf diese Weise ihr individuelles Schutzrecht absprechen zu können. Im Kontext der Rückkehr des Kriegs als Mittel der Politik zeichnet sich damit eine neuartige Strategie zur Aushebelung des individuellen Rechts auf Asyl und Schutz ab. Die europäische Zivilgesellschaft wird dafür Sorge tragen müssen, dass Nationalstaaten völkerrechtlich belangt werden können, wenn sie staatliche Vergehen an Geflüchteten tolerieren. Denn Verbrechen gegen die Menschlichkeit, wie etwa kollektive Refoulements, verjähren nicht.
[1] Bernd Kasparek und Marc Speer, Of Hope. Ungarn und der lange Sommer der Migration, bordermonitoring.eu, 7.9.2015.
[2] Letteraaperta, governo.it, 22.5.2025.
[3] Historisch: Diese Unterschrift beendet Merkels Grenz-Politik!, bild.de, 7.5.2025.
[4] Robin Alexander, Die Getriebenen. Merkel und die Flüchtlingspolitik: Report aus dem Innern der Macht, München 2017, S. 6.
[5] Ebd., S. 18.
[6] Mündliche Weisung zu §18 – Einreiseverweigerung vom 13.9.2015, fragdenstaat.de, 9.5.2025.
[7] Vgl. Thomas de Maizière, Regieren: Innenansichten der Politik, Freiburg im Breisgau 2019, S. 75 ff. sowie Angela Merkel und Beate Baumann, Freiheit, Köln 2024, S. 522.
[8] Vgl. Maximilian Pichl, Zurückweisungen vor Gericht, verfassungsblog.de, 3.6.2025.
[9] Beschluss des Verwaltungsgerichts Berlin vom 2.6.2025, VG 6 L 191/25, politico.eu.
[10] Vgl. Bernd Kasparek und Vassilis S. Tsianos, Ausgelagertes Asyl im Spiegel der Geschichte des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems, externalizingasylum.info, 2024.
[11] Vgl. dies., Von Ruanda nach Albanien: Die Auslagerung des Asyls, in: „Blätter“, 1/2025, S. 17-20.
[12] Vgl. Steffen Angenendt u. a., Die Externalisierung des europäischen Flüchtlingsschutzes. Eine rechtliche, praktische und politische Bewertung aktueller Vorschläge, swp-berlin.org, 2024.
[13] VO (EU) 2024/1359, Art. 1 (3) b).
[14] Vgl. „Die Instrumentalisierung von Flüchtlingen hat eine lange Geschichte“, mediendienst-integration.de, 22.11.2021.