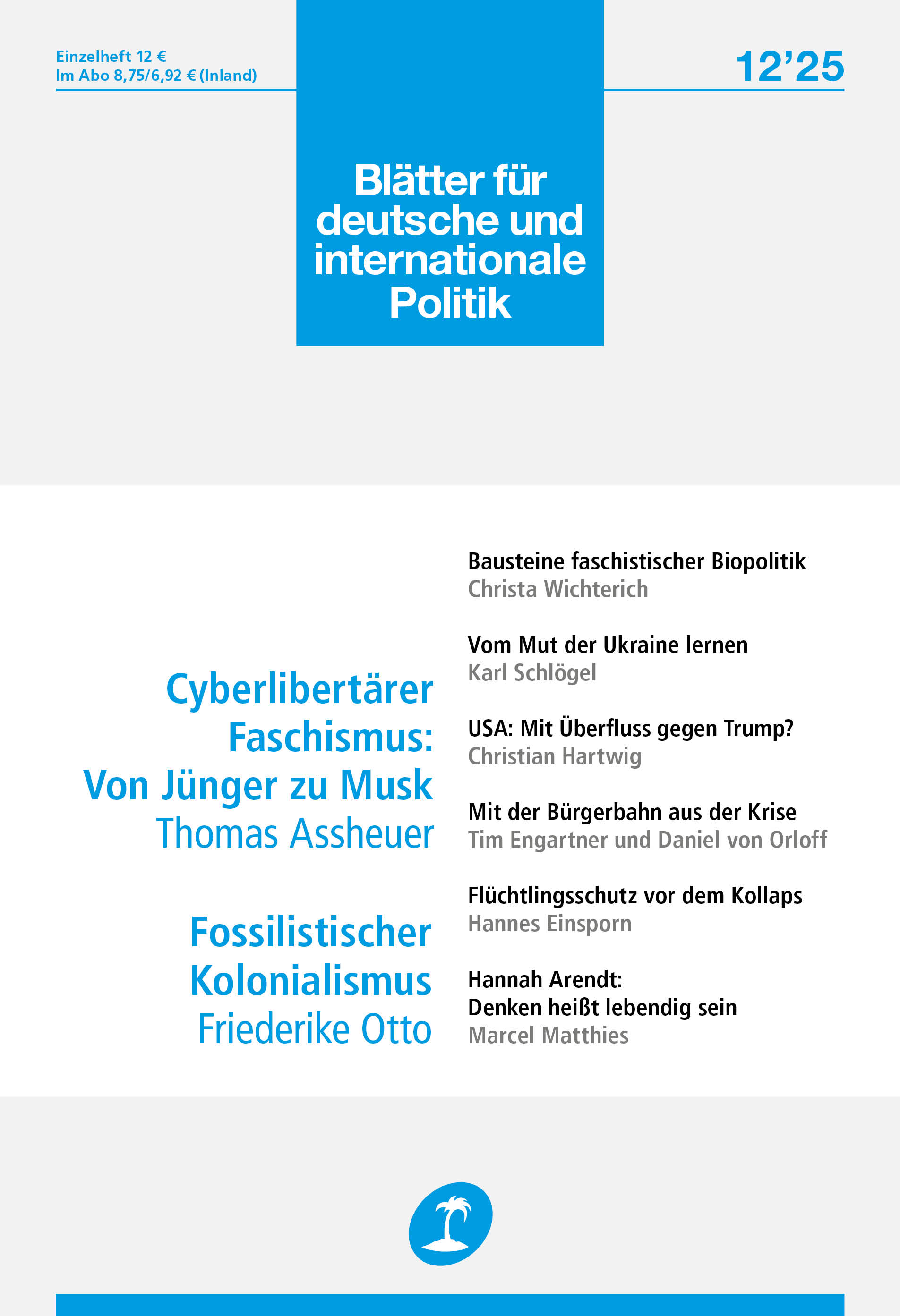Bild: »Blätter«-Mitherausgeber Micha Brumlik am 09.04.2018 (IMAGO / IPON). Er ist am 10.11.2025 nach schwerer Krankheit in Berlin gestorben.
Am 10. November starb der große Intellektuelle Micha Brumlik. Seit 1998 war er Mitherausgeber der »Blätter«; als solcher nahm er mit großer Leidenschaft an den jährlichen Herausgebertagungen teil. Vor allem aber prägte er mit seinen Artikeln das intellektuelle Profil der Zeitschrift, nicht zuletzt in ständiger Auseinandersetzung mit den Wurzeln des „Alten Denkens der neuen Rechten. Mit Heidegger und Evola gegen die offene Gesellschaft“, so der Titel seines viel besprochenen Beitrags aus dem Jahr 2016. Wir erinnern an Micha Brumlik mit einem Nachruf seines Schülers und Freundes Meron Mendel und einem beängstigend aktuellen Text aus seiner eigenen Feder, geschrieben ein Jahr nach Beginn der ersten Amtszeit von Donald Trump.– D. Red.
Als die Hamas am 7. Oktober 2023 Israel überfiel und anschließend der Krieg der Netanjahu-Regierung in Gaza begann, fragten mich viele nach der Position eines Mannes – nach der Micha Brumliks. Doch zu diesem Zeitpunkt war Micha bereits schwer krank. Am 10. November ist er in Berlin gestorben. Vielleicht war es ein Glück, dass er von den schrecklichen Ereignissen des 7. Oktober und von dem, was danach passierte, kaum noch etwas mitbekam. Es hätte ihm schwer zugesetzt, aber auch zugleich ungemein intellektuell herausgefordert. Für mich und viele andere fehlt seine Stimme daher seitdem noch mehr als zuvor: als moralischer Kompass und als politischer Intellektueller, der das Denken nie von der Verantwortung trennte. Wer, wenn nicht er, hätte erklären können, wie eine linke, aufgeklärte, humanistische Haltung zu diesem Krieg aussehen könnte!
Was Micha in besonderem Maße auszeichnete, ja sogar zu einer einzigartigen Erscheinung machte, war die ungeheure Weite seines geistigen Horizonts: Sie reichte von der jüdischen Ideengeschichte der Antike über die Aufklärung in der Linie Kant, Hegel, Fichte, Marx (stets mit besonderem Blick auf ihre antisemitischen Abgründe) bis zur politischen Theorie des 20. und 21. Jahrhunderts. Über vier Jahrzehnte hat er mit seinen Interventionen den wissenschaftlichen und öffentlichen Diskurs in Deutschland geprägt. 2016 wurde ihm für seine Verdienste um die Verständigung zwischen Juden und Christen die Buber-Rosenzweig-Medaille verliehen, später folgte das Bundesverdienstkreuz am Bande. Zu Michas publizistischem Vermächtnis gehören eine Vielzahl von Monografien und Essays, nicht zuletzt in den „Blättern“. Er war ein streitbarer Geist, ein scharfer Denker und ein brillanter Autor. Er war aber zugleich gerade kein abgehobener Wissenschaftler im Elfenbeinturm, sondern „ein Mentsch“. Warmherzig, humorvoll und manchmal auch launisch, dabei aber immer großzügig.
Persönlich habe ich Micha viel zu verdanken. Anfang der 2000er Jahre zog ich seinetwegen nach Frankfurt, um bei ihm zu promovieren. Nachdem er mich als wissenschaftlichen Mitarbeiter eingestellt hatte, kamen wir uns auch menschlich nahe. Drei Mal die Woche saßen wir gemeinsam zu Mittag in der Uni-Mensa und jeden Dienstagabend beim Italiener. Wir sprachen über Politik und den Uni-Alltag, aber auch über unser privates Leben. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie stolz ich war, als Micha mir vorschlug, zusammen einen Artikel über Menschenrechtspädagogik zu verfassen. Es zeichnete ihn aus, dass er einen jungen Doktoranden als gleichberechtigt ansah. Er gab mir Zuversicht und Selbstvertrauen bei meinen ersten Schritten auf der wissenschaftlichen Laufbahn. Aber nicht nur mir: Viele seiner Studierenden und Doktoranden sind heute Professoren.
Ein lebenslanges Ringen um Israel – und um die Demokratie
Vielleicht war es seine kurze, aber prägende Zeit in Israel, die uns trotz des Altersunterschieds besonders verband. Er freute sich über jede Gelegenheit, sein Hebräisch wieder aufleben zu lassen. Als Kind einer zionistischen Jugendbewegung hatte er geschworen, bei der ersten Gelegenheit das „Land der Täter“ zu verlassen und nach Israel zu gehen. Nach dem Abitur erfüllte er sich diesen Traum. 1967, im Jahr des Sechstagekriegs. Doch das Land, das er suchte, fand er nicht. Statt des sozialistischen Ideals empfing ihn eine andere Realität: ein Staat, der über Nacht zur Besatzungsmacht geworden war. Mit der Euphorie über den Sieg und mit den Fantasien vom „Großen Israel“ konnte Micha nichts anfangen. Er zog sich in eine antizionistische Gruppierung zurück. Als er 1968 von den Studentenprotesten in Deutschland erfuhr, kehrte er zurück. In seiner früh verfassten Autobiografie „Kein Weg als Deutscher und Jude“ (1996) schrieb er, er habe sich „unwiderruflich und endgültig“ entschieden, in Deutschland Wurzeln zu schlagen. Das war auch eine Befreiung vom Komplex seiner Mutter, die alle zwei Jahre aufs Neue auswandern wollte – und doch stets in Deutschland blieb. Die Enttäuschung über das Sehnsuchtsland Israel ließ Micha nicht los. Doch einige Jahren später, in den 1970er Jahren, prägte ihn eine weitere Erfahrung. Unter den linken Hausbesetzern in Frankfurt erlebte er den Antisemitismus im neuen Gewand. Dort begann bei ihm ein langer Prozess der vorsichtigen Wiederannährung an Israel. Später, während des Golfkriegs 1991, als Israel unter Beschuss von irakischen Scud-Raketen stand, forderte er öffentlich deutsche Lieferungen von Abwehrraketen zum Schutz der israelischen Bevölkerung – und trat bei den „Grünen“ aus, nachdem diese sich dagegen ausgesprochen hatten.
Michas Beziehung zu Israel blieb ein Ringen. Aus der romantischen Verklärung seiner Jugend und der scharfen Absage der frühen Jahre formte sich im Laufe der Zeit ein klarer, ernüchterter Blick. Sein Herz schlug für das Land und seine Menschen, doch mit wachsender Sorge sah er die Schattenseiten: die Besatzung, den Siedlungsbau, den religiösen Fundamentalismus, den Rechtsruck. Die Ideale des liberalen, sozialistischen Zionismus, die ihn einst geprägt hatten, fand er im realen Israel nicht wieder. In unseren Gesprächen schwang immer diese Ambivalenz mit: Zuneigung, Enttäuschung, ein Rest Hoffnung. Vielleicht hielt ihn genau das so lange fern. Eines Tages schlug ich ihm – halb im Scherz – vor, gemeinsam nach Israel zu reisen. Er lächelte, und ich wusste: Den Gedanken würde er nicht so schnell los. Ich organisierte ein Blockseminar, das wir beide dort leiten sollten. Kurz vor der Abreise rief er mich an: Ob wir nicht lieber ohne ihn fliegen sollten. Flugangst, sagte er. Aber auch Zweifel, ob er die Reise ertragen würde. Als wir schließlich in Tel Aviv landeten, strahlte er wie ein Kind. Er genoss die Sonne im November, das Wiedersehen mit alten deutschen Juden im Kibbuz Hazorea, die lebhaften Diskussionen an der Hebräischen Universität. Ich hatte das Gefühl, er versöhnte sich, wenigstens für diesen Moment, mit einem Teil seiner eigenen Geschichte.
In den letzten Jahren richtete sich Michas Blick zunehmend auf die Gefahren für die Demokratie hierzulande. Der Aufstieg der AfD, die Polarisierung in der Coronazeit und die Sorge um den Krieg in Europa beschäftigten ihn. Ihn beunruhigte auch, wie im Namen des Antisemitismusverdachts die Meinungsfreiheit eingeschränkt wurde. Die Debatte um die Ausladung des kamerunischen Philosophen Achille Mbembe 2019 bestärkte ihn in der Überzeugung, dass der realexistierende Antisemitismus politisch instrumentalisiert wird, um unliebsame Stimmen zum Schweigen zu bringen. Vor diesem Hintergrund lehnte er die Bundestagsresolution gegen die antiisraelische Boykottbewegung BDS ebenso ab wie die Übernahme der Antisemitismus-Definition der International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) durch die Bundesregierung. Brumlik warnte – etwas zugespitzt – in den „Blättern“ sogar vor einem neuen McCarthyismus.
Wir waren dabei nicht immer einer Meinung. Das hat unserer Freundschaft aber nie geschadet. Vielleicht sogar im Gegenteil: Unsere Kontroversen haben sie belebt. Als er 2020 ein Interview gab, in dem es auch um die IHRA ging, antwortete ich mit einer kritischen Replik. Und was geschah? Micha rief mich sofort an, um sich dafür zu bedanken. Wie ein Gelehrter in der talmudischen Epoche genoss er den Streit (wie es sein Freund Hauke Brunkhorst in seinem Gruß zum 60. Geburtstag Michas so wunderbar beschrieb, „Dich singe ich, Demokratie“, „Blätter“, 11/2007). Den Streit begriff Micha als intellektuelle Übung, niemals als persönliche Abrechnung, als engagierten Austausch von Argumenten und Gegenargumenten. Er war immer dafür offen, sich von den Argumenten der Gegenseite überzeugen zu lassen. Eine Eigenschaft, die heutzutage selten geworden ist – und derer wir doch so sehr bedürfen in den überhitzten Kulturkämpfen dieser Tage. Auch hier bleibt Micha, bleibt sein intellektuelles und menschliches Agieren, ein großes Vorbild.