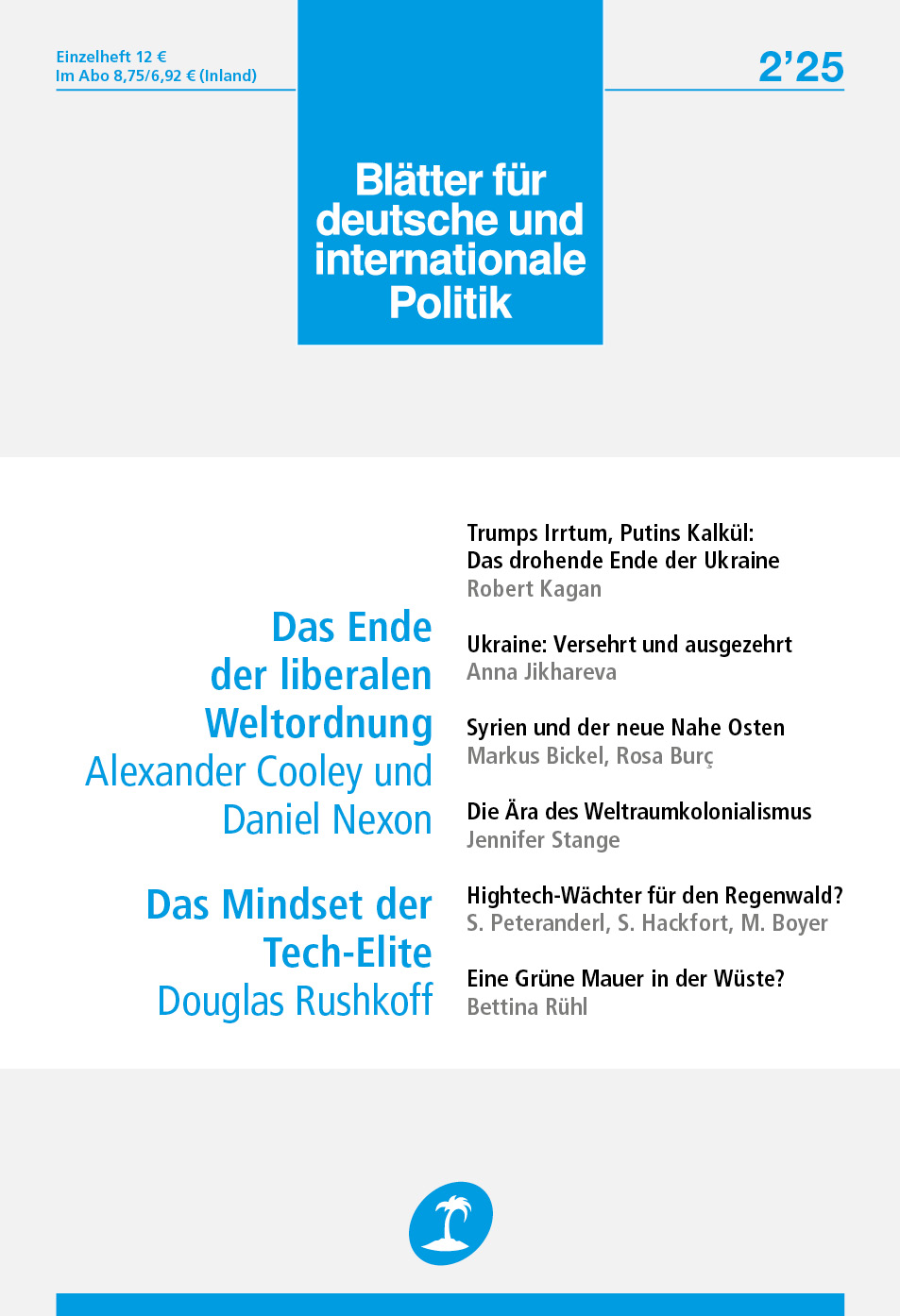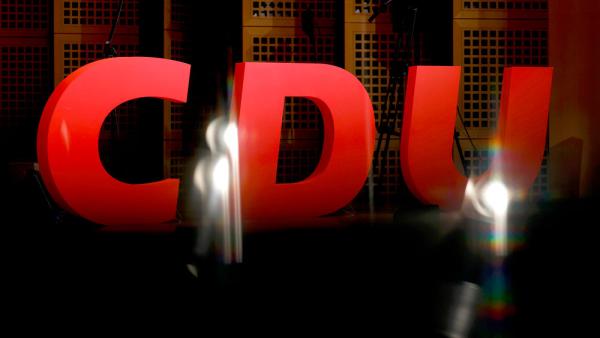Bild: Teilnehmerin einer Demonstration angesichst der sich zuspitzenden Wohnraumkrise in Dublin, 18.5.2019 (Artur Widak / IMAGO / ZUMA Press)
Fast könnte es scheinen, als sei die politische Lage in der Republik Irland wohltuend ruhig, im Vergleich zu anderen europäischen Ländern geradezu langweilig. Derzeit verhandeln die schon seit 2020 gemeinsam regierenden konservativen Parteien Fianna Fáil (FF) und Fine Gael (FG) erneut über die Bildung einer Koalition. Bei der Wahl zur Dáil, dem irischen Parlament, vom 29. November 2024 mussten beide nahezu keine Verluste hinnehmen und verbleiben bei, allerdings historisch schwachen, rund 22 und 21 Prozent. Damit fehlt ihnen aber die parlamentarische Mehrheit, da sie nur 86 der für eine Mehrheit nötigen 88 Sitze aufbringen. Sie sind daher auf die Unterstützung einer dritten Partei angewiesen. Die größte Oppositionspartei wiederum, die linke Sinn Féin (SF), hat über fünf Prozentpunkte eingebüßt. Aus der Wahl 2020 war sie noch als stärkste Partei hervorgegangen. Zudem verloren die Grünen stark, die bisher mit den Konservativen in einer Dreierkoalition regiert hatten, während die beiden sozialdemokratischen Parteien SD und Labour zulegten. Die 2023 gegründete rechte Partei Independent Ireland und die rechtskonservative Aontú zogen mit 3,6 respektive 3,9 Prozent in die Dáil ein.
Bedenkt man die massiven Rechtsverschiebungen im politischen Spektrum in Ländern wie Österreich, den Niederlanden oder Schweden, erscheint dieses Ergebnis nahezu marginal.