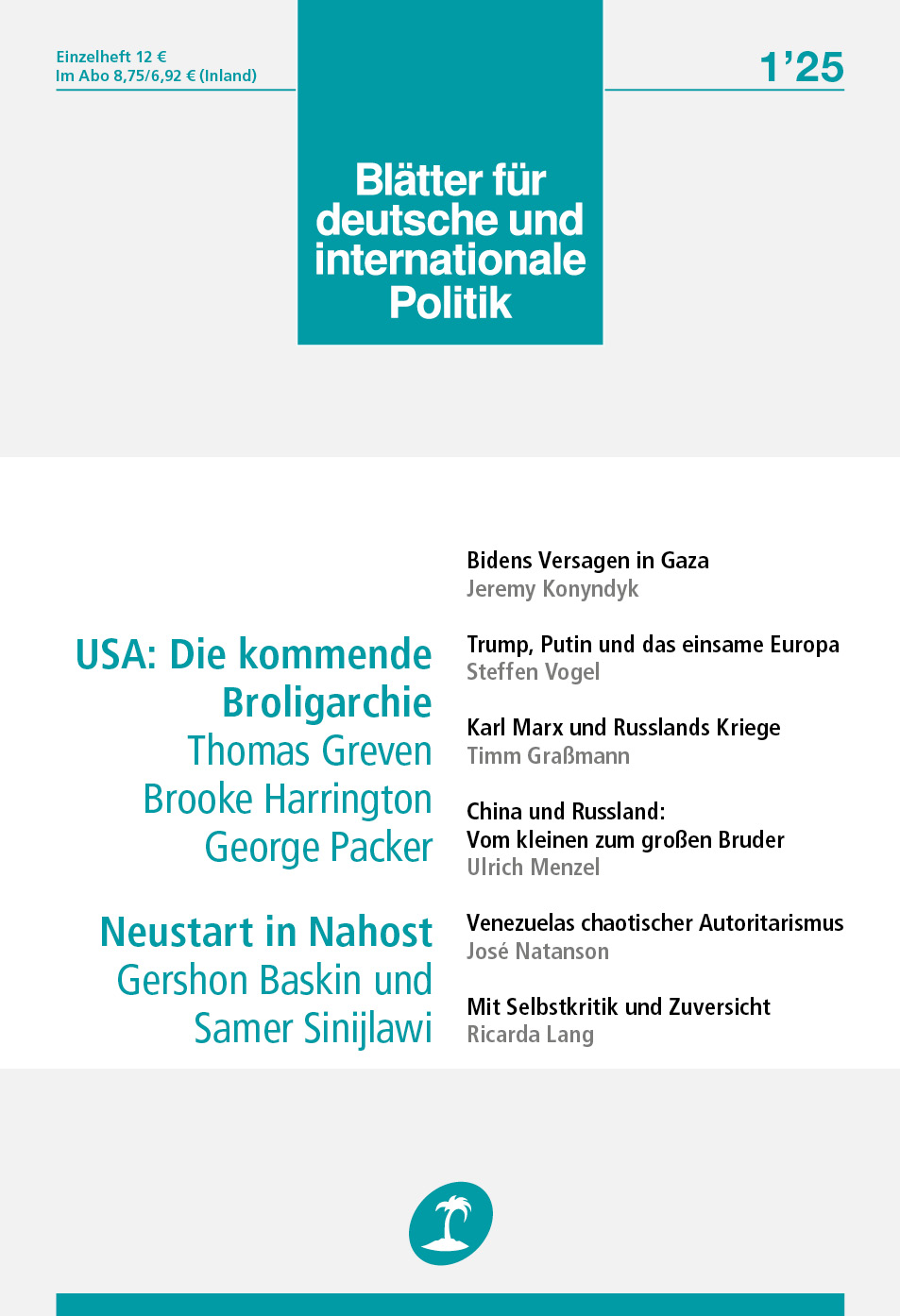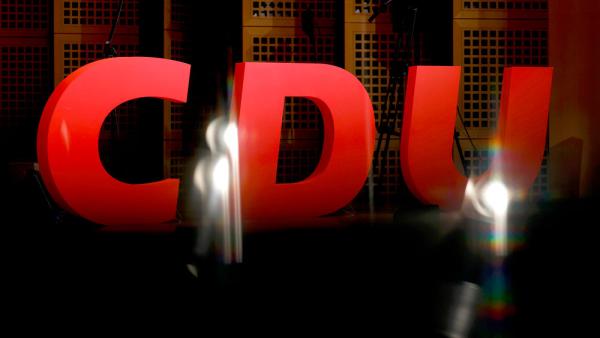Bild: CDU-Chef Friedrich Merz beim Parteitag mit der Diskussion zum neuen Grundsatzprogramm, 7.6.2024 (IMAGO / IPON)
Der Astrophysiker Harald Lesch hat vor einiger Zeit einen schönen Satz gesagt: Man dürfe nicht denken, nur weil man sich etwas denken könne, passiere das auch. Damit zog er einen Schlussstrich unter die Kernfusion, kleine modulare Reaktoren, überhaupt das Zukunftsversprechen des Atoms. Aber es gibt ja noch die Christlich Demokratische Union Deutschlands im Verbund mit der Christlich-Sozialen Union in Bayern. Deren Überlegungen gehen in die exakt entgegengesetzte Richtung – bei der Nukleartechnologie, aber auch beim größeren Ganzen: Wenn man sich etwas ausdenken kann, scheinen ihre Vordenker sich überlegt zu haben, kann man damit mindestens den Wahlkampf bestreiten.
Die Ausgangssituation vor der vorgezogenen Bundestagswahl im Februar ist recht eindeutig: Im Verbund liegen CDU/CSU in der Gunst der Wähler:innen allen Umfragen zufolge seit langem stabil auf dem ersten Platz und klar über ihrem Wahlergebnis von 2021. Ein wesentlicher Grund dafür scheint zu sein, was Statista Ende November 2024 ermittelt hat: 40 Prozent der Deutschen sehen bei der Union die höchsten Kompetenzen in Wirtschaftsfragen. Der Wert ist fast doppelt so hoch wie der für die drei Ampelparteien zusammen – und exakt vier Mal höher als das Vertrauen in die Wirtschaftskompetenz der SPD. Auch zum Kanzlerkandidaten sind die Umfragen eindeutig: Forsa beispielsweise ermittelte im Spätsommer, dass 47 Prozent Friedrich Merz zutrauen würden, die Wirtschaft wieder anzukurbeln, aber nur 16 Prozent Olaf Scholz.
Gute Gründe also für einen kurzen Blick auf die wirtschaftspolitische Ideenwelt der derzeit größten Oppositionsfraktion im Bundestag. Dabei haben Konservative traditionell eine gewisse Scheu vor Programmatik: „Richtigen ostelbischen Krautjunkern“, also einem wichtigen Teil des konservativen Fundaments, so Martin Greiffenhagen 1986 in seinem Standardwerk „Das Dilemma des Konservatismus“, seien Ideen überhaupt zuwider und Ideologien unheimlich gewesen, „sie empfanden es als skandalös, sich rechtfertigen zu müssen“. Lange wandelte die CDU Ende des vergangenen Jahrhunderts umher zwischen nationalistisch grundiertem Ordoliberalismus, Deregulierungswut und Europa als Verbundlösung, von der die deutsche Volkswirtschaft besonders profitieren sollte. Und die darauf folgenden Jahre unter Angela Merkel könnte man so zusammenfassen: Mit konkreter, nach vorn denkender Politik wurde eher niemand belastet.
Belastet wurde die Gesellschaft allerdings durch Hypotheken, die die Koalitionen unter Merkels Führung durch Politikvermeidung aufnahmen: Zukunftstechnologien wie die Solarindustrie, in der deutsche Unternehmen einmal Weltmarktführer waren, wurden aufgerieben. Politische Regulierungen wie Ausschreibungsregeln und Abstandspflichten machten der Windkraftbranche den Garaus. Die Automobilindustrie wurde darin bestärkt, am Verbrenner festzuhalten. Das Wirtschaftsmodell, günstige Energie aus Russland zu beziehen und die Welt mit hochpreisigen Maschinen des fossilen Zeitalters zu versorgen, wurde politisch als alternativloser Weg zur Glückseligkeit zementiert. Dieses Modell ist an sein Ende gelangt – das sorgt für Verwirrung. Anders sind konservative Ideen zu E-Fuels und Kernfusion ebenso wenig zu erklären wie die von Jens Spahn vermutlich eigens erfundene Kategorie des „grünen Öls“.
Abarbeiten am Gegner
Ein Problem bei der Reise durch die wirtschaftspolitischen Ideen von CDU/CSU ist die Quellenlage. Die ist übersichtlich, aber nicht direkt ergiebig: Im Sommer 2023 hielt die CDU der Regierung ein Fünfpunkteprogramm vor, im Januar 2024 verabschiedete sie ein neues Grundsatzprogramm, dazu einen Monat später noch zwölf Punkte als „Reformplan für eine starke Wirtschaft“. Ende November sollte dann eine längere Pressemitteilung die widersprüchlichen Aussagen von Friedrich Merz zur Schuldenbremse korrigieren – unter dem Titel „Deutsche Wirtschaft: Raus aus der Krise“. Mehr als luftige Absätze mit bunten Absichten, dürre Spiegelstriche oder bemüht sonore Behauptungen finden sich dort allerdings nicht. Es ist Programmatik aus dem Phrasenbaukasten und beruht auf dem Missverständnis, man sei schon solide, wenn man das so hinschreibt.
Im Kern verstehen Konservative Wirtschaftspolitik offenbar nach wie vor fast ausschließlich als Modellieren von Rahmenbedingungen. Das zumindest erklärt Merz im Bundestag: Unternehmenssteuern runter, Erbschaftssteuer abschaffen, Vorschriften weg. Merz lehnt auch eine stärkere Rolle der EU ab – gegen den europaweit wohlwollend aufgenommenen Vorschlag zu mehr gemeinsamer Industriepolitik und EU-Investitionen von Mario Draghi werde er alles tun, was in seiner Macht stehe. Und strategische Subventionen, um Transformationen anzuschieben? Mit ihm keinesfalls.
Verdichtet zeigen sich diese Widersprüche im Umgang der Union mit erneuerbaren Energien: Da sollen, fordert das CDU-Grundsatzprogramm, Dinge häufig „technologieoffen“ sein. Im nächsten Satz heißt es dann, erneuerbare Energien seien „für eine sichere und bezahlbare Energieversorgung nicht ausreichend“. Hinter jeder Ecke lauert die Dunkelflaute. Kern und Fluchtpunkt der Überlegungen ist der Schluss des Absatzes, auf den wohl von vorneherein alles zulief: „Deutschland kann zurzeit nicht auf die Option Kernkraft verzichten.“
Auch darin zeigt sich, dass der Konservatismus noch immer in einem großen Maß von einem, wie Greiffenhagen es formuliert, „definitorischen Gegner“ abhängig ist. So setzt die CDU/CSU ihren programmatischen Schwerpunkt darauf – in den Worten von Generalsekretär Casten Linnemann –, „linksgrüne Politik zu beenden“. Lauter als eigene Inhalte vorzustellen, muss noch immer dem politischen Gegner „Versagen“ vorgeworfen werden.
Bei eigenen Ideen geht es vor allem um einen Sound: Erneuerbare Energien schmecken leider arg nach den Grünen. Ein Begriff wie Transformation klingt nicht nach CDU. Also fordert die CDU in der Energiefrage überall den Bau neuer Gaskraftwerke für die Grundlast. Es wird sie nicht stören, dass das Forschungsprojekt Energiesysteme der Zukunft (getragen von der Leopoldina, der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften und der Union der Deutschen Akademien der Wissenschaften) gerade durchrechnete, dass Grundlastkraftwerke „ihre frühere, große Relevanz auf absehbare Zeit nicht mehr erreichen“ würden. Neubauten seien unrentabel.
Passend dazu wird der Rückblick auf die Kabinette Merkel in der Union immer ambivalenter: Einerseits müsste man, sagte erneut Jens Spahn, auf die zehn Jahre vor der Pandemie als „die längste Wachstumsphase in der Geschichte der Bundesrepublik“ zurückblicken (Ökonomen messen ab 2018 wirtschaftlichen Niedergang), andererseits habe der 2011 beschlossene Atomausstieg die Abhängigkeit von russischem Gas erhöht. Das sei „ein schwerer Fehler“ gewesen. Deshalb will Spahn in einer neuen Regierung vom TÜV prüfen lassen, ob sich die zuletzt ausrangierten Atomkraftwerke wieder reaktivieren ließen. Sein Parteivorsitzender immerhin hat den Ausstieg als „wohl irreversibel“ erkannt.
Kulturkampf und Generationenschelte
Das bietet, freundlich formuliert, ein heterogenes Bild. Es geht erkennbar nicht um Kohärenz, sondern um vertraute Schlüsselbegriffe, um wohlige Tonlagen. Da können Ökonomen wie Marcel Fratzscher darauf hinweisen, dass eine hohe Steuerbelastung für Unternehmen nicht das Problem sei, die läge in Deutschland deutlich niedriger als vor 25 Jahren. Eine weitergehende Studie des European Economic Review von 2022 mag durchrechnen, dass Unternehmenssteuersenkungen „keinen ökonomisch relevanten oder statistisch signifikanten Effekt auf Wirtschaftswachstum“ hätten. Doch das bringt weder CDU noch CSU von ihren Argumenten ab. Auch nicht, dass Bund und Kommunen jährlich wirtschaften müssen – bei Steuersenkungen also mit Einnahmeausfällen zu kalkulieren hätten.
Und selbstverständlich ist auch Friedrich Merz klar, dass eine von ihm geführte Regierung ein Land mit maroder Infrastruktur und zu geringem finanziellem Handlungsspielraum verwalten müsste. Deshalb wissen alle, dass an einer Reform der Schuldenbremse zumindest für investive Ausgaben kein Weg vorbeiführt – Deutschland wird 2025 mit den projektierten Investitionen auf dem vorletzten Platz aller EU-Staaten liegen. Doch bei den Debatten um eine Reform der Schuldenbremse geht es der CDU wieder vor allem um den Ton. Merz will Solidität verströmen und verweist auf die Staatsausgaben. Diese will die CDU kürzen, um ihre Steuerversprechen zu finanzieren. Eine riskante Strategie: Die Ankündigung, das Bürgergeld abzuschaffen, dürfte sich in wenig mehr als einer Namensänderung erschöpfen. Auch Konservative wissen, dass das Verfassungsgericht Unterhaltskürzungen enge Grenzen gesetzt hat – was sie vor der Wahl nicht daran hindert, eine fiktive Glamourzahl von zehn Mrd. Euro einsparbarer Mittel durchs Dorf zu tragen.
Damit aber sollen zentrale Paradigmen ins rechte Licht gerückt werden, die weniger zum Arsenal von Wirtschafts- oder Industriepolitik gehören, sondern tief aus dem Mustopf von Kulturkampf und Generationenschelte gegriffen sind: Da werden Sätze wie „Leistung muss sich wieder lohnen“ auf Papiere gestreut und von Rednern wie Linnemann gerne aufgegriffen. Es soll eine „Agenda für Fleißige“ geben. Die CDU müht sich dabei, für Leistung und Fleiß einen konkreten Ort auszumalen: In ihrer Wirtschaftsprogrammatik wendet sie sich fast ausschließlich kleinen und mittelständischen Unternehmen zu – der Assoziationsrahmen Großindustrie wirkt vermutlich zu gesichtslos und von internationalen Interessen der Kapitalfonds geprägt.
Der kaum verhohlene Subtext ist: Faulheit und staatliche Alimentierung brachten uns in die Misere. Nun soll das große Lamento über Teilzeitansprüche auch in diesem Wahlkampf die ernstere Auseinandersetzung mit Inhalten übermalen. Ein nicht ganz abwegiges Ziel: Gerade hat eine Allensbach-Umfrage festgestellt, dass eine überwältigende Mehrheit der Deutschen exakt in einer angeblich zurückgegangenen Leistungsbereitschaft den Grund für die verlorene Attraktivität des Wirtschaftsstandortes sieht.
Jedoch verdeckt diese Ausrichtung nur mühsam, warum die Union mit einer oft widersprüchlichen Haltung zu Industrie- und Wirtschaftspolitik ins Jahr geht.
Ökologische Modernisierung, konservative Verwirrung
Die Gegensätze sieht man schärfer, wenn man darauf achtet, wo und wie oft das „Prinzip Nachhaltigkeit“ in programmatische Äußerungen eingesickert ist –, ohne dass deutlich wird, wie die Union es auskleiden will. In ihrem Grundsatzprogramm ist Klimaschutz ein nachgeordnetes Kapitel.
Aber ihre Rhetorik – die Union behauptet vollmundig, sie stünde selbstredend für „nachhaltiges wirtschaftliches Wachstum“ – hilft, ihre Verunsicherung im Feld der Wirtschaftspolitik zu ergründen. Denn auch Konservative scheinen zu ahnen, dass „Wohlstand für alle“-Sprüche nach Ludwig Erhardt, Aufrufe zu mehr Leistung nach Helmut Kohl oder Blütenträume neuer Atomzeitalter keine gangbaren Wege aus Klimakrise und den geopolitischen Verwerfungen der Gegenwart weisen. Zudem hat eine mehrheitlich konservativ besetzte EU-Kommission unter Führung von Ursula von der Leyen den European Green Deal angeschoben. Zwar ging die CDU dazu im vergangenen Europawahlkampf auf maximale Distanz, aber der Ausblick auf einen „grünen Kapitalismus“ ist auch Konservativen sympathisch.
Auch wenn einige ostdeutsche Landesverbände aufgrund wahltaktischer Erwägungen näher an AfD-Positionen aus Protektionismus und Fossilwirtschaft siedeln, ist der Spagat, der an konservativen Vorschlägen zerrt, allerdings ein anderer: Die Union ahnt, dass sie über unterdimensionierte politische Instrumente verfügt – und sieht sich gleichzeitig mit der Notwendigkeit konfrontiert, ein Gegenbild zu Grünen und SPD, zu Subventionspolitik und staatlicher Steuerung zeichnen zu wollen. Im Januar will die CDU ein konkretes 100-Tage-Programm für eine Regierung unter ihrer Führung vorstellen. „Wir haben nur einen Schuss frei“, erklärt Generalsekretär Linnemann immer wieder.
Dabei bestimmt die ökologische Modernisierung längst die internationale politische Agenda, ihre Versprechen entfalten kolonisierende Wirkung. Die konservative Verwirrung entsteht dabei aus den Widersprüchen zum eigenen, fossil geprägten, Wirtschaftsdenken. Dazu kommen die Widersprüche des grünen Kapitalismus selbst.
Dessen fragiles Krisenmanagement fassen Ulrich Brand und Markus Wissen in ihren Gedanken über „Kapitalismus am Limit“ etwa so zusammen: Grüner Kapitalismus muss Wirtschaftswachstum von Ressourcenverbrauch und umweltschädlichen Emissionen entkoppeln. Kritische Rohstoffe für Produktion und Speicherung erneuerbarer Energie zu beschaffen, produziert jedoch neue Abhängigkeiten, beispielsweise von China oder Taiwan. Dazu müssen die wachsenden volkswirtschaftlichen Kosten der sich intensivierenden Klimakatastrophe gestemmt werden. All das führt zu erheblichen Legitimitätsdefiziten von Staaten und Staatenverbünden. Immer deutlicher hat sich im vergangenen Jahrzehnt gezeigt, dass nur bei steigendem Wohlstand Menschen bereit sind, demokratische Prozesse zu akzeptieren, die persönliche Kompromisse und Steuerbelastungen bedeuten. Für diese Widersprüche haben auch Konservative keine einprägsamen Antworten.
Und so haben die Vorschläge der Union vor allem theatralischen Charakter. Nur fühlt sich das Personal bei der Aufführung ein wenig unwohl in seinen Rollen und im Unklaren über die Stimmigkeit der Inszenierung. Dagegen werden die Konservativen sich wohl etwas ausdenken – und mit großer Geste noch mehr über Atomkraftwerke, Kernfusion oder Leistung sprechen.