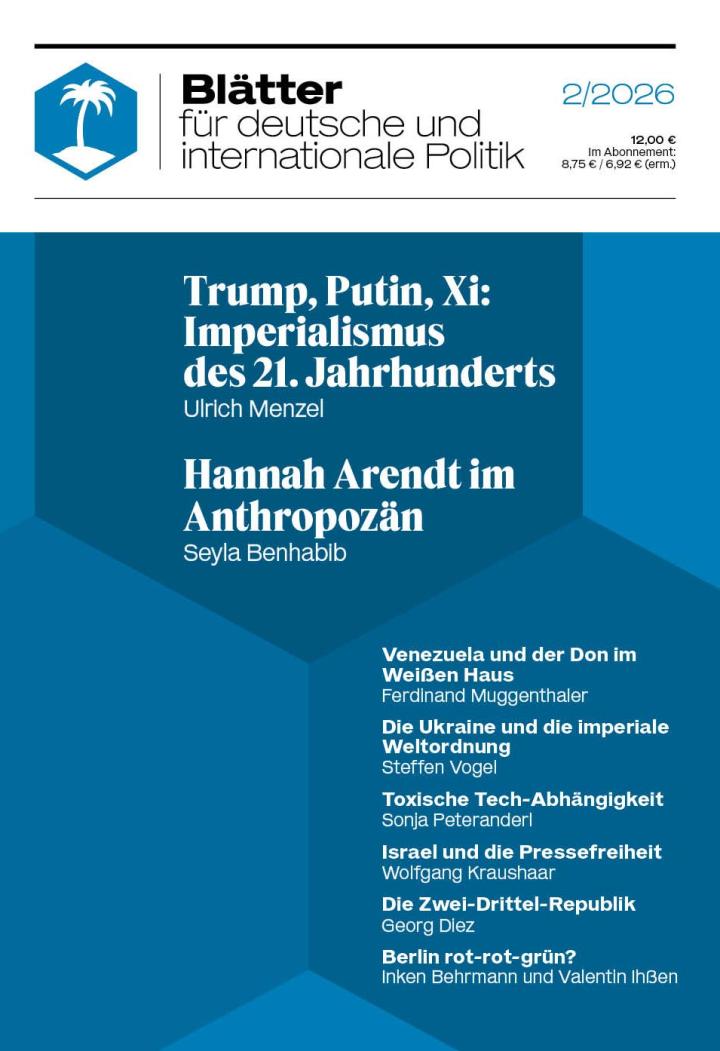Wie wir Migrationspanik und autoritärem Denken begegnen können

Bild: In kleinen Momenten des Unbehagens könnte ein Schlüssel zu mehr Miteinander und zur Bekämpfung illiberaler Tendenzen in unserer Gesellschaft liegen. (Bild: IMAGO / Ikon Images)
Rechtspopulisten finden mit ihrer rassistischen Rhetorik und ihrem Kulturkampf gegen liberale Eliten eine immer größere Gefolgschaft. Wie können diese Menschen wieder für die Demokratie zurückgewonnen werden? Während Rechtsextremen und völkischen Agitatoren keine Bühne geboten werden darf, sollten wir im Alltag das offene Gespräch mit ihren Wählerinnen und Wählern suchen – auch wenn es schwerfällt.
Das Gefühl, nicht dazuzugehören, irgendwie falsch zu sein, ist fruchtbarer Boden für die verführerischen Parolen der Rechtspopulisten. Ihr bestes Verkaufsargument sind weder eine radikale Grenzpolitik noch rigide Abschiebepläne, sondern es ist das Gefühl, das sie ihren Wähler:innen geben: Du bist genau richtig so, wie du bist. Andere mögen dich rassistisch, misogyn, menschenverachtend, abnormal finden. Wir dagegen schätzen dich so, wie du bist. Ja mehr noch: Du bist normal, die anderen sind die Aberration. Mit ihren Dragqueen-Lesungen, Gendersternchen, Menschenrechten, ihrer Cancel Culture und Klimapanik sind sie falsch abgebogen. Du dagegen bist richtig, goldrichtig.
Schon Hannah Arendt wusste, dass das Gefühl der Einsamkeit, das sie als politischen, nicht rein privaten Zustand verstand, zu den radikalsten Erfahrungen des Menschen zählt und ihn anfällig werden lässt für die Blender, Hetzer, Extremisten und Despoten dieser Welt. Die versprechen ihren Anhänger:innen Gemeinschaft und Zugehörigkeit, getreu dem Motto: Wir schätzen dich für all die Eigenschaften, die andere an dir ablehnen. Und sie vermitteln ein verführerisches Gefühl der Selbstwirksamkeit: Wir halten die Ausländer raus, aus dem einfachen Grund, weil wir es wollen – und können. Das umfassende Gefühl des Kontrollverlusts kontern sie mit Handlungsmacht und Korpsgeist. Das sei, laut Arendt, eines der »Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft« (im Original »The Origins of Totalitarianism«), ein Einfallstor für Autoritarismus und Totalitarismus.
Genau das scheint auch bei Simon zu verfangen. Wir sind befreundet – oder versuchen es zumindest zu sein. Das ist nicht ganz so einfach, denn ich bin Migrationsforscherin, setze mich für Menschenrechte von Schutzsuchenden und legale Fluchtwege ein. Und Simon ist FPÖ-Wähler. Das äußert sich in unserer Freundschaft oft tagelang gar nicht und dann wieder fast durchfallartig. Dann wettert er bevorzugt gegen Flüchtlinge und Ausländer, gegen messerstechende Jugendbanden, gegen Frauen, die sich zu viel herausnehmen, gegen die schleichende Islamisierung, gegen Systemmedien und Meinungshegemonie. Nicht selten wird er, sonst ein Verfechter der gepflegten Konversation, urplötzlich vulgär, benutzt Gewaltsprache, wirkt regelrecht paranoid – ganz so, wie es dem Typus des »rechtsextremen Agitators« in Caroline Amlingers und Oliver Nachtweys Buch »Gekränkte Freiheit« entspricht.
Das hat weder mit sozialer Deprivation noch mit fehlenden Aufstiegschancen oder wachsenden Abstiegsängsten zu tun. Rechtspopulistische Ideologie ist und war nie das Privileg der unteren 25 Prozent, der Globalisierungsverlierer und Zwangsenteigneten. Besonders in den letzten Jahren hat sie erfolgreich in der Mitte der Gesellschaft Einzug gehalten, ist in der oberen Mittelschicht und den vermögenden Klassen angekommen. Dafür steht Simon paradigmatisch, denn er ist das Gegenteil von abgehängt. Er ist weder ein deplorable, sprich: ein beklagenswerter Außenseiter, noch ein Incel[1]. Er ist ein Anywhere, ein Kosmopolit, ganz sicher kein Hinterwäldler. Ein Globalisierungsgewinner auf der Butterseite des Lebens.
Wenn da nicht einige Episoden in seiner Vergangenheit gewesen wären, die in ihm das Gefühl, on top of the world zu sein, alles im Griff zu haben, erschüttert hätten. Die ihn zur Überzeugung gebracht haben: Wenn es darauf ankommt, bist du immer allein. Du kannst dich nur auf dich selbst verlassen. Niemand hilft dir, wenn du dir nicht selbst hilfst. Hinter seinem selbstironischen Humor steckt eine gehörige Portion Zynismus und Einsamkeit.
Ein soziales Experiment für beide Seiten
Trotz alledem treffe ich Simon immer wieder, in wechselnden Wiener Innenstadtlokalen. Ich will ihn weder bekehren noch umstimmen, ihn nicht belehren oder beschämen. Dass solche Versuche fruchten könnten – so naiv bin ich nach Jahren des Austauschs mit FPÖ-Wähler:innen im engsten Familienkreis nicht. Aber ich will unsere Begegnungen zum Anlass nehmen, um ihm ein Gegenmodell der bedingungslosen Zugewandtheit ohne Hintergedanken anzubieten, das ihn womöglich seine eigenen Vorurteile über »linkslinke Gutmenschen« überdenken lässt.
Noch viel mehr aber richtet dieses soziale Experiment (auch wenn er mit dieser Bezeichnung unserer mittlerweile echten Freundschaft höchst unglücklich wäre) den Scheinwerfer auf mich und meine eigene Rolle in der radikalen gesellschaftlichen Transformation, die viele liberale Demokratien gerade durchlaufen. Denn Simon verdeutlicht exemplarisch, wie weit sich die autoritäre Wende bereits vollzogen hat, wie sehr die Verführungen der Rechtspopulisten weit in die Mitte der Gesellschaft hineinragen. Und wie untauglich die dominanten Erklärungs- und Entzauberungsversuche der linksliberalen Intelligenzija sind, wie einfach sie es sich durch ihre moralische Überhöhung macht.
Wie untauglich umgekehrt die Anstrengungen der Mitte-Parteien sind, die Rechtspopulisten durch noch härtere Migrationsrhetorik und -politik rechts zu überholen, ihren vermeintlichen »Protest« einzuhegen, den sie durch ihren Urnengang zum Ausdruck brächten. Denn wenn etwas durch die rechte Welle, die in den vergangenen Jahren durch Europa und die Welt fegte, klar geworden sein sollte, dann die Tatsache, dass Menschen rechtspopulistische Parteien nicht aus reinem »Dagegensein«, sondern aus Überzeugung wählen, weil sie die Inhalte und Positionen eines Kickl, einer Weidel, einer Meloni und eines Trump sinnvoll und gut finden. In diesem Punkt ist Simon zumindest ehrlich.
Ehrlich ist er aber auch darin, dass er, seit er mich kennt, einige Annahmen über alleinstehende, kinderlose, akademisch gebildete weiße Mittelschichtfrauen, die noch dazu an einer öffentlichen Hochschule beschäftigt und damit Teil der »Elite« sind, revidieren musste. Zähneknirschend zwar und nur, indem er mich als absolute Ausnahme, quasi als Pick me Girl der Rechten, charakterisiert – das ich aber nicht bin. Dennoch, in unserer gegenseitigen Zugewandtheit liegt eine verborgene Kraft, davon bin ich nach einem Jahr dieser herausfordernden Freundschaft überzeugt.
Wenn Abgrenzung kontraproduktiv wird
Es mag den einen oder die andere Leser:in befremden, wie man mit einem selbst proklamierten Rechtspopulisten, der regelmäßig rassistische und sexistische Sprüche vom Stapel lässt, befreundet sein, ja freiwillig Zeit verbringen kann. So einfach die Abgrenzung von rechtspopulistischem Gedankengut und jenen Menschen, die ihm anheimgefallen sind, in der Theorie ist, so komplex ist sie in der Praxis. Zum einen, weil mittlerweile fast ein Drittel der österreichischen Bevölkerung die FPÖ wählt, ebenso wie ein Drittel der Franzosen Le Pen, ein Fünftel der Deutschen AfD und die Hälfte der Amerikaner Trump. Sich von einem Drittel der Mitmenschen, die unsere Väter, Mütter, Brüder, Schwestern, Söhne und Töchter, Kolleg:innen und Mitarbeiter:innen sind, abzugrenzen, ist nicht nur unmöglich, sondern in Zeiten zunehmender Polarisierung und Blasenbildung als Ziel zu hinterfragen. Was, so die ernsthafte Frage, die wir – die wir uns auf der »richtigen« Seite wähnen – uns stellen sollten, ist dadurch gewonnen, außer das kuhwarme Gefühl der eigenen moralischen Überlegenheit?
Zum anderen greift der routinemäßige Ruf nach »Abgrenzung nach rechts« deshalb zu kurz, weil schablonenhafte Beschreibungen des/der typischen Rechtswähler:in deren Vielschichtigkeit nicht gerecht werden. So wie ich mehr bin als eine Migrationsforscherin, ist Simon mehr als ein FPÖ-Wähler. Er ist auch humorvoll und manchmal absurd komisch, er ist respektvoll und höflich in jeder Alltagsbegegnung, ob mit dem afghanischen Pizzalieferanten oder der transsexuellen Kellnerin, er ist ein verkappter Philosoph, der belesener ist als die meisten meiner Unikolleg:innen, und ein leidenschaftlicher Salsatänzer. Das sehen und noch vielmehr auch wertschätzen zu können, ist Herausforderung und Provokation zugleich. Wenn wir aber das Motto des Schriftstellers George Tabori, dass »jeder jemand ist«, auf die Verfolgten, Schutzsuchenden und Marginalisierten dieser Welt anwenden, müssen wir das folgerichtig und mit allen damit verbundenen Konsequenzen auch auf Wähler:innen rechter und rechtspopulistischer Parteien tun. Jeder Flüchtling ist jemand, aber auch jede:r MAGA-Anhänger:in ist jemand. Diese Maxime als Richtschnur für das eigene Denken und Handeln unter allen Umständen zu wahren, ist schmerzhaft, unbequem, führt zu Gewissenskonflikten und mitunter zu ethisch uneindeutigen Entscheidungen. Aber die über allem schwebende Aufgabe, der sich die offene Gesellschaft zunehmend und verstärkt wird stellen müssen, lautet: Wie lassen sich Menschen wie Simon für die liberale Demokratie zurückgewinnen?
Ausgrenzung im öffentlichen Raum, Empathie im Privaten
Ausgerechnet im Jahr 2016, als Trump zum 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt wurde, machten Forscher:innen der University of California Berkeley und der Stanford University im Rahmen eines sozialen Experiments eine hochinteressante Entdeckung, die es bis in die renommierte Fachzeitschrift »Science« schaffte. Sie wollten wissen, wie man Menschen, die transphoben und im Kern bigotten Ideen anhängen, für moderate Positionen zurückgewinnen und ihre Vorurteile reduzieren kann. Die vermeintliche Zauberformel, auf die sie stießen, ist so einfach wie überzeugend: ein offenes Gespräch. Im Rahmen der Studie wurden mehr als 500 Wähler:innen im US-Bundesstaat Florida von freiwilligen Wahlkampfhelfer: innen zu Hause besucht. Die Freiwilligen, unter denen trans- und cissexuelle Menschen waren, verwickelten die Bewohner: innen an der Haustür oder in ihrem Wohnzimmer in ein zehnminütiges, nicht konfrontatives Gespräch und baten sie, sich in die Lage von transsexuellen Menschen zu versetzen, um ihre Probleme zu verstehen. Das sollte die Angesprochenen dazu bringen, ihre Vorurteile und Stereotype über Transsexuelle zu überdenken. Das Verblüffende daran: Es funktionierte.
Nicht nur sanken danach die Anti-Trans-Einstellungen der meisten Wähler:innen; der Effekt hielt sogar Monate danach noch an – selbst wenn man sie transphober TV-Werbung aussetzte. Die Forscher:innen fanden heraus, dass sich die Reduktion der extremen Ansichten zu Trans-Rechten in Unterstützung konkreter politischer Maßnahmen übersetzte, etwa indem die Besuchten tendenziell eher dazu neigten, jene Gesetzesinitiativen zu unterstützen, die Transpersonen vor Diskriminierung schützen sollten. Das klingt fast so, als hätten die Studienautor:innen ein Geheimrezept entdeckt, mit dem Rassismus, Sexismus, Homophobie, Antisemitismus und alle anderen Formen der Ausgrenzung und Diskriminierung auf der Welt beendet werden könnten. So einfach ist es leider nicht. Denn erstens braucht es Zeit – von der wir alle, so scheint es, immer weniger haben –, und zweitens, noch wesentlicher, Empathie. Letztere nicht nur Marginalisierten und Ausgegrenzten entgegenzubringen, sondern auch jenen, die selbst ausgrenzen und diskriminieren, ist eine der schwersten Übungen. Aber, so man dieser und anderen Studien Glauben schenkt, eine besonders wirksame.
Durch Einladungen zu Talkshows ist noch kein Rechtspopulist ›entzaubert‹ worden.
Der Ruf nach »mehr Empathie« mag gerade in Zeiten wie diesen wie Hohn klingen. Die Wirkweise von Social Media und die darunterliegenden Algorithmen, die Wut und Hass induzierende Inhalte viel stärker belohnen als solche, die gegenseitige Wertschätzung, Freude oder Hoffnung hervorrufen, arbeiten gegen uns. Die Hasskultur des Internets ist dabei kein Privileg derer, die sich sexistisch oder rassistisch gebärden, gegen Minderheiten und Marginalisierte hetzen, sondern ist auch auf der Gegenseite anzutreffen. Das Gegenüber als »Rassist«, »Nazi« oder als menschenverachtend öffentlich an den Pranger zu stellen, das mag in manchen Kontexten notwendig sein, vor allem, wenn es sich um Personen des öffentlichen Interesses handelt, deren Macht und Einfluss dadurch gebremst werden. Denn da hat die politikwissenschaftliche Forschung gezeigt, dass durch Einladungen zu öffentlichen Auseinandersetzungen, Podien und Talkshows kein:e einzige:r Rechtspopulist:in jemals »entzaubert« wurde oder sich selbst »entblößt« hat. Gibt man ihnen eine Plattform in etablierten Medien, auf der sie ihre kruden Verschwörungstheorien spinnen oder in Primetime-Interviewformaten ihre Sicht auf die Welt darlegen dürfen, manchmal noch von überforderten Moderator:innen geleitet, die nicht eingreifen, wird die Meinung ihrer Anhänger: innen dadurch kaum ins Schwanken gebracht – im Gegenteil. Denn wenn nun sogar Mainstream-Medien erkannt haben, wie wichtig die (vermeintlich sachliche) Darstellung der Inhalte und politischen Ideen von LePen, Kickl und Musk ist, so liegt für ihre Anhänger:innen der Schluss nahe, dass erstens tatsächlich etwas dran sein muss, und zweitens, diese Inhalte so schlimm, antidemokratisch oder anderweitig problematisch nicht sein können, wenn sie Legitimation durch »Systemmedien « erfahren.
Rassistische, sexistische oder anderweitig menschenverachtende Haltungen und Äußerungen einerseits öffentlich zu thematisieren und anzuprangern, statt sie als Kavaliersdelikt abzutun, und ihre Proponent:innen andererseits aus der öffentlichen Debatte auszugrenzen, so sie grundlegende demokratische Werte nicht teilen, ist ein wesentliches Werkzeug im Kampf um den Erhalt der offenen Gesellschaft und liberalen Demokratie. Das betrifft aber vorrangig die öffentliche Auseinandersetzung und den Umgang mit Vertreter:innen autoritärer, illiberal ausgerichteter Parteien. Was ihre Wähler:innen und den privaten, nichtöffentlichen Austausch mit ihnen angeht, verhält sich die Sache ein wenig komplexer.
Denn beim viel zitierten Mann bzw. der Frau aus dem »Volk« haben solche öffentlichen Naming and Shaming-Strategien, egal ob sie in den Sozialen Medien oder im Freundes- und Bekanntenkreis stattfinden, eher den gegenteiligen Effekt: Nicht nur, dass dadurch weder bei den Betroffenen selbst noch bei passiv zusehenden Dritten ein Meinungsumschwung herbeigeführt werden kann, manchmal tritt sogar das Gegenteil ein und die bigotte Haltung, die man herausfordern wollte, verhärtet sich, der Rassismus wird noch fester einzementiert. Dadurch werden, so Robin DiAngelo, Autorin von »White Fragility« (2018), »eine Reihe an Verteidigungsstrategien getriggert. Dazu gehört das Äußern von Emotionen wie Wut, Angst und Schuld.« Der Leitspruch, sich in die Lage des anderen zu versetzen, bevor man urteilt, gilt für beide Seiten. Aussichtsreicher sind Gespräche, die auf Augenhöhe geführt, von gegenseitigem Respekt und dem Zugeständnis der bedingungslosen Menschlichkeit des Gegenübers getragen sind. Was ich also tue, ist nicht »mit einem Rechten reden«, sondern mit meinem Freund Simon reden, in seinem ganzen Facettenreichtum. In der Anerkennung, dass er so viel mehr ist als seine politische Einstellung. Und dass sich durch ein Nicht-Reden und eine Nicht-Beziehung kein einziges Gegenwartsproblem lösen, kein einziger Konflikt klären lassen wird.
Eine Beziehung aufzubauen und aufrechtzuerhalten, mitunter zum Nachdenken und Überdenken anzuregen, gelingt nur, wenn man dem anderen seine Menschlichkeit nicht von vornherein abspricht. Es gelingt sicherlich nicht, indem ich meinem Gegenüber möglichst viele Zahlen und Statistiken zu Antidiskriminierung, Rassismus oder tödlichen Fluchtrouten präsentiere. Damit wird selten ein Meinungsumschwung, ja noch nicht einmal eine generelle Offenheit für die Argumente der Gegenseite herbeigeführt. Wesentlicher ist das Ansprechen der emotionalen Ebene, und das lässt sich auch und vor allem durch empathisches Zuhören erreichen.
In der oben zitierten Studie aus Kalifornien waren die Freiwilligen, die an mehr als 500 Türen klopften, vor allem Zuhörende: Selbst wenn das Gegenüber Schimpfwörter wie »Schwuchtel« verwendete, blieben sie unbeeindruckt und hörten weiter zu. Diese Technik, die vom Los Angeles LGBT Center nach der erfolgreichen homophoben Volksinitiative »Prop 8«, wonach gleichgeschlechtliche Ehen nicht mehr anerkannt werden sollten, entwickelt wurde, nennt sich »deep canvassing«, im Deutschen etwas sperrig übersetzt als »intensives Wahlkämpfen« oder »Werben«. Nur indem die Wähler:innen ihre eigenen Schlüsse ziehen und aus ihren eigenen Erfahrungswelten schöpfen konnten, machten sie die Erfahrung einer gemeinsamen Menschlichkeit. Weitaus weniger hilfreich sind Belehrungsversuche durch abstrakte, unpersönliche Statistiken oder unmittelbares Zurechtweisen bei verbalen Entgleisungen und der Verwendung politisch inkorrekter Begriffe.
Die politischen Alarmsysteme abschalten
Warum aber sollte man jenen, die selbst nicht wertschätzend auftreten, mit Wertschätzung entgegentreten? Ihren Verbaldurchfall erdulden oder ignorieren, statt ihn zu sanktionieren? Nun, vor allem deshalb, weil durch Letzteres nichts gewonnen ist, außer die zarte Verbindung zum anderen, die gerade erst im Entstehen ist, gleich wieder zu kappen. Indem wir genau dies nicht tun, folgen die kalifornischen Wahlhelfer:innen und ich im Kern den vier Prinzipien, die der deutsche Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen als Basis für gelungene Kommunikation aufstellt: öffnende Wertschätzung füreinander, Perspektivenverschränkung, doppelte Passung und respektvolle Konfrontation. Letztere bedeutet eben nicht, den anderen abzuwerten, ihm seinen Verstand oder seine Menschlichkeit abzusprechen, aber auch nicht, die eigene Haltung aufzugeben. Die ist im Zweifelsfall sogar »wichtiger als Detailwissen«, weil es nicht vorrangig um Fakten, sondern um Grundsätze und Wertvorstellungen geht.
Wenn Frauen oder Minderheiten mit Schimpfwörtern bedacht und verbal abgewertet werden, gilt es einzuschreiten, denn das ist, wie die empirische Forschung zeigt, oft nur die erste Stufe einer Eskalationsspirale, an deren Ende physische Gewalt steht. Der erste Schritt dafür ist und bleibt das »Andersmachen«, das Dehumanisieren von Menschengruppen. Doch neuere Studienergebnisse zeigen eben auch, dass durch ständiges Korrigieren und verbales Einschreiten im zugewandten Gespräch wenig gewonnen wird, wenn dadurch die Beziehungsebene, neben der inhaltlichen, auf der Strecke bleibt.
Die Psychologin Arlie Hochschild nennt das »turning your political alarm system off«, also das politische Alarmsystem abstellen. Das könne man situations- und anlassbezogen schon mal machen, ohne damit »zu gefährden, wer man ist und woran man glaubt«. Denn nur so könne man erstens etwas über den anderen (dazu-)lernen und seinen Standpunkt verstehen (was nicht gleichbedeutend damit ist, ihn zu teilen), und zweitens dem anderen das Gefühl geben, ihn ernst zu nehmen, ihn wirklich zu hören und sich auf ihn und seine Position einzulassen. Das wiederum mache es wesentlich einfacher für das Gegenüber, es einem gleichzutun und sich dem anderen und seiner divergierenden Meinung zu öffnen, empfänglich für den Austausch zu sein. Wer aber das Gefühl hat, nicht ernst genommen oder gar verspottet, attackiert, ausgelacht oder verteufelt zu werden, wird wenig Anlass für diese grundlegende Offenheit sehen. Die natürliche Reaktion darauf ist dichtmachen, sich abwenden oder in die Aggression gehen.
Die bekannte sozialwissenschaftliche Kontakthypothese besagt, dass durch den persönlichen Kontakt unterschiedlicher, einander mitunter mit Vorurteilen gegenüberstehender Gruppen diese am ehesten abgebaut werden können. Es braucht diesen grundlegenden Austausch mit konkreten anderen, also mit Individuen – und nicht mit der abstrakten »Masse« –, um das Bild, das man vom anderen hat, einem Reality Check zu unterziehen. Nicht von ungefähr haben rechte und rechtspopulistische Parteien dort die größten Zugewinne, wo wenige oder gar keine Flüchtlinge leben, wie etwa in Ungarn. Dort nämlich gibt es keine Möglichkeit zu verifizieren, ob das, was ein Viktor Orbán über Schutz suchende Menschen aus dem Nahen Osten oder Afrika verbreitet, wirklich stimmt. Die Möglichkeit, »sich an die Stelle jedes anderen« zu denken, wie Hannah Arendt es als Gegenstrategie für das banale Böse in der Welt forderte, ist dadurch massiv eingeschränkt.
Die Erfahrung politischer Einsamkeit als Bedingung autoritären Denkens
Durch den Kontakt wird, und auch das ist eine Erkenntnis, die auf Arendts wegweisende Schriften zurückgeht, die umfassende Einsamkeit des Individuums in der modernen Massengesellschaft zurückgedrängt. Denn diese Erfahrung der politischen Einsamkeit, dieses »Nicht-zur-Welt-Gehören«, sei der Wahrnehmung einer zunehmenden räumlichen wie auch emotionalen Distanz zwischen uns geschuldet. Wir gehören, wie Arendt sagen würde, nicht mehr dazu, nicht mehr zueinander. Immer mehr Menschen fühlen sich, gerade wegen moderner Kommunikationstechnologien und der 24/7-Verfügbarkeit von niederschwelliger Unterhaltung und Schreckensnachrichten, von anderen abgeschnitten, ob von Menschen, Institutionen oder Ideen. Erst durch die Abkapselung des Einzelnen kann autoritäres, radikales Denken greifen, setzen sich der Populismus, die Paranoia und Verschwörungstheorien durch.
Studien zu »Einsamkeitsepidemien« zeigen, dass Menschen in Industrieländern mehr Zeit allein verbringen (wollen) und sich, grosso modo, einsamer fühlen als die Generationen davor, besonders die Jüngeren unter uns. Gelitten haben vor allem unsere loseren Beziehungen, also jene, die über die unmittelbare Kernfamilie und den intimsten Kreis an Freund:innen hinausgehen. Das sind Nachbar:innen, Kolleg:innen, Menschen im unmittelbaren Umfeld, Bekannte und Freund:innen, die nicht zu den »besten« zählen, die man aber ab und zu auf einen Kaffee oder ein Glas Wein trifft. Diese Bekanntschaften sind wesentlich für soziale Kohäsion, weil sie uns in Toleranz und friedlicher Koexistenz schulen. Solche Begegnungen, so sie nicht nur virtuell stattfinden, verursachen Irritationen, denen man nicht einfach aus dem Weg gehen kann, sondern denen man sich stellen muss. Dieser Umstand eröffnet aber auch erst die Möglichkeit, im näheren Austausch mitunter auch Gemeinsamkeiten zu finden bzw. andere, weniger »triggernde« Facetten des Gegenübers kennenzulernen. Die zu entdecken, braucht aber Zeit und Nähe, die wir im virtuellen Raum sowieso nicht und im analogen immer weniger zulassen.
Und das hat nicht nur Folgen für unsere Persönlichkeit und unsere sozialen Beziehungen, sondern auch für unsere Demokratie. Der US-amerikanische Autor und Politikwissenschaftler Marc J. Dunkelman nennt solche Beziehungen »politically moderating «, also politisch ausgleichend, weil man dabei auf Menschen treffe, deren Meinung man nicht teile, mit denen man aber dennoch auskommen müsse, etwa weil ein gemeinsames Projekt anstehe oder man nebeneinander arbeite oder wohne. Ausweichen, ignorieren, ausgrenzen sei da keine Option. Mit solchen Bekanntschaften könne man am besten üben, »produktiv anderer Meinung zu sein« und Kompromisse einzugehen – in anderen Worten: Demokratie zu leben. Es ist wohl kein Zufall, dass die Erosion dieser Form von zwischenmenschlichen Beziehungen mit dem Aufstieg extremer politischer Positionen zusammenfällt, getrieben von Intoleranz gegenüber Andersdenkenden und der Dämonisierung des politischen Gegners. Die Erosion solcher Beziehungen könnte auch erklären, warum für jene, die sich links der Mitte verorten, die Wahlsiege der Rechten so überraschend kamen: Sie wussten einfach nicht, was ihre Nachbar:innen und Kolleg:innen wählten, oder warum.
Durch persönlichen Kontakt können Vorurteile am ehesten abgebaut werden.
Der Wegfall solch loser »unbehaglicher Beziehungen«, wie ich sie nennen möchte, bedeutet aber nicht nur radikalisierte Politik, sondern macht uns auch als Gesellschaft und als Individuen einsamer, im negativen Sinne empfindlicher, boshafter und anfälliger für Nihilismus und Ressentiments.
Dem entgegensetzen kann man nur bedingungslose Zugewandtheit und eine Strategie der Relationalität, um die Anschlussfähigkeit und Austauschmöglichkeiten zwischen unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen, sozialen Milieus und Lebensrealitäten zu erhöhen. Dazu braucht es ein gesellschaftliches Umfeld, das Beziehung und Solidarität fördert, also die Kontakt- und Beziehungspunkte zwischen Einzelnen maximiert, und das nicht Antagonismus und Konkurrenz zwischen den Einzelnen fördert, sondern die notwendige Abhängigkeit der Einzelnen voneinander anerkennt. Das gelingt, wenn politische Foren geschaffen werden, wo Emotionen nachgespürt, reflektiert, hinterfragt, debattiert und infrage gestellt werden können – und zwar in Gegenseitigkeit und im Miteinander. Dabei ist die grundlegende Humanisierung Start- und Endpunkt zugleich, weil es eben den Austausch mit konkreten Individuen braucht, um Vorurteilen über eine Gruppe entgegenzuwirken. Diese Erfahrung muss jeder und jede für sich machen; sie kann nicht durch gut zureden vermittelt werden.
Ich bin der Überzeugung, dass in solchen kleinen, alltäglichen Momenten des Unbehagens, bei grundlegender Zugewandtheit, ein Schlüssel zu mehr Miteinander und zur Bekämpfung autoritärer, illiberaler Tendenzen in unserer Gesellschaft liegt.
Dieser Beitrag basiert auf dem jüngsten Buch der Autorin »Migrationspanik. Wie Abschottungspolitik die autoritäre Wende befördert«, das im Picus Verlag erschienen ist. Dort finden sich auch die Quellennachweise.
[1] Der Begriff »Incel« (Involuntary Celibacy – unfreiwilliges Zölibat) wird als identitätsstiftende Selbstbezeichnung von einer Strömung junger heterosexueller Männer genutzt, die den Feminismus und Frauen allgemein für ihre sexuelle Inaktivität verantwortlich machen.