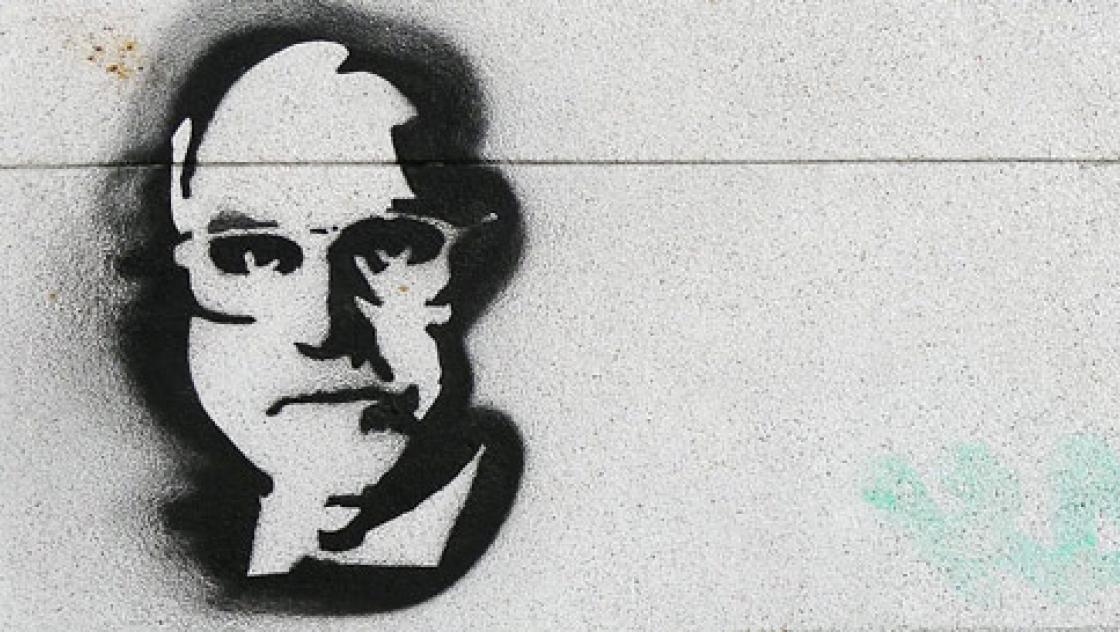Die deutsche Einheit und die vertane Chance auf Frieden in Europa
Wenn in diesem Jahr der deutschen Einheit vor 25 Jahren gedacht wird, überwiegen ganz eindeutig die positiven Einschätzungen. Demnach handelte es sich insgesamt um einen überaus gelungenen Prozess, ja um eine „Sternstunde der Diplomatie“.[1] Entsprechend selten kommen folglich die den Entscheidungen innewohnenden Alternativen zur Sprache. Dabei sind diese derzeit von erstaunlicher Brisanz: Heute spüren wir, dass manches, was nach dem Umbruch von 1989 liegen blieb, zum Problem wird – und zwar zu einem Problem in und für ganz Europa.
Als 1989 die Berliner Mauer fiel, kehrte eine Frage auf die Agenda der Weltpolitik zurück, die für die Zukunft Europas von grundsätzlicher Bedeutung war: An der Grenze, die Deutschland teilte, war eine unerledigte Geschichte eingefroren, die sogenannte deutsche Frage – die Frage, ob und wie ein befriedetes, friedliches Europa ein großes, vereintes Deutschland verkraften könne, nachdem es zuvor den Kontinent zweimal in katastrophale Kriege gestürzt hatte. Dass die „deutsche Frage“ mit der europäischen zusammenfiel, war unvermeidlich. Dass sie sich als ein Aspekt des überall in Europa mit großer Sympathie begleiteten demokratischen Aufbruchs, des Strebens nach „Rückkehr nach Europa“ stellte, war ein glücklicher Umstand.