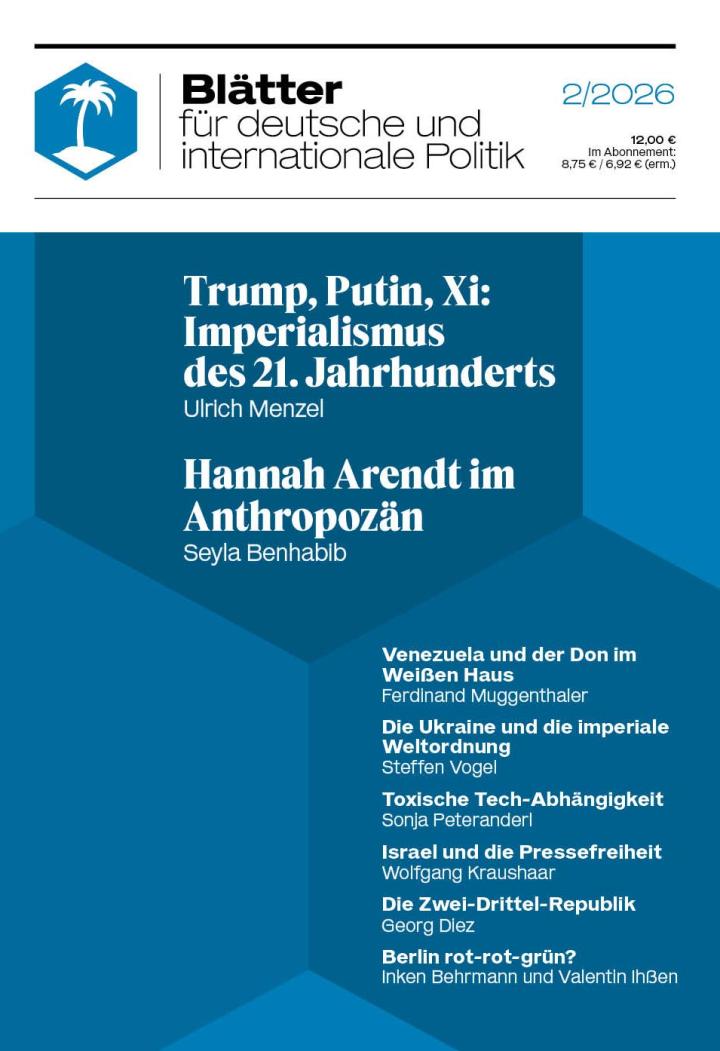Von der Verfeindung zur Zerstörung der US-Demokratie

Bild: Public Domain
Hätte vor 25 Jahren jemand von einem Land gesprochen, in dem Politiker im Wahlkampf ihren Rivalen androhen, sie ins Gefängnis zu werfen, politische Gegner die Regierung beschuldigen, die Wahl zu manipulieren oder eine Diktatur einzuführen, und Parteien ihre Parlamentsmehrheit nutzen, um Präsidenten ihres Amts zu entheben und die Besetzung von Richterposten zu verweigern, hätte man wahrscheinlich an Ecuador oder Rumänien gedacht, aber bestimmt nicht an die Vereinigten Staaten. Doch seit dem Aufstieg Donald Trumps ist die Lage eine andere. Seither ist vieles möglich, was vormals als unmöglich galt.
Während des Kalten Kriegs waren Staatsstreiche für annähernd drei Viertel der Zusammenbrüche von Demokratien verantwortlich. In Argentinien, Brasilien, der Dominikanischen Republik, Ghana, Griechenland, Guatemala, Nigeria, Pakistan, Peru, Thailand, der Türkei und Uruguay bereiteten sie der Demokratie ein Ende. In jüngerer Zeit wurden 2013 der ägyptische Präsident Mohammed Mursi und 2014 die thailändische Ministerpräsidentin Yingluck Shinawatra durch Militärputsche gestürzt. In all diesen Fällen brachen die Demokratien auf spektakuläre Weise durch Waffengewalt zusammen.
Aber es gibt noch eine andere Art des Zusammenbruchs, die zwar weniger dramatisch, aber genauso zerstörerisch ist. Demokratien können nicht nur von Militärs, sondern auch von ihren gewählten Führern zu Fall gebracht werden, von Präsidenten oder Ministerpräsidenten, die ebenjenen Prozess aushöhlen, der sie an die Macht gebracht hat. Manche dieser Führer reißen die Demokratie rasch ein, wie Hitler es 1933 nach dem Reichstagsbrand getan hat. Häufiger indes erodieren die Demokratien langsam und in kaum merklichen Schritten.
Seit dem Ende des Kalten Kriegs sind die meisten demokratischen Zusammenbrüche nicht durch Generäle und Soldaten, sondern durch gewählte Regierungen verursacht worden. Wie Hugo Chávez in Venezuela haben gewählte Politiker demokratische Institutionen ausgehöhlt – in Georgien, Nicaragua, Peru, den Philippinen, Polen, Russland, Sri Lanka, der Türkei, der Ukraine und Ungarn. Der demokratische Rückschritt beginnt heute an der Wahlurne.
Wie anfällig ist die amerikanische Demokratie für diese Art des Rückschritts? Die Grundfesten der Demokratie sind in unserem Land sicherlich stärker als in Venezuela, der Türkei oder Ungarn. Aber sind sie stark genug?
Amerika hat im November 2016, als es einen Präsidenten mit zweifelhafter Treue zu demokratischen Normen wählte, beim ersten Test versagt. Donald Trumps Überraschungssieg ist nicht nur auf eine verbreitete Unzufriedenheit in der amerikanischen Bevölkerung zurückzuführen, sondern auch darauf, dass die Republikanische Partei die Nominierung eines extremistischen Demagogen aus den eigenen Reihen als Präsidentschaftskandidat zuließ.
Wie ernst ist die Gefahr jetzt? Viele Beobachter verweisen beschwichtigend auf unsere Verfassung, die genau zu diesem Zweck geschrieben wurde: um Demagogen wie Donald Trump zu bremsen und zu zügeln. Das von James Madison ersonnene System der Gewaltenteilung hat seit über zwei Jahrhunderten Bestand. Es hat den Bürgerkrieg, die Weltwirtschaftskrise, den Kalten Krieg und Watergate überlebt. Es wird also gewiss, so die Meinung der meisten Politikexperten, auch Donald Trump überstehen.
Wir sind da weniger sicher.
Gewiss, bislanghat unser System der Gewaltenteilung und Kontrolle recht gut funktioniert – aber nicht, oder nicht nur, aufgrund des von den Gründungsvätern geschaffenen Verfassungssystems. Demokratien funktionieren dort am besten – und überleben am längsten –, wo die Verfassung durch demokratische Normen unterfüttert ist. Die amerikanische Gewaltenteilung wird durch zwei grundlegende Normen gestützt, die wir für selbstverständlich halten: gegenseitige Achtung oder, anders ausgedrückt, das Einvernehmen darüber, dass konkurrierende Parteien einander als legitime Rivalen betrachten, und Zurückhaltung, das heißt, Politiker sollten ihre institutionellen Vorrechte vorsichtig und mit Fingerspitzengefühl ausüben.
Im 20. Jahrhundert konnte sich die amerikanische Demokratie fast immer auf diese beiden Normen oder Gebote stützen. Die Führer der beiden großen Parteien akzeptierten sich gegenseitig als legitime Vertreter des Volkes und widerstanden der Versuchung, ihre zeitweilige Macht zu nutzen, um die Vorteile für ihre eigene Partei zu maximieren. Die Gebote der Achtung und Zurückhaltung dienten als Leitplanken der amerikanischen Demokratie, die dazu beitrugen, dass die Parteien sich nicht bis aufs Messer bekämpften und dabei die Demokratie zugrunde richteten, wie es anderswo auf der Welt geschehen ist, etwa in Deutschland in den 1930er Jahren und in Südamerika in den 1960er und 1970er Jahren.
Heute sind diese Leitplanken der amerikanischen Demokratie jedoch geschwächt. Donald Trump mag diese Entwicklung beschleunigt haben, aber er hat sie nicht ausgelöst. Die Herausforderungen, vor denen die amerikanische Demokratie steht, reichen tiefer. Die Schwächung unserer demokratischen Normen wurzelt in einer extremen Polarisierung, die sich über politische Meinungsverschiedenheiten hinaus zu einem existenziellen Konflikt über Rasse und Kultur ausgeweitet hat. Die Bemühungen um gleiche Rechte und Chancen in einer immer mannigfaltiger werdenden Gesellschaft haben diese Polarisierung verschärft und heimtückische Reaktionen hervorgerufen. Wie aber konnte es zu diesem Zerbröckeln der grundlegenden Normen der gegenseitigen Achtung und Zurückhaltung kommen?
Von der Gegner- zur Feindschaft: Das Syndrom der Parteienpolarisierung
Die Erosion unserer demokratischen Normen begann in den 1980er und 1990er Jahren und beschleunigte sich in den 2000er Jahren. Als Barack Obama Präsident wurde, zogen insbesondere viele Republikaner die Legitimität ihrer Konkurrenten von der Demokratischen Partei in Zweifel, und sie hatten die Zurückhaltung zugunsten einer Strategie des Gewinnens um jeden Preis aufgegeben.
Doch obwohl die Polarisierung mit der Radikalisierung der Republikanischen Partei begann, sind ihre Folgen längst im gesamten politischen System der Vereinigten Staaten zu spüren. Regierungsstillstände, legislative Geiselnahmen, Wahlbezirksreformen mitten in der Legislaturperiode und die Weigerung, Nominierungen für den Obersten Gerichtshof auch nur in Erwägung zu ziehen, sind keine Vorfälle mehr, die aus dem Rahmen fallen. Im letzten Vierteljahrhundert sind Demokraten und Republikaner weit mehr geworden als nur miteinander konkurrierende Parteien, die ein liberales und ein konservatives Lager um sich scharen. Ihre Wähler sind heute durch Rasse, Religion, Geographie und sogar Lebensweise voneinander getrennt.
Man lasse sich folgende Gegenüberstellung durch den Kopf gehen: 1960 fragten Politologen Amerikaner, wie sie es fänden, wenn ihr Kind jemanden heiratete, der sich mit der anderen Partei identifizierte. Vier Prozent der Demokraten und fünf Prozent der Republikaner erklärten, dass es ihnen „missfallen“ würde. 2010 bekundeten hingegen 33 Prozent der Demokraten und 49 Prozent der Republikaner, sie wären über eine Eheschließung über die Parteigrenzen hinweg „ziemlich oder sehr unglücklich“. Demokrat oder Republikaner zu sein ist nicht mehr nur eine Frage der Parteiensympathie oder -zugehörigkeit, sondern eine Identität.[1] 2016 ergab eine Umfrage der Pew Foundation, dass 49 Prozent der Republikaner und 55 Prozent der Demokraten die jeweils andere Partei Angst macht. Bei politisch engagierten Amerikanern ist der Anteil sogar noch größer: In dieser Gruppe sind es 70 Prozent bei den Demokraten und 62 Prozent bei den Republikanern.[2]
Diese Umfragen weisen auf ein gefährliches Phänomen in der amerikanischen Politik hin: die intensive politische Feindschaft. Sie wurzelt in einer langfristigen Neuaufstellung der Parteien, die in den 1960er Jahren begann. Während des größten Teils des 20. Jahrhunderts waren die Parteien ideologische „Großraumzelte“, unter deren Dach unterschiedliche Wählergruppen und ein breites Spektrum politischer Anschauungen Platz fanden. Die Demokraten repräsentierten nicht nur die New-Deal-Koalition aus Liberalen, Gewerkschaftern, katholischen Einwanderern der zweiten und dritten Generation und Afroamerikanern, sondern auch konservative weiße Südstaatler. Auf der anderen Seite vereinte die Republikanische Partei Liberale aus dem Nordwesten mit Konservativen aus dem Mittleren Westen und Westen. Evangelikale Christen gab es in beiden Parteien, wobei ein etwas größerer Anteil von ihnen die Demokraten unterstützte; aber niemand konnte der jeweils anderen Partei vorwerfen, sie sei „gottlos“.
Aufgrund dieser Heterogenität ihrer Mitglieder war die Polarisierung zwischen den beiden Parteien wesentlich geringer als heute. Republikanische und demokratische Kongressmitglieder hatten unterschiedliche Meinungen über Steuern und Ausgaben, staatliche Vorschriften und Gewerkschaften, aber in der potentiell explosiven Rassenfrage überlappten sich ihre Positionen. Obwohl Teile beider Parteien für die Bürgerrechte kämpften, sorgten der Widerstand von Südstaatendemokraten und deren strategische Kontrolle über das Ausschusssystem des Kongresses dafür, dass das Thema nicht auf die Tagesordnung gelangte. Die innere Heterogenität entschärfte mögliche Konflikte. Statt einander als Feinde zu betrachten, fanden Republikaner und Demokraten regelmäßig Gemeinsamkeiten. Während liberale Demokraten und Republikaner im Kongress häufig gemeinsam für die Durchsetzung der Bürgerrechte stimmten, bildeten Südstaatendemokraten und rechtsgerichtete Republikaner aus dem Norden eine „konservative Koalition“, die dies verhinderte.
Die große Zäsur – die Bürgerrechtsbewegung der 1960er Jahre
Die Bürgerrechtsbewegung, die 1964/65 mit der Verabschiedung des Bürgerrechts- und des Wahlrechtsgesetzes ihren Höhepunkt erreichte, setzte diesem Parteienarrangement ein Ende. Die neuen Gesetze demokratisierten nicht nur auf lange Sicht den Süden, indem sie Afroamerikanern das Wahlrecht gaben und die Einparteienherrschaft beendeten, sondern beschleunigten auch eine langfristige Neuaufstellung der Parteien, die noch heute nachwirkt. Durch das Bürgerrechtsgesetz – für das der demokratische Präsident Lyndon B. Johnson eintrat und das der republikanische Präsidentschaftskandidat von 1964, Barry Goldwater, ablehnte – wurden die Demokraten zur Partei der Bürgerrechte und die Republikaner zur Partei des rassenpolitischen Status quo. In den folgenden Jahrzehnten traten immer mehr weiße Südstaatler zur Republikanischen Partei über. Die rassistischen Untertöne von Nixons „Südstrategie“ und später Reagans Andeutungen zur Rassenfrage vermittelten den Wählern die Botschaft, dass die Republikanische Partei die Heimat für weiße „Rassenkonservative“ sei. Am Ende des Jahrhunderts war der Süden – eine Region, die einst fest in der Hand der Demokraten gewesen war – zu einer Hochburg der Republikaner geworden. Gleichzeitig strömten sowohl schwarze Südstaatler – die zum ersten Mal seit fast hundert Jahren wählen konnten – als auch liberale Republikaner aus dem Norden auf die Seite der Demokraten. So wie der Süden republikanisch wurde, wurde der Nordosten demokratisch. Mit der Neuaufstellung der Parteien nach 1964/65 begann auch eine ideologische Aufteilung der Wähler. Zum ersten Mal seit fast einem Jahrhundert konvergierten Parteilichkeit und Ideologie: Die Republikanische Partei wurde überwiegend konservativ, die Demokratische Partei überwiegend liberal. In den 2000er Jahren waren die Parteien keine ideologischen „Großraumzelte“ mehr.
Einwanderung und die neue demographische Landkarte
Aber die Aufspaltung der amerikanischen Wählerschaft in liberale Demokraten und konservative Republikaner allein kann das Ausmaß der entstandenen Feindschaft zwischen den Parteien nicht erklären. Noch kann sie erklären, warum die Polarisierung derart asymmetrisch verlaufen ist, das heißt, warum die Republikanische Partei weiter nach rechts gedriftet ist als die Demokratische Partei nach links. Reine Weltanschauungsparteien bringen nicht notwendigerweise jene „Angst und Abscheu“ hervor, die das Gebot der gegenseitigen Achtung zersetzt und Politiker dazu verleitet, die Legitimität ihrer Rivalen in Frage zu stellen. Auch in Großbritannien, Deutschland und Schweden sind die Wähler ideologisch gespalten, aber in keinem dieser Länder gibt es einen solchen Hass zwischen den politischen Lagern, wie wir ihn in Amerika beobachten.
Die Neuaufstellung der Parteien geht weit über die Trennung in Liberale und Konservative hinaus. Auch die soziale, ethnische und kulturelle Basis der politischen Lager hat sich grundlegend verändert und die Bildung von Parteien gefördert, die nicht nur unterschiedliche politische Einstellungen repräsentieren, sondern unterschiedliche Gemeinschaften, Kulturen und Werte. Aber die ethnische Diversität der amerikanischen Gesellschaft ist heute nicht mehr auf Weiße und Schwarze beschränkt. Seit den 1960er Jahren haben die Vereinigten Staaten eine massive Einwanderung erlebt, zuerst aus Lateinamerika und dann aus Asien. Diese Einwanderung hat die demographische Landkarte dramatisch verändert. 1950 stellten Nichtweiße nur 10 Prozent der amerikanischen Bevölkerung. 2014 waren es bereits 38 Prozent,[3] und nach Berechnungen des U.S. Census Bureau wird 2044 die Mehrheit der Amerikaner nichtweiß sein.[4]
Bürgerrechte und Einwanderung haben die Parteien tiefgreifend verändert. Von den neuen Wählern haben unverhältnismäßig viele die Demokratische Partei unterstützt. Der Anteil Nichtweißer an den Wählern der Demokraten ist zwischen 1950 und 2012 von sieben auf 44 Prozent gestiegen. Die republikanische Wählerschaft bestand dagegen bis in die 2000er Jahre zu fast 90 Prozent aus Weißen.[5] Während die Demokraten in zunehmendem Maß zu einer Partei ethnischer Minderheiten wurden, blieben die Republikaner also eine Partei fast ausschließlich von Weißen.
Die Partei der christlichen Rechten
Außerdem wurden die Republikaner zur Partei evangelikaler Christen. Evangelikale begaben sich in den späten 1970er Jahren in großer Zahl in die politische Arena, überwiegend angetrieben von der Entscheidung des Obersten Gerichtshofs im Fall Roe vs. Wade aus dem Jahr 1973, mit der Abtreibungen legalisiert wurden. Angefangen mit Ronald Reagan im Jahr 1980, entdeckte die Republikanische Partei die christliche Rechte für sich und nahm immer stärker proevangelikale Positionen ein, wie die Ablehnung der Abtreibung, das Eintreten für das Schulgebet und später den Widerstand gegen die Ehe für Homosexuelle. Weiße Evangelikale – die in den 1960er Jahren eher den Demokraten zuneigten – begannen, die Republikaner zu wählen.[6] Auf der anderen Seite wurde die Wählerschaft der Demokraten immer säkularer. Der Anteil weißer Demokraten, die regelmäßig in die Kirche gingen, sank von knapp 50 Prozent in den 1960er Jahren auf unter 30 Prozent in den 2000er Jahren.[7]
Dies ist ein außergewöhnlicher Wandel. Wie der Politologe Alan Abramowitz ausführt, bildeten noch in den 1950er Jahren verheiratete weiße Christen die überwältigende Mehrheit der Wähler, nämlich fast 80 Prozent, die zu fast gleichen Teilen auf beide Parteien verteilt waren. In den 2000er Jahren stellten verheiratete weiße Christen nur noch 40 Prozent der Wähler, und sie wählten jetzt überwiegend republikanisch.[8] Anders gesagt, die beiden Parteien sind jetzt nach Rasse und Religion getrennt – zwei stark polarisierende Themen, die mehr Intoleranz und Feindseligkeit schüren als traditionelle Politikthemen wie Steuern und Regierungsausgaben.
In den 2000er Jahren waren also demokratische und republikanische Wähler sowie die Politiker, die sie wählten, weiter voneinander getrennt als zu irgendeinem Zeitpunkt im vorangegangenen Jahrhundert. Aber warum gingen die Normverletzungen überwiegend auf das Konto der Republikaner?
Zunächst einmal wirkte sich die Veränderung der Medienlandschaft auf die Republikanische Partei stärker aus als auf die Demokraten. Republikanische Wähler nutzen in größerem Umfang als Demokraten parteiische Medien. 2010 sahen 69 Prozent der republikanischen Wähler den Nachrichtensender Fox News.[9] Und für populäre Radiotalkshowmoderatoren wie Rush Limbaugh, Sean Hannity, Michael Savage, Mark Levin und Laura Ingraham, die allesamt dazu beitrugen, dass der grob unhöfliche Diskurs salonfähig wurde, gab es auf liberaler Seite kaum ähnlich erfolgreiche Pendants.
Auch bei republikanischen Amtsträgern hinterließ der Aufstieg rechter Medien Spuren. Während Obamas Präsidentschaft vertraten Fox-News-Kommentatoren und rechte Radiomoderatoren fast einhellig das politische Motto „Keine Kompromisse“ und überzogen republikanische Politiker, die sich nicht an die Parteilinie hielten, mit bösartigen Angriffen. Mit den Worten des früheren Mehrheitsführers im Senat, Trent Lott: „Wenn man auch nur im Geringsten von der äußersten Rechten abweicht, bezieht man von den konservativen Medien Prügel.“[10] Finanziell gut ausgestattete Interessengruppen stärkten den Hardlinern in der Partei den Rücken. Ende der 1990er Jahre gewannen Organisationen wie Grover Norquists Americans for Tax Reform und der Club of Growth, die republikanische Politiker zu einer ideologisch unflexibleren Haltung drängten, enormen Einfluss in der Partei. Norquist verlangte von republikanischen Kongressmitgliedern, einen Eid gegen Steuererhöhungen abzulegen, womit er sie im Grunde zwang, eine Blockadepolitik zu verfolgen. Auch wegen der Lockerung der Vorschriften zur Wahlkampffinanzierung im Jahr 2010 gewannen in der Obama-Ära randständige Gruppen wie Americans for Prosperity und die American Energy Alliance – von denen viele zum Netzwerk der Milliardärsfamilie Koch gehörten – großen Einfluss auf die Republikanische Partei. Allein im Jahr 2012 verteilte die Familie Koch Wahlkampfspenden in Höhe von rund 400 Mio. US-Dollar. Neben der Tea Party verhalfen das Koch-Netzwerk und ähnliche Organisationen einer neuen Generation republikanischer Politiker zum Wahlerfolg, für die „Kompromiss“ ein Schimpfwort war. Eine Partei, deren Kern von Spendern und Lobbyisten ausgehöhlt worden ist, fällt auch leichter extremistischen Kräften zum Opfer. Aber die Republikaner wurden nicht nur von Medien und radikalen Interessengruppen zum Extremismus gedrängt. Eine bedeutende Rolle spielten auch soziale und kulturelle Entwicklungen. Im Unterschied zur Demokratischen Partei, die in den vorangegangenen Jahrzehnten immer mannigfaltiger wurde, blieb die Republikanische Partei kulturell homogen. Dies ist entscheidend, denn ihre weiße, protestantische Kernwählerschaft ist nicht irgendeine Gruppe; immerhin bildete sie fast zwei Jahrhunderte lang die Mehrheit der amerikanischen Wählerschaft und dominierte die amerikanischen Gesellschaft politisch, wirtschaftlich und kulturell. Heute sind weiße Protestanten eine Minderheit, zudem eine kleiner werdende. Und sie haben sich in der Republikanischen Partei verbarrikadiert und immer weiter radikalisiert.
»Der paranoide Stil in der amerikanischen Politik«
Im Jahr 1964 beschrieb der Historiker Richard Hofstadter unter der Überschrift „Der paranoide Stil in der amerikanischen Politik“ das Phänomen der „Statusangst“, das nach seiner Ansicht immer dann mit großer Wahrscheinlichkeit auftritt, wenn die soziale Stellung, Identität und Zugehörigkeit einer Gruppe existenziell gefährdet zu sein scheinen. Dies führe zu einem „überhitzten, übermisstrauischen, überaggressiven, überbordenden und apokalyptischen“ Politikstil.[11] Ein halbes Jahrhundert nach seiner Veröffentlichung ist Hofstadters Essay aktueller denn je. Denn die enorme Feindseligkeit, die zu einem Merkmal der amerikanischen Rechten geworden ist, ist zu einem guten Teil auf den Verlust des Mehrheitsstatus und den Kampf gegen diesen Absturz zurückzuführen. Umfragen zufolge haben viele Tea-Party-Republikaner den Eindruck, dass das Land, in dem sie aufgewachsen sind, verschwindet; sie fühlen sich „bedroht von der raschen Veränderung dessen, was sie für das ›wahre‹ Amerika halten“. Sie fühlen sich, um den Titel des jüngsten Buchs der Soziologin Arlie Hochschild zu zitieren, „fremd in ihrem Land“.[12]
Diese Selbstwahrnehmung dürfte ein Grund sein für die immer häufiger zu hörende Unterscheidung zwischen „echten Amerikanern“ und solchen, die mit Liberalen und der Demokratischen Partei in Verbindung gebracht werden. Wenn man unter „echten Amerikanern“ nur diejenigen versteht, die im Land geboren, englischsprachig, weiß und christlich sind, dann ist offensichtlich, dass das „echte Amerika“ sich im Niedergang befindet. „Die amerikanische Wählerschaft bewegt sich nicht nach links – sie schrumpft“, verkündete die rechtskonservative Kolumnistin Ann Coulter voller Schrecken.[13] Die bei Tea-Party-Republikanern verbreitete Wahrnehmung, dass ihr Amerika verschwindet, macht verständlich, warum Slogans wie „Take Our Country Back“ und „Make America Great Again“ solche Anziehungskraft besitzen. Doch Demokraten nicht als echte Amerikaner zu betrachten, ist gefährlich, da das einen Frontalangriff auf die Norm der gegenseitigen Achtung und Toleranz darstellt. Von Newt Gingrich bis zu Donald Trump haben republikanische Politiker gelernt, dass es in einer polarisierten Gesellschaft nützlich sein kann, den politischen Gegner als Feind zu brandmarken. Denn Politik als Kriegsführung zu betreiben, wirkt auf diejenigen anziehend, die viel zu verlieren fürchten.
Aber Kriege haben ihren Preis. Die immer heftigeren Angriffe auf die Normen von Achtung und Zurückhaltung – die meist, aber nicht nur von Republikanern ausgingen – hat die weichen Leitplanken der Demokratie erodieren lassen. Diese Leitplanken haben uns lange Zeit vor einem Parteienkampf auf Leben und Tod bewahrt, der schon etliche Demokratien in anderen Ländern zerstört hat. Als Donald Trump im Januar 2017 das Präsidentenamt antrat, gab es die Leitplanken noch, aber sie waren schwächer als im gesamten Jahrhundert zuvor – und es sollte noch schlimmer kommen. Zwar ist es immer ungewiss, wie sich ein Politiker ohne Erfahrung im Amt verhalten wird, aber antidemokratische Führer lassen sich häufig erkennen, bevor sie an die Macht gelangen. Und im Falle Donald Trumps ergibt unser Autokraten-Lackmustest in allen entscheidenden Punkten – den vier Schlüsselindikatoren für autoritäres Verhalten –ein positives Ergebnis. Danach müssen wir uns Sorgen machen, wenn ein Politiker (1) in Wort oder Tat demokratische Spielregeln ablehnt, (2) politischen Gegnern die Legitimität abspricht, (3) Gewalt toleriert oder befürwortet oder (4) bereit ist, bürgerliche Freiheiten von Gegnern, einschließlich der Medien, zu beschneiden.
Der Lackmustest für Autokraten
Das erste Merkmal ist eine schwache Zustimmung zu demokratischen Spielregeln. Trump erfüllte dieses Kriterium bereits, als er die Legitimität des Wahlverfahrens in Frage stellte und vor der Wahl die beispiellose Ankündigung machte, er werde das Wahlergebnis möglicherweise nicht anerkennen.
Wahlbetrug ist in den Vereinigten Staaten sehr selten, und da Wahlen von bundesstaatlichen und kommunalen Behörden organisiert werden, ist ein landesweiter Wahlbetrug praktisch unmöglich. Dennoch behauptete Trump im Wahlkampf von 2016 unablässig, Millionen illegaler Einwanderer und Verstorbener auf den Wählerlisten würden als Stimmen für Hillary Clinton gezählt werden. Monatelang war auf seiner Wahlkampfwebseite die Aufforderung zu lesen: „Helft mir, die verschlagene Hillary daran zu hindern, diese Wahl zu manipulieren!“ Im August sagte Trump zu Sean Hannity: „Wir sollten vorsichtig sein, denn man wird diese Wahl manipulieren […] Ich hoffe, die Republikaner passen gut auf, oder man wird sie uns wegnehmen.“ Im Oktober twitterte er: „Natürlich wird es am Wahltag und davor eine Menge Wahlbetrug geben.“ Und in der letzten TV-Debatte der Präsidentschaftskandidaten weigerte er sich, die Zusage abzugeben, im Fall seiner Niederlage das Wahlergebnis anzuerkennen.
Dem Historiker Douglas Brinkley zufolge hat seit 1860 kein wichtiger Präsidentschaftskandidat das demokratische System derart in Zweifel gezogen. Nur im Vorfeld des Bürgerkriegs hätten bedeutende Politiker der Bundesregierung auf ähnliche Weise die Legitimität abgesprochen. Dies sei ein „sezessionistisches, revolutionäres Motiv“ gewesen, das für den Versuch gestanden habe, „gleich das gesamte System über den Haufen zu werfen“.[14]
Und Trumps Äußerungen zeigten Wirkung. Laut einer Umfrage der Zeitung „Politico“ von Mitte Oktober glaubten 41 Prozent der Wähler und 73 Prozent der Republikaner, dass man Trump den Wahlsieg durch Manipulationen nehmen würde.[15] Mit anderen Worten, drei von vier Republikanern waren sich nicht mehr sicher, ob sie in einem demokratischen System mit freien Wahlen lebten.
Das zweite Kriterium unseres Lackmustests ist es, politischen Gegnern die Legitimität abzusprechen. Autoritäre Politiker verunglimpfen ihre Rivalen als kriminell, subversiv, unpatriotisch oder brandmarken sie als Gefahr für die nationale Sicherheit oder die bestehende Lebensweise.
Trump erfüllte auch dieses Kriterium. So hat er als sogenannter Birther die Rechtmäßigkeit von Barack Obamas Präsidentschaft bestritten, indem er ihm unterstellte, er sei in Kenia geboren und zudem Muslim, was ihn in den Augen vieler Trump-Anhänger als „unamerikanisch“ abstempelte. Im Wahlkampf von 2016 sprach Trump auch Hillary Clinton die Legitimität als Kandidatin ab, indem er sie als „Kriminelle“ brandmarkte und wiederholt erklärte, sie müsse „ins Gefängnis gesperrt“ werden. Auf Wahlkampfveranstaltungen applaudierte er Anhängern, die „Sperrt sie ein!“ riefen.
Das dritte Kriterium ist die Tolerierung von oder Ermutigung zu Gewalt. Von Parteien ausgehende oder politisierte Gewalt ist häufig der Vorbote des Zusammenbruchs der Demokratie. Bekannte Beispiele sind die Schwarzhemden in Italien, die Nationalsozialisten in Deutschland, die linken Guerillas in Uruguay sowie die linken paramilitärischen Gruppen Anfang der 1960er Jahre in Brasilien. Im letzten Jahrhundert hat kein US-Präsidentschaftskandidat der großen Parteien jemals Gewalt gebilligt (George Wallace tat es 1968, aber er trat für eine dritte Partei an). Trump brach auch mit dieser Tradition. In seinem Wahlkampf tolerierte er die Gewaltausübung durch seine Anhänger und schien sich gelegentlich sogar an ihr zu weiden. In einem radikalen Bruch mit etablierten Normen des menschlichen Anstands billigte Trump es nicht nur, wenn seine Anhänger gewaltsam gegen Demonstranten vorgingen, er ermunterte sie auch dazu. Er bot an, die Rechtskosten für einen seiner Anhänger zu übernehmen, der bei einer Kundgebung in Fayetteville in North Carolina auf einen Demonstranten einschlug und ihn mit dem Tod bedrohte. Bei anderen Gelegenheiten hetzte er seine Anhänger zur Gewaltanwendung auf. Hier nur eines der vielen von Voxzusammengestellten Beispiele: „Wenn ihr jemanden seht, der eine Tomate werfen will, prügelt ihn windelweich, klar? Ernsthaft. Macht ihn fertig. Ich verspreche euch, die Rechtskosten zu bezahlen. Versprochen.“[16]
Das letzte, vierte, Warnzeichen unseres Lackmustests ist die Bereitschaft, bürgerliche Freiheiten von Konkurrenten und Kritikern zu beschneiden. Zu den Merkmalen, die heutige Autokraten von demokratischen Führern unterscheiden, gehören ihre Intoleranz gegenüber Kritik und ihre Bereitschaft, gewaltsam gegen diejenigen – in der Opposition, den Medien und der Zivilgesellschaft – vorzugehen, die sie zu kritisieren wagen.
Trump offenbarte diese Bereitschaft bereits im Wahlkampf 2016, als er ankündigte, nach der Wahl einen Sonderermittler einsetzen zu wollen, der gegen Hillary Clinton ermitteln solle, und erklärte, sie gehöre ins Gefängnis. Außerdem drohte er mehrfach, kritische Medien zu bestrafen. Auf einer Kundgebung in Fort Worth in Texas beispielsweise verkündete er, gegen Jeff Bezos, den Besitzer der „Washington Post“, gerichtet: „Wenn ich Präsident werde, oh, dann haben sie ein Problem. Sie werden solche Probleme haben.“ Die Medienvertreter gehörten „zu den unehrlichsten Gruppen von Leuten, die ich jemals kennengelernt habe“. Dann fuhr er fort: „Ich werde unsere Verleumdungsgesetze aufschnüren, so dass man sie, wenn sie absichtlich negative und schreckliche und falsche Artikel schreiben, verklagen und viel Geld gewinnen kann [...] So dass man die ‚New York Times‘,wenn sie einen Hetzartikel schreibt, der eine völlige Schande ist – oder wenn die ‚Washington Post‘ [...] einen Hetzartikel schreibt, verklagen kann.“[17]
Außer Richard Nixon hat kein Präsidentschaftskandidat der beiden großen Parteien im vergangenen Jahrhundert auch nur eines der Kriterien unseres Lackmustests erfüllt. Donald Trump erfüllt sie alle vier. Kein anderer Präsidentschaftskandidat der großen Parteien in der modernen Geschichte der Vereinigten Staaten, einschließlich Nixons, hat eine derartige Geringschätzung der verfassungsmäßigen Rechte und der demokratischen Normen an den Tag gelegt. Trump war genau eine jener Figuren, vor denen Hamilton und anderen Gründungsvätern graute, als sie das amerikanische Präsidentschaftssystem schufen. Und doch hat sich die Republikanische Partei diesem Typus ergeben.
Trumps erstes Jahr: Wie aus dem Lehrbuch für gewählte Autokraten
Im ersten Jahr seiner Präsidentschaft hat sich Trump in vielerlei Hinsicht an das fiktive Lehrbuch für gewählte Autokraten gehalten. Er hat versucht, die Schiedsrichter gleichzuschalten, potentiell gefährliche Schlüsselspieler an den Rand zu drängen und die Spielregeln zu seinen Gunsten zu verändern. Aber er hat mehr geredet als gehandelt. Seine berüchtigtsten Drohungen sind nicht in die Tat umgesetzt worden. Besorgniserregende antidemokratische Initiativen, wie die Besetzung des FBI mit seinen Anhängern und die Behinderung von Muellers Ermittlungen, wurden durch Widerstand einiger Republikaner und seiner eigenen Unbeholfenheit durchkreuzt. Eine wichtige Initiative, die Gründung des Beratenden Ausschusses zur Wahlintegrität, steht noch am Anfang, so dass ihre Auswirkungen noch nicht abzusehen sind. Alles in allem ist Präsident Trump, um in unserem Bild zu bleiben, wiederholt wie ein rücksichtsloser Autofahrer an den Leitplanken entlanggeschrammt, aber er hat sie nicht durchbrochen. Trotz klarer Anlässe zur Sorge sind 2017 kaum konkrete politische Rückschritte zu verzeichnen gewesen. Noch haben wir die Grenze zum Autoritarismus nicht überschritten.
Für ein abschließendes Urteil ist es aber noch viel zu früh. Der Niedergang der Demokratie vollzieht sich häufig schrittweise und macht sich erst nach und nach bemerkbar. Vergleicht man Trumps erstes Amtsjahr mit demjenigen anderer Möchtegern-Autokraten, ergibt sich ein gemischtes Bild. In manchen Ländern, in denen potentielle Autokraten durch Wahlen an die Macht gekommen sind, wie Ecuador unter Rafael Correa und Russland unter Wladimir Putin, war der Rückschritt schon im ersten Amtsjahr offensichtlich. In anderen, wie in Peru unter Fujimori und in der Türkei unter Erdoğan, war anfangs kein Rückschritt zu erkennen. Fujimori ließ sich im ersten Amtsjahr als Präsident auf hitzige Redeschlachten ein, unternahm aber fast zwei Jahre lang keine Angriffe auf demokratische Institutionen. In der Türkei begann der Demokratieabbau sogar noch später. Das erste Amtsjahr ist also keineswegs ein Grund zur Entwarnung.
Während Trumps restlicher Amtszeit wird das Schicksal der Demokratie in den Vereinigten Staaten von mehreren Faktoren abhängen.
Der erste ist das Verhalten der republikanischen Parteiführung. Demokratische Institutionen sind ganz wesentlich auf den Willen regierender Parteien angewiesen, sie zu schützen, und zwar selbst vor ihren eigenen Führern. Dass Roosevelts eigenmächtiger Gerichtsbesetzungsplan fehlschlug und Nixon über seine Gesetzesverstöße stürzte, war unter anderem deshalb möglich, weil sich wichtige Mitglieder aus der Partei des Präsidenten – in Roosevelts Fall der Demokraten und in Nixons Fall der Republikaner – entschlossen, aufzustehen und Widerstand zu leisten. In jüngerer Zeit musste auch die polnische Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS) bei ihrem Vorstoß, die Gewaltenteilung abzubauen, einen Rückschlag hinnehmen. Staatspräsident Andrzej Duda, obwohl selbst PiS-Mitglied, legte gegen zwei Gesetze, die es der Regierung erlaubt hätten, das Oberste Gericht zu säubern und neu zu besetzen, sein Veto ein. In Ungarn hingegen leistete die Fidesz-Partei von Ministerpräsident Viktor Orbán kaum Widerstand, als er das Land immer mehr in Richtung Autoritarismus lenkte.
In Trumps erstem Amtsjahr reagierten Republikaner auf dessen Fehlverhalten mit einer Mischung aus Loyalität und bedingter Zustimmung. Anfangs herrschte die Loyalität vor. Aber nachdem der Präsident im Mai 2017 James Comey entlassen hatte, wechselten mehrere republikanische Senatoren zu bedingter Zustimmung, indem sie klarstellten, dass sie keinen Trump-Anhänger als Nachfolger des FBI-Chefs akzeptieren würden. Republikanische Senatoren sorgten auch dafür, dass die russische Einflussnahme auf die Wahl von 2016 weiterhin durch eine unabhängige Untersuchung aufgeklärt werden kann. Einige drängten hinter den Kulissen auf die Einsetzung eines Sonderermittlers durch das Justizministerium, und viele begrüßten Robert Muellers Berufung. Als gemeldet wurde, das Weiße Haus erkunde, wie es Mueller loswerden könne, und einige Trump-Anhänger dessen Absetzung verlangten, meldeten führende republikanische Senatoren wie Susan Collins, Bob Corker, Lindsey Graham und John McCain Einspruch an. Obwohl die Senatoren wohl kaum vorhatten, sich der Opposition anzuschließen – immerhin stimmten sie in mindestens 85 Prozent der Fälle in Trumps Sinne ab –, unternahmen sie Schritte, um den Präsidenten zu zügeln. Zwar verlangte kein führender Republikaner im Jahr 2017 die Amtsenthebung des Präsidenten, aber einige von ihnen schienen, wie die Journalistin Abigail Tracy es ausdrückt, „ihre eigene rote Linie gefunden“ zu haben.
Ein zweiter wichtiger Faktor, von dem das Schicksal der amerikanischen Demokratie abhängt, ist die öffentliche Meinung. Wenn Möchtegern-Autokraten sich nicht auf das Militär stützen und keine Massengewalt organisieren können, müssen sie andere Mittel finden, um Verbündete bei der Stange zu halten und Kritiker in die Schranken zu weisen. In dieser Hinsicht ist die Unterstützung der Öffentlichkeit überaus nützlich. Erfreut sich ein gewählter Führer einer Zustimmungsquote von, sagen wir, 70 Prozent, werden Kritiker zu Mitläufern, die Medienberichterstattung wird freundlicher, Richter zögern, Entscheidungen zu Ungunsten der Regierung zu fällen, und sogar politische Rivalen halten sich zurück, aus Furcht, sich durch scharfen Widerstand selbst zu isolieren. Ist die Zustimmungsquote der Regierung dagegen gering, werden Medien und Opposition angriffslustig, Richter fühlen sich stark genug, dem Präsidenten die Stirn zu bieten, und dessen Verbündete haben plötzlich eine eigene Meinung. Als Fujimori, Chávez und Erdoğan ihre Angriffe auf demokratische Institutionen begannen, genossen sie allesamt eine massive öffentliche Unterstützung. Das heißt: Je höher Präsident Trumps Zustimmungsquoten sind, desto gefährlicher ist er. Seine Popularität hängt sowohl von der wirtschaftlichen Lage als auch von unvorhergesehenen Ereignissen ab. Ereignisse, welche die Unfähigkeit der Regierung offenbaren, wie 2005 der Hurrikan „Katrina“ und die unangemessene Reaktion der Regierung Bush auf diese Katastrophe, können die öffentliche Zustimmung sinken lassen. Andere Entwicklungen wiederum, wie Sicherheitsbedrohungen, können sie steigern.
Dies bringt uns zu einem dritten und letzten Faktor, der sich auf Präsident Trumps Fähigkeit, unserer Demokratie zu schaden, auswirkt, nämlich Krisen. Große Sicherheitskrisen – Kriege oder schwere Terrorangriffe – verändern das politische Klima. Sehr wahrscheinlich steigt damit die Zustimmung zur Regierung. Als sich die Vereinigten Staaten das letzte Mal mit einer massiven Sicherheitskrise konfrontiert sahen, bei den Terroranschlägen des 11. September 2001, schossen die Zustimmungswerte für Präsident George W. Bush auf 90 Prozent. Popularität lockert die engen Grenzen, in denen sich der Amtsinhaber normalerweise bewegt. Und wenn Menschen um ihre Sicherheit fürchten, tolerieren sie bereitwilliger autoritäre Maßnahmen oder fordern sie sogar. Nicht nur Durchschnittsbürger reagieren auf diese Weise. In einer Krise, die anscheinend die nationale Sicherheit bedroht, sind auch Richter generell weniger geneigt, die Macht des Präsidenten einzudämmen. Dem Politologen William Howell zufolge verschwanden nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 die institutionellen Einschränkungen für den Präsidenten, so dass Bush „in Bezug auf die Definition der Krise und die Reaktion auf sie tun konnte, was er wollte“.[18]
Deshalb sind Sicherheitskrisen gefährliche Zeiten für die Demokratie. Staatsführer, die „tun können, was sie wollen“, können demokratischen Institutionen großen Schaden zufügen. Autoritäre Führer wie Fujimori, Putin und Erdoğan haben genau dies getan. Für Möchtegern-Autokraten, die sich von Gegnern unfair behandelt und von demokratischen Institutionen eingeengt fühlen, bietet eine Krise eine günstige Gelegenheit, dies zu ändern. Auch in den Vereinigten Staaten haben Sicherheitskrisen Machtanmaßungen ermöglicht, von Lincolns Aufhebung der Habeas-Corpus-Vorschrift über die Internierung von Amerikanern japanischer Herkunft unter Roosevelt bis zu Bushs Patriot Act. Lincoln, Roosevelt und Bush waren überzeugte Demokraten, und aufs Ganze gesehen nutzten sie ihre durch eine Krise entstandene Machtfülle ausgesprochen zurückhaltend.
Trump hingegen hat kaum jemals Zurückhaltung geübt, ganz gleich, in welchem Zusammenhang. Und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass während seiner Amtszeit ein Konflikt ausbricht. Die Wahrscheinlichkeit dafür wäre unter jedem Präsidenten hoch, immerhin haben die Vereinigten Staaten unter sechs der letzten zwölf Präsidenten entweder Krieg geführt oder schwere Terroranschläge erlebt. Aber angesichts von Präsident Trumps außenpolitischem Unvermögen ist die Gefahr besonders groß. Wir befürchten, dass er eine durch einen Krieg oder Terroranschlag ausgelöste Krise gnadenlos ausnutzen würde, um politische Gegner zu attackieren und Freiheiten einzuschränken, die man in Amerika für selbstverständlich hält. Unserer Ansicht nach stellt dieses Szenario heute die größte Gefahr für die amerikanische Demokratie dar. Wie aber sehen die anderen Szenarien aus – insbesondere für die Zeit nach Trump?
Welches Amerika kommt nach Trump?
Das erste und optimistischste Szenario ist eine rasche Erholung der Demokratie nach Donald Trump. In diesem Szenario scheitert der Präsident politisch: Entweder verliert er die öffentliche Unterstützung oder wird, was am dramatischsten wäre, des Amts enthoben oder zum Rücktritt gezwungen. Die Implosion seiner Präsidentschaft und der Triumph der Trump-Gegner würde den Demokraten neue Kraft verleihen, so dass sie an die Macht zurückkehren und Trumps haarsträubendste Maßnahmen zurücknehmen könnten. Scheitert Präsident Trump spektakulär genug, könnte die öffentliche Abscheu sogar Reformen ermöglichen, welche die Qualität unserer Demokratie verbessern, ähnlich, wie es nach Richard Nixons Rücktritt geschehen ist. Führende Republikaner, die für ihre Verbindung zu Trump einen hohen Preis hätten zahlen müssen, könnten ihren Flirt mit der extremistischen Politik beenden. In dieser Zukunft wäre das Ansehen der Vereinigten Staaten in der Welt rasch wiederhergestellt. Das Trumpsche Zwischenspiel würde als eine Ära tragischer Fehler gesehen, in der die Katastrophe vermieden und die Demokratie gerettet werden konnte, und würde als historisches Beispiel in Schulen gelehrt, in Filmen dargestellt und in Studien analysiert werden.
Dies ist sicherlich die Zukunft, auf die viele von uns hoffen. Aber sie ist unwahrscheinlich. Immerhin hat der Angriff auf etablierte demokratische Normen – und die ihm zugrundeliegende Polarisierung – lange vor Trumps Einzug ins Weiße Haus begonnen. Die weichen Leitplanken der amerikanischen Demokratie sind schon seit Jahrzehnten gelockert worden. Einfach nur Präsident Trump aus dem Amt zu entfernen, wird sie nicht auf wundersame Weise erneuern. Auch wenn Trumps Präsidentschaft letztlich als vorübergehende Verirrung gesehen werden mag, die nur bescheidene Spuren in unseren Institutionen hinterlassen hat, dürfte ihr Ende allein nicht genügen, um eine gesunde Demokratie wiederherzustellen.
Im zweiten, wesentlich düstereren Szenario würden Präsident Trump und die Republikaner mit einem weißen nationalistischen Profil weiterhin Wahlen gewinnen. Eine Trump-treue Republikanische Partei behielte die Präsidentschaft, beide Häuser des Kongresses und eine Mehrheit der Parlamente in den Bundesstaaten. Zudem gewänne sie am Obersten Gerichtshof schließlich eine solide Mehrheit. Danach würde sie mit harten verfassungsrechtlichen Bandagen dauerhafte weiße Wählermehrheiten schaffen. Dies könnte durch eine Kombination von umfangreichen Ausweisungen, Einwanderungsbeschränkungen, Wählerlistensäuberungen und strengen Wähleridentifikationsgesetzen geschehen. Ergänzt würden die Maßnahmen zur Umgruppierung der Wählerschaft wahrscheinlich durch die Abschaffung des Filibusters und anderer Regeln zum Schutz von Senatsminderheiten, damit die Republikaner selbst mit knappen Mehrheiten ihre Agenda durchsetzen können. Dies alles mag extrem erscheinen, aber jede dieser Maßnahmen ist bereits von der Regierung Trump zumindest in Erwägung gezogen worden.
Natürlich wäre das Bemühen, durch die künstliche Schaffung einer neuen weißen Wählermehrheit eine republikanische Dominanz zu zementieren,zutiefst undemokratisch. Solche Maßnahmen würden bei einem breiten Spektrum von Kräften auf Widerstand stoßen, bei Progressiven und Minderheiten ebenso wie bei einem erheblichen Teil der Wirtschaft. Sie könnten zu eskalierenden Konfrontationen und sogar zu gewalttätigen Auseinandersetzungen führen, was wiederum größere Polizeirepression und Selbstjustiz – im Namen von „Gesetz und Ordnung“ – nach sich ziehen könnte. Um einen Eindruck zu erhalten, wie solche Brutalität legitimiert werden würde, braucht man sich nur die Werbespots der NRA anzusehen oder sich anzuhören, was republikanische Politiker über die Bewegung „Black Lives Matter“ sagen.
Dieses Alptraumszenario ist nicht wahrscheinlich, aber auch nicht undenkbar. Ein Beispiel dafür zu finden, dass eine schrumpfende ethnische Mehrheit ihre dominante Stellung kampflos aufgegeben hat, fällt schwer. Im Libanon trug die demographische Schrumpfung der dominanten christlichen Gruppen dazu bei, dass das Land für 15 Jahre in einen Bürgerkrieg versank. Israel reagiert auf die demographische Bedrohung, die durch die De-facto-Annexion des Westjordanlandes entstanden ist, damit, dass es ein politisches System herausbildet, das zwei frühere Ministerpräsidenten des Landes mit der Apartheid verglichen haben. Und in den Vereinigten Staaten haben Südstaatendemokraten nach der Reconstruction-Ära die Bedrohung ihrer Machtstellung durch schwarze Wähler abgewehrt, indem sie Afroamerikanern für fast ein Jahrhundert ihre Rechte nahmen. Obwohl weiße Nationalisten in der Republikanischen Partei weiterhin in der Minderheit sind, deutet der lauter werdende Ruf nach strengeren Wähleridentifikationsvorschriften und der Säuberung der Wählerlisten – wie sie der einflussreiche Justizminister Jeff Sessions und der amtierende Vorsitzende des Wahlintegritätsausschusses Kris Kobach fordern – darauf hin, dass die Neuordnung der Wählerschaft auf der Agenda der Republikanischen Partei steht.
Das dritte Szenario für eine Zukunft nach Trump, das wir für das Wahrscheinlichste halten, ist gekennzeichnet durch Polarisierung, die weitere Abkehr von ungeschriebenen politischen Konventionen und eine sich verschärfende institutionelle Kriegsführung – anders gesagt, durch eine Demokratie ohne solide Leitplanken. In diesem Szenario können Präsident Trump und der Trumpismus durchaus scheitern; es würde die Kluft zwischen den Parteien aber kaum verringern und die Erosion der gegenseitigen Achtung und Zurückhaltung nicht aufhalten.
Das Schicksal der Demokratie – und wovon es abhängt
Um einen Vorgeschmack zu bekommen, wie eine Politik ohne Leitplanken in den Vereinigten Staaten aussehen könnte, schaue man sich das heutige North Carolina an. North Carolina ist ein klassischer „swing state“, also einer, in dem man bei Wahlen ein knappes Ergebnis erwartet. Mit einer diversifizierten Wirtschaft und international anerkannten Universitäten ist North Carolina reicher, urbaner und gebildeter als die meisten anderen Südstaaten. Außerdem besitzt der Bundesstaat eine gemischte Bevölkerung, die sich zu rund 30 Prozent aus Afroamerikanern, asiatischstämmigen Amerikanern und Latinos zusammensetzt.[19] All dies macht North Carolina zu einem für Demokraten günstigeren Territorium als die anderen Bundesstaaten im tiefen Süden. Die Wählerschaft von North Carolina entspricht der landesweiten: Sie ist zu gleichen Teilen in Demokraten und Republikaner gespalten, wobei die Demokraten in den urbanen Zentren wie Charlotte und Raleigh-Durham und die Republikaner auf dem Land dominieren. North Carolina ist, um den Rechtsprofessor Jedediah Purdy von der Duke University zu zitieren, zu einem „Mikrokosmos der hyperparteiischen Politik und des wachsenden gegenseitigen Misstrauens“ geworden.[20] North Carolina zeigt, wie eine Politik ohne Leitplanken aussehen könnte – und gestattet den Blick in eine mögliche Zukunft der Vereinigten Staaten. Wenn aus rivalisierenden Parteien Feinde werden, verkommt der politische Wettstreit zu Kriegsführung und verwandeln sich unsere politischen Institutionen in Waffen. Das Ergebnis ist ein politisches System, das ständig am Rand der Krise entlangtaumelt.
Vergleicht man die gegenwärtige problematische Lage in den Vereinigten Staaten mit den Krisen der Demokratie in anderen Teilen der Welt und zu anderen Zeiten, wird klar, dass sich die Vereinigten Staaten gar nicht so sehr von anderen Ländern unterscheiden. Unser Verfassungssystem ist zwar älter und robuster als jedes andere in der Geschichte, aber doch für dieselben Krankheiten anfällig, an denen Demokratien anderswo gestorben sind. Letztlich sind also wir, die Bürger der Vereinigten Staaten, verantwortlich für die amerikanische Demokratie. Kein politischer Führer kann die Demokratie allein aushebeln, aber auch keiner kann sie allein retten. Die Demokratie ist ein Gemeinschaftsunternehmen. Ihr Schicksal hängt von uns allen ab.
Der Beitrag basiert auf dem soeben im DVA Verlag erschienenen Buch der beiden Autoren, „Wie Demokratien sterben“. Die Übersetzung aus dem Englischen stammt von Klaus-Dieter Schmidt.
[1] Shanto Iyengar, Gaurav Sood und Yphtach Lelkes, Affect, Not Ideology. A Social Identity Perspective on Polarization, in: „Public Opinion Quarterly“,3/2012, S. 417 f.
[2] Pew Research Center, Partisanship and Political Animosity in 2016, 22.6.2016, www.people-press.org.
[3] It’s Official: The U. S. Is Becoming a Majority-Minority Nation, in: „U.S. News & World Report“, 6.7.2015
[4] Sandra L. Colby und Jennifer M. Ortman, Projections of the Size and Composition of the U.S. Population: 2014-2060, United States Census Bureau Current Population Reports, März 2015, www.census.gov.
[5] Michael Tesler, Post-Racial or Most-Racial? Race and Politics in the Obama Era, Chicago 2016, S. 166-168; Alan Abramowitz, The Polarized Public? Why American Government Is So Dysfunctional, New York 2012, S. 29.
[6] 2016 bezeichneten sich schon 76 Prozent der weißen Evangelikalen als Anhänger der Republikaner, vgl. Pew Research Center, The Parties on the Eve of the 2016 Election. Two Coalitions, Moving Further Apart, 13.9.2016, www.people-press.org.
[7] Alan Abramowitz, The Polarized Public?, a.a.O., S. 67.
[8] Alan Abramowitz, The Disappearing Center, S. 66-73; Tesler, Post-Racial or Most-Racial?, S. 129.
[9] Matthew Levendusky, How Partisan Media Polarize America, Chicago 2013,S. 14-16; Matt Grossman und David A. Hopkins, Asymmetric Politics. Ideological Republicans and Interest Group Democrats, New York 2016, S. 149-164.
[10] Zit. in Grossman und Hopkins, a.a.O., S. 177.
[11] Richard Hofstadter, The Paranoid Style in American Politics and Other Essays, New York 1967, S. 4.
[12] Arlie Russell Hochschild, Fremd in ihrem Land. Eine Reise ins Herz der amerikanischen Rechten, Frankfurt am Main 2017; dies, Weiß und stolz und abgehängt. Donald Trump und der Südstaaten-Rassismus, in: „Blätter“, 10/2017, S. 55-67.
[13] Ann Coulter, Adios America! The Left’s Plan to Turn Our Country into a Third World Hellhole, Washington, D. C. 2015, S. 19.
[14] Douglas Brinkley, Donald Trump, Slipping in Polls, Warns of „Stolen Election“, in: „The New York Times“, 14.10.2016.
[15] Poll: 41 Percent of Voters Say Election Could Be Stolen from Trump, in: „Politico”,17.10.2016.
[16] So Trump am 1.2.2016 in Iowa, siehe: Don’t Believe Donald Trump Has Incited Violence at Rallies? Watch This Video, www.vox.com, 12.3.2016.
[17] Donald Trump Threatens to Rewrite Libel Laws to Make It Easier to Sue the Media, in: „Business Insider“, 26.2.2016.
[18] William G. Howell, Power without Persuasion. The Politics of Direct Presidential Action, Princeton, New Jersey 2003, S. 184.
[19] Siehe www.census.gov/quickfacts/NC.
[20] Jedediah Purdy, North Carolina’s Partisan Crisis, in: „The New Yorker“,20.12.2016.