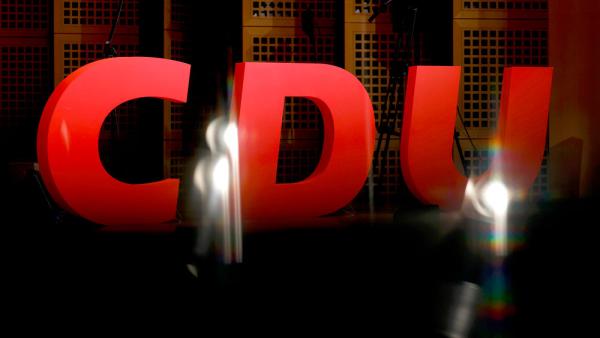Bild: Der damalige Präsident Donald J. Trump wird am El Paso International Airport von Ted Cruz begrüßt, 7. August 2019 (White House, Public Domain)
Angeheizt durch die dramatischen Ereignisse in den USA nimmt auch hierzulande die Debatte über Identitätspolitik wieder an Fahrt auf. Dabei wird allzu oft der Eindruck erweckt, dass wir es mit einer spiegelbildlichen Moralisierung von links wie rechts zu tun hätten, die im Ergebnis ein radikales Freund-Feind-Denken hervorbringe.
Die Moralisierung der Politik durch ein urbanes linksliberales Milieu werde von rechts mit ebensolcher Moralisierung der Trumpisten beantwortet. Von beiden Seiten würden konkurrierende Politikvorschläge als nicht nur unerwünscht, sondern als unmoralisch diffamiert. „Querdenker und Klimaradikale eint die Respektlosigkeit im Geiste einer subjektivistisch überheblichen Moralität, die nichts anderes ist als eine Distinktion von Privilegierten“, so heißt es etwa beim Chefredakteur der „Welt“, Ulf Poschardt. Im Ergebnis kippe die moralistische Konkurrenzsituation in totale Verfeindung und damit in einen latenten Bürgerkrieg.
Diese Darstellung droht das falsche Bild einer Art Symmetrie zu erzeugen. Es entsteht nämlich der Eindruck, dass von links wie rechts gleichermaßen das Freund-Feind-Schema angewendet wird. Damit fällt jedoch völlig unter den Tisch, dass Verfeindung sowohl durch Moralisierung als auch – und gegenwärtig offensichtlich weit gefährlicher – durch radikale Entmoralisierung in die Welt kommen kann.
Das eigentlich Neue und Gefährliche an der Neuen Rechten ist nämlich in der Tat gerade nicht, dass sie mehr moralisiert, sondern dass sie radikal entmoralisiert. In allen relevanten Ländern ist es in erster Linie die Transformation zur Amoralität konservativer Parteien, die die Institutionen und Mechanismen der repräsentativen Demokratie infrage stellt, nicht die Moralisierung von links. Es ist das konservative Lager, welches die Einhaltung der Spielregeln aufkündigt, und nicht das progressive Lager.
Am Verhalten Donald Trumps zum Ende seiner Amtszeit entsetzt doch vor allem der Umstand, dass er bei seiner gezielten Zerstörung der demokratischen Institutionen gar nicht so tut, als habe er Werte, die über die persönliche Bereicherung hinausgingen. Für einen Patrioten wie John McCain hat Trump nur Spott übrig. Doch Trump ist in dieser Hinsicht nur die Spitze eines Eisbergs, der seit der historischen Zäsur von 1989/90 immer weiter auftaucht. Das gilt bereits für den dezidiert amoralischen – um nicht zu sagen antimoralischen – Aufstieg Silvio Berlusconis in den 90er Jahren. Dessen seltsame Fusion aus Wirtschaftszampano, Schlagerpianist und Fußball-Pate präfigurierte geradezu Trumps Aufstieg. Auch hier war es das konservative Lager, welches dieser Art der politischen Kommunikation die Tür öffnete und der Entzivilisierung auf allen Ebenen Vorschub leistete – Stichwort „Bunga-Bunga“. Bereits im Falle Berlusconis bestand der entscheidende Schritt in der „Aufkündigung der Heuchelei“, also der entzivilisierenden These, dass doch eigentlich alle korrupt seien. Seitdem sehen wir immer wieder die Konfrontation zwischen einer moralisierenden Linken und einer Neuen Rechten die erklärt, Darwin habe recht, Christen seien naiv, das Leben sei ein Kampf, das Recht eine Illusion, man müsse Härte zeigen.
Diese Asymmetrie zeigt sich heute allerdings in noch viel dramatischerer Weise im Niedergang der Republikaner in den USA, in ihrer Transformation unter Trump hin zu einer Art politischen Sekte. Das wird noch mehr als in den letzten vier Jahren für die Zeit nach Trump gelten. Denn nicht Trump ist das eigentliche Rätsel, sondern eine Partei, die sich ihm bereitwillig auslieferte – unter Preisgabe jedes moralischen Anspruchs.
Die Enthemmung der niedersten Impulse
Ja, es mag sein, dass ein Teil des links-liberalen Lagers die eigenen politischen Präferenzen moralisiert und sich damit zu einer Art kollektivem Über-Ich aufschwingt. Aber ein Übermaß an Moral und „Korrektheit“ ist keinesfalls im gleichen Maße demokratiegefährdend wie eine öffentliche Verherrlichung der untersten Triebe, des Es. Eine solche Regression inkarniert Trump, die Enthemmung der niedersten Impulse, die Verachtung von Wissenschaft und Wahrheit, ein infantil anmutender Narzissmus. Das neurechte Angebot, alle Hemmungen fallen zu lassen, das Über-Ich zum Teufel zu jagen und ganztägig „die Sau rauszulassen“, endlich sein zu dürfen, wie man sein will, narzisstisch, xenophob, sexistisch und gewaltaffin, ist sehr viel gefährlicher als jede denkbare Arroganz vermeintlicher Moralapostel.
Hier besteht gerade keine Symmetrie im Freund-Feind-Schema. Würde die Rechte moralisieren, wäre Trump längst untragbar geworden – oder er hätte sich wenigstens die Mühe machen müssen, die eigene Verkommenheit nicht immer wieder offen am Telefon auszuplaudern. Dann müsste er seinen Dilettantismus vor Menschen mit echtem Patriotismus und Ehrgefühl verstecken und dürfte Weltkriegsveteranen nicht als „Loser“ bezeichnen. Ja, dann müsste er angesichts der behaupteten konservativen Ansprüche eigentlich sogar selbst „gedient“ und damit die patriotische Pflicht gegenüber seinem Land erfüllt haben. Solange das konservative Lager eine plausible Argumentation für die bleibende Rolle des Nationalstaats, die Regulierung von Migration, die Vermittlung von Traditionen oder religiösen Bindungen formulieren würde, müssten wir uns um die demokratischen Institutionen keinerlei Sorgen machen. Einer Moralisierung von links würde dann ganz gelassen und zivilisiert mit moralischen Gegenwerten von rechts begegnet.
Wo die latente Krise der repräsentativen Demokratie indes eskaliert, geschieht genau dies nicht: Hier wird (angebliche) Hypermoral gerade mit dem Gegenteil, nämlich mit „Hypomoral“, also dem Unterlaufen jeglicher Moral im Sinne offener Amoralität, beantwortet: also gegen Traditionen, gegen die Einhaltung formaler Verfahren, gegen das christliche Menschenbild argumentiert und gehandelt.
Während die USA unter Trump hier schon einen großen Schritt „voran“-gekommen sind, stellen der Nationalismus und Populismus in Polen einen interessanten Sonderfall dar: Hier wird zwar teilweise noch von rechts moralisiert, aber wie lange noch? Orbáns Ungarn hat jedenfalls längst jenen Punkt überschritten, an dem die Moralisierung in Entmoralisierung kippt.
Entscheidend für das grassierende Freund-Feind-Denken ist somit weniger die Moralisierung von links, sondern der in vielen Ländern zu beobachtende Trend zur Entmoralisierung von rechts. Wer moralisiert, entmenschlicht den anderen gerade nicht. Er mag ihn verabscheuen, für verwerflich halten, aber er spricht ihn ja gerade als verantwortungsfähigen Adressaten moralischer Appelle an. Das mag man aufdringlich, nervig, ja eitel finden, aber aus soziologischer Sicht ist ein solches Argumentationsmuster völlig unvermeidlich.
Das gängige Code-Wort rechter Hypomoral ist dabei der Begriff „Gutmensch“. Wer von „Gutmenschentum“ spricht, insinuiert, Moral sei nur ein Mittel der Unterdrückung der Starken, der tyrannischen Herrschaft moralisierender Nannys. Aber selbst eine Kritik an der Gesinnungsethik und der Verweis auf die unschönen Folgen schönen Handelns (oder Nicht-Handelns) argumentiert moralisch: Verantwortungsethik ist auch eine Ethik. Nicht der linke „Moralismus“, sondern der Selbstverrat des Konservatismus ist somit das eigentliche Problem.
Die USA als Vorschein deutscher Verhältnisse?
Dass wir in Deutschland derzeit (noch!) keine Krise der Demokratie vergleichbar der Eskalation in den USA erlebt haben, hängt wesentlich damit zusammen, dass der deutsche Konservativismus bis jetzt, und allen Versuchungen zum Trotz, die Brandmauer zur AfD aufrechterhält – übrigens auch und gerade, indem er moralisiert. Doch immer wieder sehen wir Steine in dieser Mauer fallen, wenn man nur an die Wahl Thomas Kemmerichs in Thüringen vor einem Jahr und die jüngsten Ereignisse in Sachsen-Anhalt denkt. Die Steine brechen immer dort heraus, wo sich die CDU und CSU auf eine Argumentation einlassen, die eher mit Darwin als mit Jesus, mit Nietzsche als mit Benedikt argumentiert. Es mag dabei skurrile Mischformen geben, etwa wenn Götz Kubitschek Jesus Christus als eine Art Kriegsgott in Anspruch nimmt, der das Abendland erretten soll. Aber zumindest analytisch lässt sich diese Grenze klar ziehen.
Die eigentlich entscheidende Frage aber lautet, wie das gerade im intellektuellen Milieu so gängige Bild von der gefährlichen Moralisierung überhaupt entstehen konnte?
Sein Ursprung dürfte in einer spezifischen Ausdeutung der Kategorie der „Moralisierung“ liegen, die sich stark auf Niklas Luhmann beruft. Dieser hatte stets betont, Moral sei als frei flottierender Kommunikationsstoff in allen Funktionssystemen mehr störend als förderlich, schlimmstenfalls „polemogen“, also kriegs- bzw. eskalationsfördernd und damit im Ergebnis brandgefährlich. Dieses Argument steht überall dort im Hintergrund, wo vor der Moralisierung der Linken gewarnt wird. Luhmann übersah dabei allerdings, dass auch funktional ausdifferenzierte Gesellschaften ganz selbstverständlich in komplexen Funktionssystemen mit moralischen Kategorien operieren. Natürlich sind auch in der Politik moralische Argumente erlaubt. Natürlich sind auch Unternehmen als Träger moralischer Verantwortung adressierbar. Natürlich gibt es auch im Krieg moralische Kategorien: Kinder erschießt man nicht nur deshalb nicht, weil es das Kriegsrecht verbietet.
Der Begriff der „Moralisierung“ insinuiert dagegen die Überflutung eines Funktionssystems mit falschen Kategorien. Dabei ist moralische Kommunikation überall ganz normal: Alles kann nicht nur ökonomisch, wissenschaftlich, politisch betrachtet werden, sondern auch moralisch. Eine moralische Beschreibung oder Bewertung ist deshalb keineswegs ein Kategorienfehler (auch wenn der Neoliberalismus bekanntlich behauptete, beim Geschäft gehe es nur ums Geschäft).
Die politisch relevante Frage müsste daher heute eher auch für Konservative lauten: Lassen sich nicht auch – und vielleicht sogar gerade – moralische Argumente finden gegen eine chaotische Migrationspolitik, eine unsoziale Klimapolitik, eine überschießende Gleichstellungspolitik? Oder gegen was auch immer am linksliberalen Lager Unbehagen bereitet.
Insofern scheint die historische Gefährdung der autoritär und populistisch werdenden konservativen Parteien nicht in einer angeblichen Moralisierung, sondern gerade in der Verabschiedung von der Moral zu bestehen: Kruder Darwinismus und Mafiadenken sind eben gerade kein „Realismus“, sondern schlicht „Untermoralisierung“, Hypomoral und damit ein Einfallstor zur Entzivilisierung.