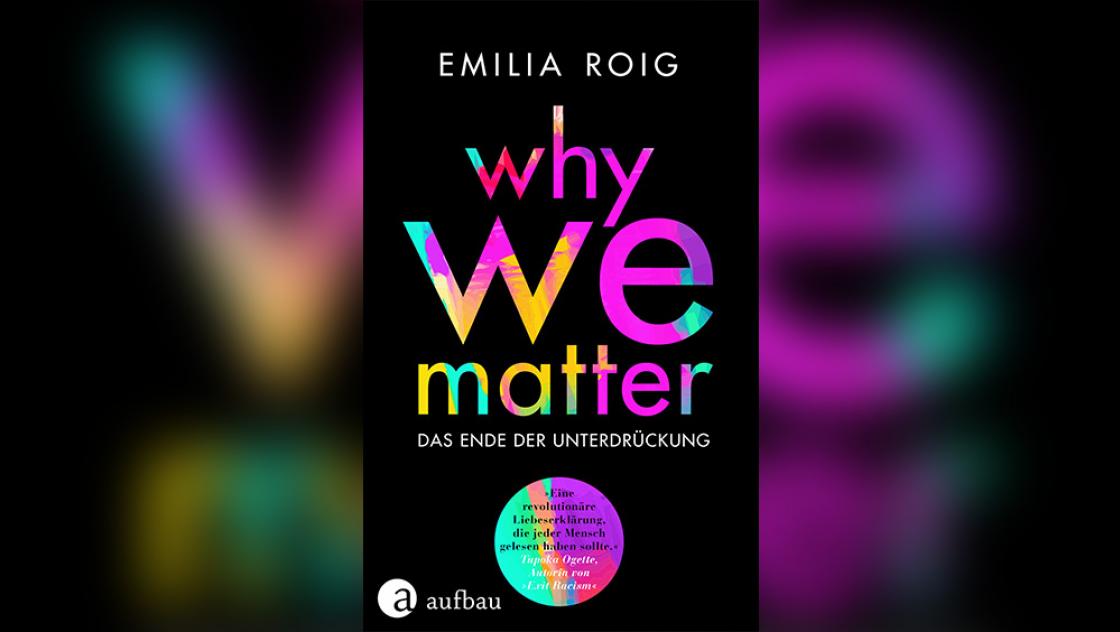
Bild: Aufbau Verlag
Mit einiger Verzögerung hat sich die Auseinandersetzung mit Rassismus und kolonialer Geschichte inzwischen auch in Deutschland einen festen Platz innerhalb der Linken und im Feminismus erobert. Das Konzept der „Intersektionalität“, wonach unterschiedliche Unterdrückungsmechanismen wie etwa Rassismus und Sexismus sich „überkreuzen“, sich also nicht nur einfach aufaddieren, sondern auch gegenseitig beeinflussen, ist mittlerweile in vielen politischen Kontexten gängig – auch wenn nicht immer genau klar wird, was damit gemeint ist, und der Begriff manchmal auch als Schlagwort dient. Der Erfolg und die Sichtbarkeit der US-amerikanischen „Black Lives Matter“-Bewegung hat diesen Prozess noch einmal beschleunigt.
Allerdings wird Rassismus noch häufig als ein Problem individuellen moralischen Versagens verstanden und weniger als Ausdruck gesellschaftlicher Strukturen und symbolischer Ordnungen. Die öffentliche Debatte ist auf diesem Gebiet mehr noch als bei anderen Themen geprägt von moralischen Schuldzuweisungen auf der einen Seite und empörter Zurückweisung von Kritik unter Verweis auf die eigene gute Absicht auf der anderen – während es doch darauf ankäme, Strukturen zu analysieren, Mechanismen zu durchschauen, Narrative zu hinterfragen und neu zu entwerfen. Soziale Bewegungen können ihrem Versprechen, für eine gerechte Gesellschaft einzutreten, nur nachkommen, wenn in ihnen migrantische, Schwarze und andere Perspektiven „of Color“ eine maßgebliche Stimme erhalten. Doch trotz des guten Willens herrscht noch viel Unwissenheit. Um es zugespitzt zu sagen: Während Linke in Deutschland alle ihren Karl Marx gelesen haben und Feminist*innen alle ihre Simone de Beauvoir, so steckt die Lektürearbeit in Bezug auf postkoloniale oder rassismuskritische Vordenker*innen noch in den Anfängen.
Deshalb kommt das Buch der Politikwissenschaftlerin Emilia Roig „Why we matter. Das Ende der Unterdrückung“ genau zur richtigen Zeit. Roig verbindet darin ihre eigene Lebensgeschichte mit theoretischen Analysen, berichtet von ihren Erkenntnisfortschritten in Bezug auf die Zusammenhänge verschiedener Diskriminierungsformen und macht das alles immer wieder mit Hilfe von Erzählungen alltäglicher Begebenheiten anschaulich. Gleichzeitig setzt sie kein Vorwissen voraus und erklärt die Konventionen, die sich im postkolonialen Diskurs etabliert haben, so beispielsweise warum „Schwarz“ in Bezug auf die Hautfarbe groß, „weiß“ aber klein geschrieben wird.
Tatsächlich verfügt Roig aufgrund ihrer Familiengeschichte über ungewöhnlich viele persönliche Erfahrungen mit sehr unterschiedlichen Aspekten von Diskriminierung. Ihre Mutter, Krankenschwester, stammt aus der französischen Karibik-Kolonie Martinique, litt in ihrer Kindheit Armut und erlebte später in Frankreich klassischen, ungeschminkten Rassismus. Ihr Vater, Arzt, stammt aus einer jüdischen Familie in Katalonien, wurde aber in Algerien geboren. Seine Familie pflegte überwiegend einen „kolonialen Lebensstil“, wie Roig schreibt. Die Eltern lebten beide in verschiedenen Ländern, bevor sie sich in Französisch-Guyana kennenlernten. 1980 zogen sie in die Nähe von Paris, wo Emilia Roig 1983 als dritte von vier Schwestern geboren wurde.
Die »Überkreuzung« sozialer Hierarchien
Die „Überkreuzung“ verschiedener sozialer Hierarchien innerhalb der Familie gibt Roig Gelegenheit, bestimmte verbreitete Irrtümer zu widerlegen, etwa die Vorstellung, sogenannte „transracial“-Familien wiesen eine größere Sensibilität in Bezug auf rassistische Strukturen auf. Eher ist das Gegenteil richtig, dass nämlich diese Familien für Rassismus besonders anfällig sind. Wenn ein Elternteil Schwarz, ein anderes weiß ist, kann die damit verbundene soziale Hierarchie im Alltag nicht ignoriert werden, das heißt, es wird häufig über das Thema gesprochen, aber eben oft innerhalb der vorherrschenden rassistischen Narrative.
So war Roig als Kind selbst stolz darauf, nicht „Schwarz“ zu sein, sondern „métisse“, und sie freute sich, dass ihre Haare glatter waren als die ihrer Schwester. Die Abwertung bestimmter Eigenschaften, die Schwarzen Menschen zugeschrieben werden, erlernte sie sozusagen im Kinderzimmer, ebenso aber auch die zweifelhafte Beteuerung, dass es auf Hautfarbe nicht ankomme. Eindrücklich sind auch Roigs Schilderungen der Gleichzeitigkeit von Unvereinbarem in der Person ihres Großvaters väterlicherseits: Dieser war Anhänger von Jean-Marie Le Pen und offen rassistisch. „Meine ganze Kindheit über habe ich aus seinem Mund Beleidigungen über Schwarze, Araber*innen, Muslim*innen und ab und zu Juden*Jüdinnen gehört. Gleichzeitig war er ein sehr lieber Opa und hat mich und meine Schwestern wie seine anderen Enkelkinder behandelt, die weiß sind.“
Nach den Erfahrungen ihrer Kindheit und Jugend schildert Roig auch jene ihres Studiums – unter anderem bei Kimberlé Crenshaw, der US-amerikanischen Juristin und Professorin, die 1989 den Begriff „Intersektionalität“ geprägt hat, ihr Leben als Mutter, als Aktivistin, als Feministin. Auf diese Weise bietet das Buch vielfältige Anknüpfungspunkte.
Die Vernichtung symbolischer Ordnungen
Interessant ist zum Beispiel das Kapitel über „Die Auslöschung und Aneignung von Wissen“, ein Prozess, den – wie man bei Roig erfährt – der portugiesische Soziologe Boaventura de Sousa Santos als „Epistemizid“ bezeichnet, als Tötung von Wissenssystemen. Dass der Kampf gegen diskriminierende Strukturen nicht nur auf der Ebene der konkreten Gesetzgebung und Machtverhältnisse geführt werden kann, sondern immer auch und vielleicht sogar zuerst auf der Ebene der symbolischen Ordnung, ist eine Erkenntnis, die auch der Feminismus immer betont hat. Tatsächlich ist das Verhältnis von Universalismus und Pluralismus der Erkenntnisformen der vielleicht heikelste, aber vermutlich auch der wichtigste Punkt, an dem Debatten über eine postkoloniale und postpatriarchale Gesellschaft heute zu führen sind.
Roig verweist dabei auch auf den Soziologen Ramón Grosfoguel, der die Eindimensionalität des heutigen Wissens auf vier „Epistemizide“ der europäischen Neuzeit zurückführt: die Vertreibung der europäischen Muslim*innen sowie der Jüdinnen und Juden während der spanischen Reconquista, die Kolonisierung der indigenen Völker Amerikas, der transatlantische Handel mit Sklav*innen sowie die europäischen Hexenverfolgungen. Aus diesen Verbrechen sei der moderne westliche Universalismus hervorgegangen, in dessen Namen eben nicht nur bestimmte Menschengruppen vernichtet worden seien, sondern auch deren Wissenssysteme und symbolische Ordnungen. Aus diesem Grund könne diese Geschichte nicht durch eine einfache Gleichstellung oder Emanzipation der ehemals Verfolgten in die neue hegemoniale Weltsicht und ihre Strukturen hinein behoben werden.
In der popkulturellen Debatte von heute wird das unter dem Schlagwort „kulturelle Aneignung“ verhandelt. Wie ist es zu bewerten, wenn sich etwa weiße Jugendliche Dreadlocks wachsen lassen oder bürgerliche Esoteriker*innen schamanistische Rituale zu praktizieren vorgeben? „Der Grat zwischen einem genuinen Interesse an einer bestimmten Kultur und der kulturellen Aneignung ist schmal“, schreibt Roig, aber genau auf diesem schmalen Grat gilt es zu balancieren. Wenn andere Wissenssysteme einen legitimen Platz im allgemeinen Diskurs bekommen sollen, kann die „Aneignung“ dieses Wissens nicht auf bestimmte Identitätsgruppen beschränkt bleiben. Gleichzeitig gilt es aber eben auch zu verhindern, dass solche differenten Positionen einfach nur als Folklore von der traditionellen Ordnung einverleibt werden, ohne dass dadurch echte Transformationsprozesse angestoßen werden. Auch deshalb sind Roigs Buch viele Leser*innen zu wünschen. Die Lektüre bietet ein gutes Fundament, um solche Debatten mit größerer Sachkenntnis zu führen, als das derzeit oft der Fall ist. Gleichzeitig sollten alle, die sich daran beteiligen wollen, von den zahlreichen weiterführenden Literaturhinweisen Gebrauch machen.
Emilia Roig, Why we matter. Das Ende der Unterdrückung, Aufbau Verlag, Berlin 2021, 397 Seiten, 22 Euro.










