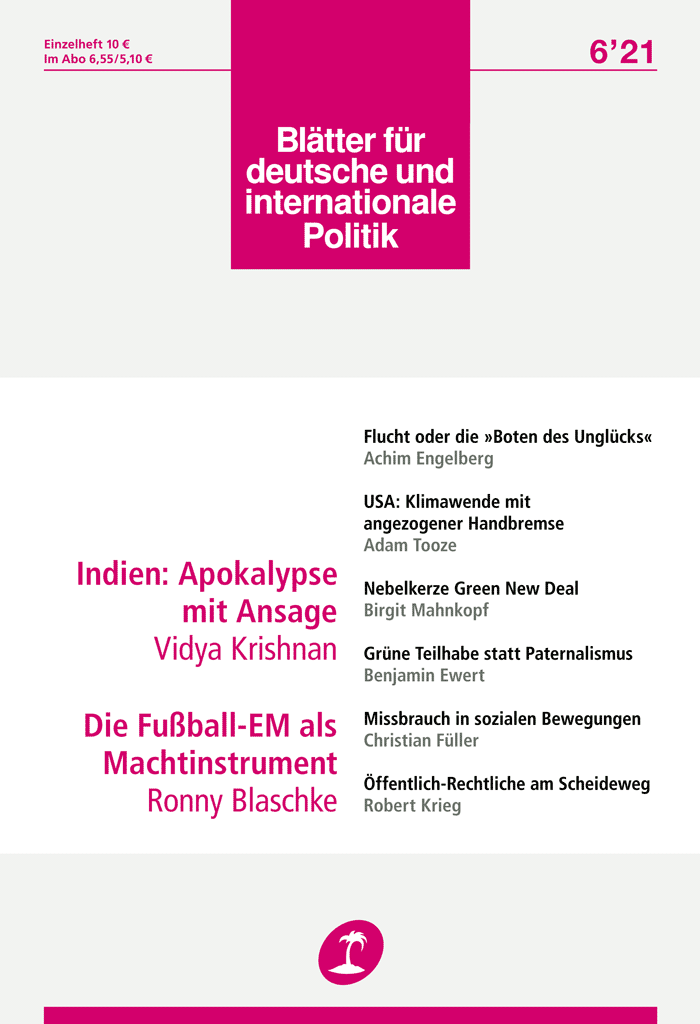Bild: Bundesaußenminister Heiko Maas auf einer Gedenkzeremonie im Ehrenhain in Masar-e Scharif, 29. April 2021 (IMAGO / photothek)
Mit dem Abzug der Truppen aus Afghanistan endet der längste Militäreinsatz in der Geschichte der Nato wie der Bundeswehr – für den grünen Außenpolitiker und ehemaligen Bundesumweltminister Jürgen Trittin Anlass für eine kritische Bilanz.
Die Entscheidung hielt nur wenige Tage: Anfang April dieses Jahres verlängerten 432 Abgeordnete des Bundestages wie jedes Jahr das Afghanistan-Mandat der Bundeswehr. Bis in den Januar nächsten Jahres sollten bis zu 1300 deutsche Soldat*innen am Hindukusch stehen und sogar wieder verstärkt kämpfen. Doch schon mit dem 30. April startete der Abzug. Die Biden-Harris-Administration hat die Reißleine gezogen. Spätestens am 11. September ist Schluss, verkündeten die USA ihren Verbündeten im Brüsseler Nato-Hauptquartier. Afghanistan wird kein forever war – das machte Biden klar. Nun sollen die Truppen sogar bereits bis zum 4. Juli abgezogen sein.
Die stille Beerdigung der größten und längsten Nato-Mission der Geschichte steht in eigentümlichem Kontrast zu ihrem spektakulären Auftakt. Nach den Anschlägen vom 11. September 2001 auf das World Trade Center hatte die Nato zum ersten Mal den Bündnisfall ausgerufen. In Deutschland erzwang damals Bundeskanzler Gerhard Schröder die Zustimmung zum Einsatz sogar mit der Vertrauensfrage. Doch bereits seit einigen Jahren löst das Afghanistan-Mandat im Bundestag nur mehr gepflegtes Gähnen aus. Die Regierungsfraktionen verlängerten, weitgehend losgelöst von der Lage vor Ort routiniert, den Einsatz und mit ebenso routinierter Empörung lehnt die Linkspartei ihn ab.
Die Grünen, über den Einsatz seit 2001 tief gespalten, verweigern seit 2013 dem Mandat mehrheitlich die Zustimmung. Grüne Gegner*innen wie Befürworter*innen des Einsatzes aber haben es schon lange aufgegeben, miteinander über Afghanistan zu streiten. Beide Seiten hofften, dass dieses Problem vom Tisch ist, bevor die Partei erneut an die Regierung kommt. Sie können sich nun bei Joe Biden bedanken.
»Die verbliebenen 10 000 Nato-Soldat*innen unterbanden keine Eskalation. Sie liefern die Zielscheibe und Legitimation dafür.«
Für die Bundeswehr gab es in Afghanistan nichts mehr zu gewinnen. Das Argument, sie müsse bleiben, um einen Bürgerkrieg zu verhindern, hat sich in sein Gegenteil verkehrt. Die verbliebenen 10 000 Nato-Soldat*innen unterbanden keine Eskalation. Sie liefern die Zielscheibe und Legitimation dafür. Sie haben die seit Abschluss des US-Taliban-Abkommens ansteigende Terrorwelle der Taliban gegen Journalist*innen, Richter*innen und andere nicht verhindern können und sollen.
Nach fast zwanzig Jahren Nato-Krieg am Hindukusch ist es Zeit, Bilanz zu ziehen – schon wegen der dort gestorbenen Soldat*innen und der immensen Kosten, die sich allein für den Einsatz der Bundeswehr auf 12,5 Mrd. Euro beliefen. Vor allem aber braucht der längste Militäreinsatz Deutschlands endlich eine umfassende Evaluierung.
Der Einsatz der Nato in Afghanistan im Rahmen von Operation Enduring Freedom stützte sich auf eine Resolution des UN-Sicherheitsrates (Nr. 1368/2001), die alle Staaten ermächtigte, die Bedrohung des Friedens, die sich aus den Anschlägen vom 11. September ergab, auch mit militärischen Mitteln zu unterbinden. Auf dieser klaren völkerrechtlichen Basis begann die Nato ihren Krieg gegen die Taliban. Es war der erste und bisher einzige Einsatz, der sich auf die Beistandsklausel des Artikel 5 des Nato-Vertrages stützte. Damit waren nicht nur die völkerrechtlichen, sondern auch die verfassungsrechtlichen Voraussetzungen für eine Beteiligung Deutschlands gegeben.
»Militärische Siege können politische Lösungen nicht ersetzen.«
Auf dieser klaren rechtlichen Grundlage hatte Operation Enduring Freedom durchaus Erfolg. In kurzer Zeit wurde die Gewaltherrschaft der Taliban beendet und Al Qaida seines Rückzugraums beraubt. Die terroristische Bedrohung des Nato-Partners USA wurde gemeinsam gemindert. Erfolgreich wurde „Deutschlands Sicherheit am Hindukusch verteidigt“, so Ex-Verteidigungsminister Peter Struck. Doch militärische Siege können politische Lösungen nicht ersetzen. So begannen in Afghanistan die langen Jahre des Scheiterns.
In Rahmen der – UN-mandatierten – Operation International Security Assistance Force (ISAF) sollte der Versuch gemacht werden, einen Staat aufzubauen, in dem das Land ohne die Taliban regiert werden kann. Der notwendige zivil-militärische Einsatz wurde neben der Nato von den Vereinten Nationen, der Europäischen Union sowie vielen anderen Staaten mitgetragen. Es wurde Infrastruktur errichtet, in Bildung investiert, Polizei und Justiz aufgebaut. In der Begründung für die Fortsetzung der Mandate im Bundestag erfuhr dieser zivile Aspekt der Militärintervention eine mythische Überhöhung. Die Nato-Soldat*innen führten angeblich keinen Krieg, sondern sorgten dafür, dass die afghanischen Mädchen zur Schule gehen konnten.
Das war zwar ein wichtiger und richtiger Effekt. Der eigentliche Zweck der Militäroperation war jedoch der Aufbau eines Staates ohne Regierungsbeteiligung der Taliban. Die Legitimität eines solchen Staates wurde aber von den Nato-Truppen und ihren Verbündeten im Anti-Terrorkampf systematisch beschädigt. Nächtliche Razzien mit regelmäßigen Massakern sowie Bomben- und Drohnenangriffe auf die Zivilbevölkerung rissen alles ein, was zivile Aufbauhilfe mühsam errichtet hatte. Noch heute müssen sich australische Soldat*innen wegen Kriegsverbrechen in Afghanistan vor Gericht verantworten. Deutsche Soldat*innen ließen sich – laut Selbstzeugnissen in Sönke Neitzels Buch „Deutsche Krieger“ – aus den Stäben in Kabul versetzen, weil sie Zeug*innen von Gräueltaten der US-Verbündeten wurden.
Die allermeisten Opfer unter der Zivilbevölkerung haben die Taliban zu verantworten. Doch mit den fahrlässig bis vorsätzlich in Kauf genommenen zivilen Opfern beförderten die Koalitionstruppen das Erstarken der Taliban ebenso wie sie die Legitimität der afghanischen Regierung untergruben.
Mit dem „Gemeinsam rein“ endeten die Gemeinsamkeiten unter den Nato-Verbündeten in Afghanistan. Ein „Gemeinsam drinnen“ hat es nie gegeben. Während deutsche und andere Verbündete auf zivil-militärische Staatenbildung setzten, konzentrierten sich die militärisch dominanten USA unter den Präsidenten Bush, Obama und Trump auf die Aufstandsbekämpfung. Und 2017 kündigte Donald Trump jedes weiterreichende Ziel mit dem Satz: „We are not nation-building again. We are killing terrorists.“
»Der Versuch, Afghanistan durch die Afghan*innen, aber ohne die Taliban zu regieren, war bereits 2014 gescheitert.«
Der Versuch, Afghanistan durch die Afghan*innen, aber ohne die Taliban zu regieren, war aber bereits 2014 gescheitert. Mit dem Ende des UN-Mandats für ISAF sollte die Sicherheitsverantwortung den Afghan*innen übertragen werden. Die Verbündeten wollten dies zwar weiter finanzieren, aber nicht länger mit eigenen Soldat*innen Sicherheit garantieren.
Die afghanische Regierung tat wenig dafür, dieser Verantwortung gerecht zu werden. Sie wollte das Land gar nicht ohne das Faustpfand ausländischer Truppen regieren. Die Nato-Truppen wurden so zu Geiseln im innerafghanischen Machtkampf.
Die Geiselnahme bekam 2015 den Namen Resolute Support Mission (RSM). Die Nato sollte nun nicht mehr kämpfen, sondern nur noch ausbilden. Heute, gut fünf Jahre später, gesteht die Bundesregierung ein, dass RSM gescheitert ist. Die Sicherheitslage ist nicht nur „prekär“, sondern nach über fünf Jahren Ausbildung und Milliarden Ausstattungshilfe sind die afghanischen Streitkräfte nach Einschätzung der Bundesregierung „weiterhin noch nicht in der Lage, flächendeckend selbstständig für Sicherheit zu sorgen“. Pro Jahr verliert die afghanische Armee ein Drittel der ausgebildeten Kräfte. Die meisten werden nicht Opfer der Taliban, sondern verschwinden einfach oder laufen über. Faktisch steht die Nato vor einem Scherbenhaufen. Das Kriegsziel, Afghanistan künftig ohne die Taliban zu regieren, ist gescheitert – trotz ISAF, trotz RSM.
Aus der Erkenntnis von einem Jahr Erfolg und 19 Jahren Scheitern entstand Donald Trumps Abkommen mit den Taliban – an der afghanischen Regierung vorbei. Der Kern des Deals lautete Machtteilhabe gegen die Garantie, dass aus Afghanistan keine Gruppen, Al Qaida eingeschlossen, die Sicherheit der Vereinigten Staaten und ihrer Verbündeten gefährden. Im Gegenzug sagten die USA zu, zusammen mit ihren Verbündeten abzuziehen. Biden hat diesen Kern des Abkommens nun bestätigt.
»Grundlage des humanitären Interventionismus war die Erfahrung aus den Kriegen des zerfallenden Jugoslawien.«
Was bedeutet all dies für die deutsche Außen- und Sicherheitspolitik?
Seit dem Ende des Kalten Krieges hat sich Deutschland an einer Reihe militärischer Interventionen in unterschiedlichen Formaten beteiligt. Nicht alle sind so gescheitert wie der Krieg am Hindukusch. Doch beleuchtet der Afghanistan-Einsatz gerade wegen seiner Dauer und seines Aufwands die Grenzen eines humanitären Interventionismus, wie er sich in den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts herausgebildet hat.
Grundlage des humanitären Interventionismus war die Erfahrung aus den Kriegen des zerfallenden Jugoslawien. Damit kehrte der Krieg zurück nach Europa. Die Deutschen und mit ihnen die Grünen mussten lernen, dass man angesichts schwerster Menschenrechtsverletzungen auch durch Nicht-Handeln schuldig werden kann.
Zwar krankte die mit großer Geste vorgetragene Haltung schon damals daran, dass Europa seine Moral primär dort zur Anwendung brachte, wo seine Interessen berührt waren – also auf dem Balkan und eben nicht in Ruanda. Doch die auf die Balkaninterventionen folgenden EU-Beitrittsprozesse der Nachfolgestaaten hatten ohne Zweifel eine friedensstiftende Wirkung.
Afghanistan zeigt nun allerdings, dass Stabilisierung keineswegs die Regel sein muss. Aus diesem Scheitern folgen fünf grundlegende außenpolitische Lehren für die Zukunft.
1. Interventionen sind Entscheidungen für Jahrzehnte
Militärische Interventionen können, so lautet ein breiter Konsens, durchaus Zeitfenster für politische Lösungen schaffen. Das Problem ist die Größe des Zeitfensters – und dass darüber in der Regel unter massivem Zeitdruck entschieden werden muss. Zwar werden Mandate für Interventionen vom Bundestag regelmäßig nur für ein Jahr erteilt. Real aber gibt es kaum Laufzeiten unter einem Jahrzehnt, von wenigen Einsätzen einmal abgesehen. Unter dem Druck, „nicht einfach zuschauen zu können“, erscheint die Intervention oft als einzig moralisch mögliche Handlungsoption. Verantwortungsethik aber heißt, nur dort militärisch zu intervenieren, wo man das militärische Vermögen hat, einen solchen Einsatz auch tatsächlich bis zu einer stabilen Lösung durchzustehen.
In den Augen der afghanischen Zivilgesellschaft hat die Nato mit ihrem kläglichen Abzug moralisch versagt. Ein ähnliches ethisches Versagen zeigt sich in Libyen. Zwar hat sich Deutschland an diesem Nato-Krieg im parteiübergreifenden Konsens nicht beteiligt, ist nun aber von dessen gravierenden Folgen (Staatszerfall und Flucht) im gesamten Sahel- und Mittelmeerraum ebenso betroffen wie die direkt involvierten Staaten.
2. Militärische Siege allein nützen nichts
Interventionen sind also kein Allheilmittel, im Gegenteil: Sie sind in ihren Möglichkeiten überaus begrenzt. Denn militärische Mittel allein schaffen keine Lösung. Der seit den 1980er Jahren währende Krieg am Hindukusch wird nicht so enden wie der Zweite Weltkrieg oder der Vietnamkrieg. Beide kannten klare Sieger und Verlierer. So enden Kriege heute selten. Wenn sie überhaupt enden, so kennen sie „no victors, no vanquished“, wie es Barack Obama treffend beschrieb. Sie enden, wenn sie denn enden, mit einem politischen Kompromiss. Oder werden zum forever war.
Deutschland hatte die Notwendigkeit einer politischen Lösung in Afghanistan früher erkannt als andere. 2007 musste sich der damalige SPD-Vorsitzende Kurt Beck für seine Forderung nach Gesprächen mit den Taliban (den „gemäßigten“ unter ihnen) noch auslachen lassen. Wenige Jahre später organisierte ein deutscher Diplomat für die Taliban schon Büros in Doha. Die aber nutzen sie noch heute.
3. Militär schießt für Interessen, nicht für Werte
Eine politische Lösung zu finden heißt, mit seinen Todfeinden zu sprechen. Es bedeutet, sich mit Terroristen und Kriegsverbrechern an einem Tisch zu setzen und mit ihnen einen Kompromiss zu suchen. So bitter dies ist, „erfolgreiche“ Konfliktbeendigung hat oft einen Deal mit Verbrechern als Preis. Das moralische Aufladen von Einsätzen mag die Akzeptanz von Einsätzen am Anfang begünstigen. Der Verantwortungsethik dient sie nicht. Es gilt daher verbal abzurüsten. Wer sich selbst ehrlich macht, stellt am Ende fest: Militär schießt für Interessen, nicht für Werte.
Solange es gegen die russische Besatzung ging, haben die USA in Afghanistan muslimische Freischärler massiv mit Waffen und Ausbildern unterstützt. Im Jahrzehnt nach dem Abzug der Russen und vor dem 11. September 2001 wurden weder der Ausschluss afghanischer Mädchen von Bildung noch der alltägliche islamistische Terror im Kalifat zum Anlass genommen, in Afghanistan militärisch zu intervenieren. Erst die Erkenntnis, dass ein Raum entstanden war, der die Sicherheit der USA wie Europas bedrohte, löste die Nato-Operation aus. Umgekehrt zeigt Afghanistan, dass eine Politik nach dem Motto „Der Feind meines Feindes ist mein Freund“ nicht nur moralische Standards, sondern auch die eigenen Interessen beschädigt. Sie schafft keine Stabilität, sondern legt den Keim für neue Konflikte.
4. Aufstandsbekämpfung und Staatenbildung beißen sich
Letztlich ist die Nato in Afghanistan nicht militärisch gescheitert, sondern daran, in ein- und demselben Raum zwei höchst disparate Strategien parallel verfolgt zu haben – eine zivil-militärische Strategie des State Building, bei der das Militär vor allem humanitäre Hilfe und den Prozess der Institutionenbildung absichern sollte, und eine Strategie der harten Aufstandsbekämpfung. Im Ergebnis killte Counter Terrorism das State Building.
Verschärft wurde dies durch das wenig koordinierte Nebeneinander von zivilen und militärischen Maßnahmen. Nach Afghanistan ist es daher mehr als fraglich, ob die Nato überhaupt zu einem integrierten zivil-militärischen Ansatz befähigt ist. Dass es allerdings auch in einem eigentlich geeigneteren UN- bzw. EU-Format zu einem Gegeneinander zweier militärischer Strategien kommen kann, belegt die Entwicklung in Mali. Die – französisch geführte – Operation Barkhane und die Aktionen der G5-Allianz unterminieren dort zunehmend die UN-Stabilisierungsmission MINUSMA und die EU-Ausbildungsmission EUTM.
5. Erfolg kann es nur auf sauberer völkerrechtlicher Grundlage geben
Zu Beginn des Afghanistan-Krieges stand die Intervention auf einer klaren völkerrechtlichen Basis – gestützt auf ein Mandat des UN-Sicherheitsrats, durchgeführt von einem System kollektiver Sicherheit, der Nato. Dies ist der fundamentale Unterschied zum von Beginn an völkerrechtswidrigen Irakkrieg, der 2003 gegen die Mehrheit im Sicherheitsrat durch eine Koalition der Willigen begonnen wurde und bis heute den ganzen Mittleren Osten destabilisiert.
Die Intervention in Afghanistan war anfangs auch erfolgreicher als der Irak-Feldzug. Doch auch Mandate des Sicherheitsrats brauchen eine klare zeitliche Limitierung. Dass über ein Jahrzehnt nach dem Sturz der Taliban-Herrschaft der Einsatz noch immer mit der Resolution von 2001 gerechtfertigt wurde, hat die Nato-Staaten verführt, sich vor einer klaren Bilanz zu drücken, und auf diese Weise verhindert, vorzeitig umzusteuern. Eine frühere politische Lösung hätte möglicherweise bessere Ergebnisse erzielt, als Afghanistan erneut wieder in einen eskalierenden Bürgerkrieg steuern zu lassen. So aber bleibt am Ende eine tragische Bilanz – nämlich ein Jahr Erfolg und neunzehn Jahre Scheitern, mit vor allem für die Afghan*innen verheerenden Konsequenzen.