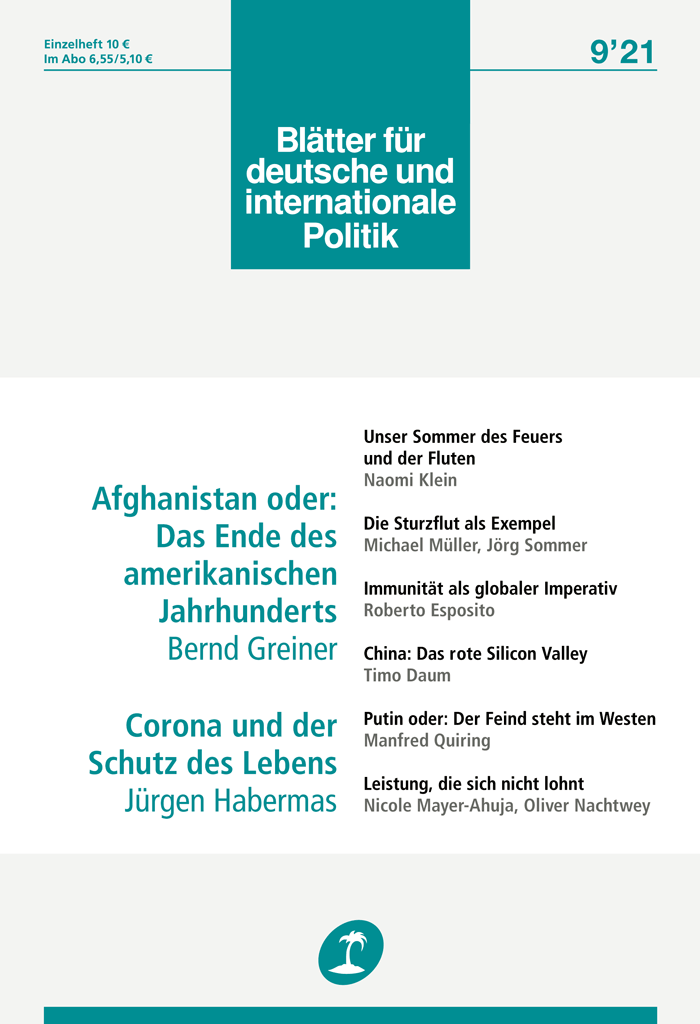Bild: Ein Kubaner mit Gesichtsmaske fährt mit dem Fahrrad in Havanna / Kuba, 12.6.2020 (IMAGO / Xinhua)
Als im Juli tausende Menschen offen gegen die sozialistische Regierung in Kuba protestierten, gingen die Bilder um die Welt. Es waren die ersten großen Demonstrationen seit Jahrzehnten. Die Regierung reagierte zunächst mit scharfer Repression und ließ hunderte Menschen verhaften. Kurz darauf sandte sie aber auch Signale wirtschaftlicher Reform.
Seitdem hat sich die Lage auf den Straßen zwar wieder beruhigt, aber die Krise hinter dem Aufbegehren ist geblieben. Denn die Situation auf der Karibikinsel ist prekär wie nie. Die Versorgung mit Lebensmitteln hat sich dramatisch verschlechtert und der politische Vertrauensverlust ist mit Händen zu greifen. Nun wütet auch noch die Corona-Pandemie in einem Maße, dass selbst Präsident Miguel Díaz-Canel einräumen musste, das vielgerühmte Gesundheitssystem werde überrannt. Solidaritätsgruppen sammeln bereits Spenden für Einmalspritzen und Schutzkleidung, Russland schickt Militärflugzeuge mit Lebensmittelkonserven, und selbst die USA genehmigen nun zehn Flüge pro Woche, die Hilfspakete der Auslandskubaner für ihre Familien auf die Insel bringen.
Verschleppte Reformen
Wie kann es nun weitergehen? Da die Organisation der täglichen Mahlzeiten das drängendste Problem der Bevölkerung ist, sollen nun bessere Preise für Bauern und Genossenschaften die heimische Nahrungsmittelproduktion steigern. Bislang diktieren die staatlichen Ankaufstellen den Produzenten, was sie abzuliefern haben, und halten die Preise dafür so niedrig, dass sie oft nicht einmal die Produktionskosten decken. Dies zu ändern steht seit langem auf der Reformagenda, die Ex-Präsident Raúl Castro vor nunmehr 15 Jahren skizziert hatte, als er die Amtsgeschäfte von seinem erkrankten Bruder Fidel übernahm.
Damals hatte Raúl Castro den Kubanern erklärt, der Sozialismus sei ohne Reformen nicht zu retten. Nur verwirklicht wurde davon in seiner Amtszeit wenig. Und nach den Unruhen vom Juli wirken die jüngsten Schritte – die vor drei oder vier Jahren noch Ausdruck einer graduellen, aber doch grundsätzlich angelegten Reformstrategie gewesen wären – vor allem wie aus der Not geborene Ad-hoc-Maßnahmen mit ungewissem Ausgang.
Noch Anfang des Jahres hatte die Regierung Obergrenzen für die Preise auf den Agrarmärkten festgelegt, um die Inflation im Zaum zu halten. Nun wurden diese Obergrenzen wieder aufgehoben – auf den Märkten gab es fast nichts mehr, was die Produzenten zu diesen Preisen verkaufen wollten. Doch womit der Staat höhere Ankaufspreise bezahlen soll, ohne die Inflationsspirale weiterzudrehen, weiß niemand. Denn über Ressourcen verfügt der Staat kaum noch. Mit der Corona-Pandemie ist der Tourismus kollabiert, der wichtigste Wirtschaftszweig der Insel; Donald Trumps Verschärfung der US-Sanktionen hat die Geldsendungen der in den USA lebenden Kubaner an ihre Verwandten auf der Insel gekappt; die großen, für Kuba höchst lukrativen Ärzte-Entsendungsprogramme nach Brasilien und Ecuador wurden nach der Abwahl der dortigen Linksregierungen beendet; der Verbündete Venezuela steckt tief in seinen eigenen Schwierigkeiten; und die einheimische Wirtschaft befand sich schon vor Corona in einer schweren Krise, nicht zuletzt, weil viele der von Raúl Castro auf die Agenda gesetzten Reformen nie umgesetzt wurden. Immer wieder wurden sie aufgeschoben, in der Hoffnung auf bessere Umstände. Nun muss die Regierung sie unter den denkbar schlechtesten Bedingungen angehen.
Das gilt etwa für die Währungsreform von Anfang des Jahres. Diese hat zwar den an den Dollar gebundenen „Konvertiblen Peso“ abgeschafft und den normalen kubanischen Peso wieder zur einzigen nationalen Währung gemacht – aber zum Preis einer offenen Dollarisierung weiter Teile der staatlichen Verkaufsstellen. Dort können die Kubaner nicht mehr mit den Pesos bezahlen, die sie als Gehalt bekommen, sondern nur mit in Dollar oder Euro denominierten Debit-Karten. Diese vom sozialistischen Staat betriebene Dollarisierung hat zu großer Verbitterung bei jenen geführt, die keine Verwandten im Ausland haben, die ihnen allmonatlich ein Devisenkonto auffüllen. Die soziale Ungleichheit ist in anderen Ländern Lateinamerikas sicherlich weit dramatischer als in Kuba. Aber sie trifft eine sozialistische Regierung, die sich als Garant sozialer Gerechtigkeit legitimiert, politisch ungleich härter.
Die Legalisierung von Privatunternehmen
Zu den Reformen zählt auch die Legalisierung von kleinen und mittleren Privatunternehmen, die die Regierung Anfang August verkündet hat. Dies ist im Prinzip ein wirklich bedeutender Reformschritt. Auch dieser stand seit langem auf der Reformagenda, und genauso lange wurde er immer wieder vertagt. Den kleinen Privatsektor, dessen sichtbarste Spitzen Bed & Breakfasts und Restaurants für Touristen waren, ließ man lieber weiter unter dem Etikett von cuentapropistas, „Arbeitern auf eigene Rechnung“, laufen. Ideologisch blieb man damit sauber – indem man weiter von Arbeitern sprach, anstatt Unternehmer zu schaffen –, aber ökonomisch war dies eine waghalsige Rechtskonstruktion, die eher zum Kleinhalten des Privatsektors taugte denn zur Entfaltung wirtschaftlicher Dynamik.
Nun also sollen die cuentapropistas tatsächlich Unternehmensform erhalten, bis zu 100 Angestellte seien möglich. Was davon in der Praxis umgesetzt wird, kann der Staat mit Vorschriften und mehr oder weniger restriktiver Lizenzvergabe drosseln oder fördern. Noch kurz vor den Unruhen hatten die Abendnachrichten mit großer Aufmachung die Razzia gegen einen Käsehersteller gefeiert, der zahlreicher illegaler Aktivitäten überführt und revolutionär dichtgemacht worden war. Nun also wäre ein solcher Betrieb als kreativer Unternehmer zu sehen, dem der Staat verlässliche Bedingungen für eine gesetzeskonforme Produktion zu schaffen hat. Dies aber setzt einen Mentalitätswandel voraus, der über die Verabschiedung eines Gesetzes hinausgeht und an den zu glauben vielen Kubanerinnen und Kubanern schwerfällt.
Zudem geht es bei alldem nicht nur um Privatpersonen. Auch kleine und mittlere Staatsbetriebe sollen nun Unternehmen werden. Sprich: Sie müssen entweder rentabel werden, sich in Genossenschaften oder Privatbetriebe verwandeln oder aber schließen. Den Beginn sollen die staatlichen Restaurants und Cafeterien machen, deren chronisches Defizit der Staat nicht länger subventionieren kann. Damit aber drohen Entlassungen. Aufgefangen werden könnten diese nur, wenn der nichtstaatliche Sektor entsprechend neue Beschäftigungsmöglichkeiten böte. In der Boom-Zeit der späten Obama-Jahre hätte dies gut funktionieren können, als Reisende aus den Vereinigten Staaten und Auslandskubaner wie nie zuvor ins Land strömten und viele auf der Insel in der einen oder anderen Weise am neuen Dollarsegen teilhatten. Es gab, ökonomisch gesprochen, eine „kaufkräftige Nachfrage“. Aber heute, wo niemand Geld hat, Zutaten und Vorprodukte kaum zu beschaffen sind und harte Corona-Restriktionen das Land lahmlegen – wer soll da mit Schwung in sein neues Leben als Kleinunternehmer starten und Dutzende von Mitarbeitern einstellen?
Hoffnungsschimmer Impfstoffproduktion?
Einen Hoffnungsschimmer bietet immerhin die Impfkampagne. Kubas Biotech-Sektor hat es tatsächlich geschafft, in Eigenproduktion zwei wirksame Corona-Impfstoffe zu entwickeln – zweifellos eine beeindruckende Leistung. Reiche Länder wie Frankreich oder Japan waren dazu nicht in der Lage, auch viele milliardenschwere Pharmakonzerne des Westens nicht. Seit Mai wird auf der Insel nun massiv geimpft, bislang sind zwölf Millionen Impfdosen verabreicht worden, bei einer Bevölkerung von elf Millionen Menschen. (Allerdings verlangen Kubas Impfstoffe für eine vollständige Immunisierung drei statt zwei Impfungen.) Doch die Produktion geht viel langsamer voran als geplant, und in der Folge stockt auch die Impfkampagne.
Zudem wurde ein folgenschwerer Fehler gemacht. Nach der Impfung des Gesundheitspersonals und anderer prioritärer Gruppen konzentrierte man sich auf die Hauptstadt Havanna. Aber zugleich öffnete man den Strandort Varadero für Touristen aus Russland, ohne die dort Beschäftigten zuvor geimpft zu haben. In der Folge schwappte hier die Delta-Variante mit einer Wucht ins Land, die die Inzidenzrate nach oben schnellen ließ und sie zur derzeit höchsten in ganz Lateinamerika machte. Die Krankenhäuser sind überlastet, und auch die Schwächen des kubanischen Gesundheitssystems treten in der Pandemie nur allzu deutlich zu Tage. Zwar verfügt Kuba über mehr Ärzte pro Kopf als irgendein anderes Land, aber bei Medikamenten und Equipment fehlt es an allem. Dramatisch unterstrichen wird dies durch den Ausfall von Kubas größter Fabrik zur Produktion von Sauerstoff, die just dann ihren Geist aufgab, als die Zahl der Intensivpatienten auf einen Höchststand kletterte.
Wo bereits flächendeckend geimpft wurde, wie in Havanna, ist die Covid-19-Inzidenz tatsächlich erheblich niedriger als in den anderen Provinzen, was die grundsätzliche Wirksamkeit der kubanischen Impfstoffe in der Praxis bestätigt. Aber die Vorstellung, dass die Epidemie bis Herbst besiegt ist und man den Tourismus zur Wintersaison wieder voll hochfahren kann, scheint in weite Ferne gerückt – ganz zu schweigen von der Hoffnung, durch den Export von Impfstoffen schon bald üppig sprudelnde Einnahmen generieren zu können. Mittelfristig hat dies sicherlich Potential, und der Iran hat bereits eine Lizenz-Produktion des kubanischen Impfstoffs angekündigt. Aber die aktuelle Wirtschaftskrise kann nicht durch das Vakzin, sondern nur durch eine breit angelegte Wiederbelebung der gesamten kubanischen Ökonomie überwunden werden.
Zu Recht ist angemerkt worden, dass die Unruhen vom Juli primär eine Folge der materiellen Nöte waren. Aber sie waren auch Ausdruck des politischen Vertrauensverlusts in die Fähigkeit der Regierung, diese materielle Krise zu lösen. Reformversprechen gibt es seit 15 Jahren, doch die Situation ist schlimmer denn je. Natürlich ist dies auch eine Folge der US-Embargopolitik, die seit mehr als sechs Jahrzehnten genau dies erreichen will und die von Barack Obama nur in Teilen gelockert und unter Trump dann wieder massiv verschärft wurde. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass der kubanische Sozialismus seinen Bürgern stets das Versprechen machte, dass man dem Imperialismus die Stirn bieten kann und trotzdem – oder: genau deswegen – einer leuchtenden Zukunft entgegensieht. Ein Leben voller Entbehrungen, nur um in den Geschichtsbüchern auf der richtigen Seite zu stehen, das wäre auch in Kuba niemals mehrheitsfähig gewesen.
Das erklärt auch, warum so viele in Kuba zwar die Blockadepolitik der USA aus ganzem Herzen ablehnen, es aber trotzdem nicht mehr hören können, wenn ihnen damit die so prekär gewordene Gegenwart erklärt wird. Raúl Castro hat dies im Grunde verstanden und reimte Revolution nicht mehr auf Opferbereitschaft, sondern versprach vielmehr einen „socialismo próspero“, einen „Sozialismus mit Wohlstand“. Einlösen konnte er dieses Versprechen jedoch nie.
Das unmögliche Erbe der »historischen Generation«
Die „historische Generation“ der kubanischen Revolution hinterlässt ihren Nachfolgern somit ein fast unmögliches Erbe. Staatspräsident Díaz-Canel und die Kader um ihn haben nun die Reformen durchzuführen, deren Notwendigkeit Raúl und Co. zwar diagnostiziert, deren Umsetzung sie aber aufgeschoben haben. Gleichzeitig hat die alte Garde die Amtsübergabe so eng kontrolliert, dass ihre Nachfolger blass und machtlos wirken müssen. Das alles überragende Motiv der alten Führung dabei war, die Kohäsion der Elite zu wahren. Übersetzt hieß das: jemanden auszuwählen, der niemandem gefährlich werden könnte und der über keine eigenen, vom Apparat unabhängigen Machtressourcen verfügt – wozu auch persönliche Popularität in der Bevölkerung zählen würde.
So ist der von Raúl Castro handverlesen an die Spitze von Staat und Partei beförderte Díaz-Canel ein stets loyaler Parteiarbeiter, der vor seinem Aufstieg nie groß in der Öffentlichkeit auffällig geworden ist und der wie verlangt alle Stationen der Karriere absolviert hat. Die Wahl Díaz-Canels fungierte dabei auch als role modelfür andere Partei-Kader. Die Voraussetzung für politischen Aufstieg – so lautet die damit einhergehende Botschaft – ist der Verzicht auf ein wahrnehmbares eigenes Profil.
Im Ergebnis aber wird Díaz-Canel von der Bevölkerung auch kaum anders denn als Verkörperung des Apparats wahrgenommen. Formal mag er die höchsten Ämter in Staat und Partei innehaben; aber er erscheint kaum als derjenige, der die Macht in den Händen hält, sondern allenfalls als einer, der die Machtverhältnisse moderiert. In seiner hilflos anmutenden Rolle bei den jüngsten Unruhen schien diese Schwäche deutlich auf.
Auch wenn die Regierung jeden Zusammenhang dementiert: Die Proteste haben politisch Wirkung gezeigt. Die eilig auf den Tisch gebrachten Reformankündigungen machen deutlich, dass auch die Staatsführung die Dringlichkeit wirtschaftspolitischer Veränderungen sieht. Doch die Unruhen und die Diskussionen in ihrer Folge haben auch gezeigt, wie tief die Risse in der kubanischen Gesellschaft inzwischen gehen.
Will die Regierung sich nicht auch in Zukunft auf die Holzknüppel und Metallstangen ihrer Sicherheitskräfte verlassen, ist – ungeachtet aller wirtschaftlichen Fragen – auch eine politische Öffnung hin zu einer Gesellschaft jenseits der eingefahrenen Kanäle unter Obhut der Kommunistischen Partei dringend nötig. Doch dass die Regierung dazu bereit ist, hat sie bislang nicht signalisiert. Ganz im Gegenteil: Mitte August erließ sie ein neues Gesetz, dessen weit auslegbare Gummi-Paragraphen regierungskritische Meinungsäußerungen in den sozialen Medien unter Strafe stellen.