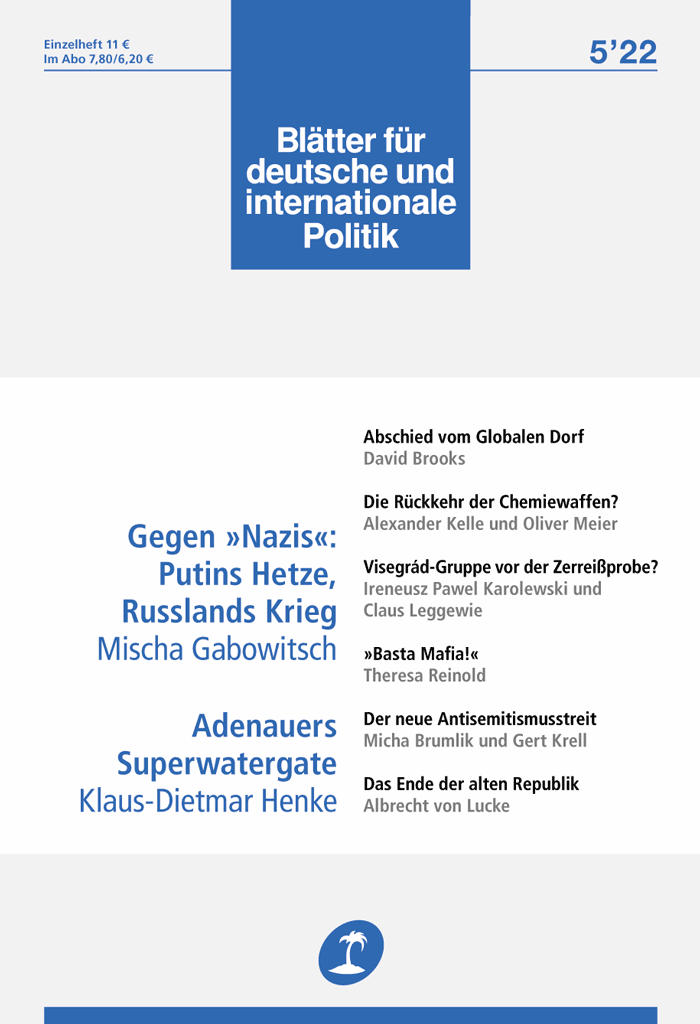Bild: Der israelische Außenminister Yair Lapid (links) empfängt den bahrainischen Außenminister Abdullatif bin Rashid Al Zayani in Sde Boker in der südisraelischen Negev-Wüste, 27.3.2022 (IMAGO / Xinhua)
Vierzehn Tote bei vier Anschlägen in 15 Tagen hat es in Israel seit vielen Jahren nicht mehr gegeben. Bei Beobachter*innen und Betroffenen weckt der Terror daher auch Erinnerungen an die Zeit der Zweiten Intifada. Sie begrub jene Hoffnung auf einen palästinensischen Staat, welche die Abkommen von Oslo vor dreißig Jahren genährt hatten. Dass die Amokläufe in Be‘er Sheva und Hadera Ende März zunächst an der Peripherie des Landes stattfanden und ein Attentäter erst im April in Tel Aviv zuschlug, nährt die Sorge, dass ein Ende der Eskalation noch nicht erreicht ist. Dafür sprechen auch die Raketenangriffe der Hamas aus dem Gazastreifen zu Beginn des Pessachfestes Mitte April, auf welche die israelische Armee mit Luftangriffen reagierte.
Die Frage, ob eine Dritte Intifada bevorstehe, beschäftigt Medien, Politikwissenschaft und Diplomatie seit mehr als zehn Jahren. Bislang ist diese ausgeblieben, was vielleicht daran liegt, dass eigentlich zwei Aufstände unter dem Pflaster schlummern. Der eine ist jener von Millionen Palästinenser*innen gegen ihre eigenen Herrscher: die dysfunktionale Palästinensische Autonomiebehörde (PA), die maßgeblich für gravierende Demokratiedefizite in den von ihr kontrollierten Gebieten verantwortlich ist. Die Generation, die dagegen aufbegehrt, kam nach den Oslo-Abkommen auf die Welt, die in den Jahren 1993 und 1995 unterzeichnet worden waren.