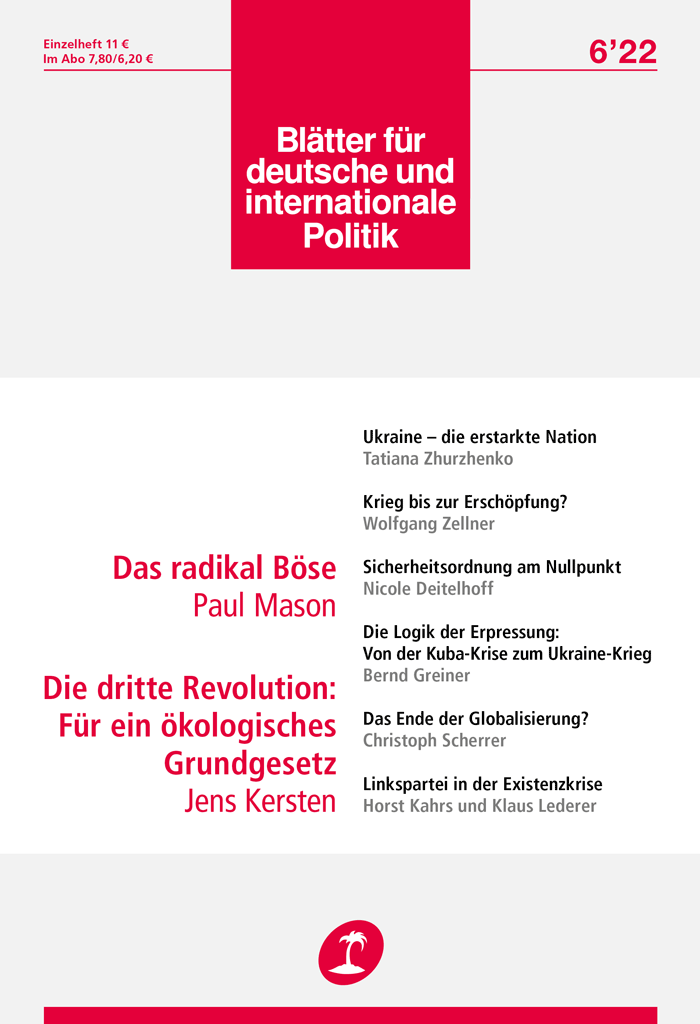Bild: U-Bahn-Station in Stuttgart (IMAGO / Lichtgut)
Die Tourismus-Verantwortlichen der Nordseeinsel Sylt blicken schon jetzt mit Sorge auf die nächsten drei Monate: Weil im Juni, Juli und August der öffentliche Nahverkehr einschließlich der Regionalzüge bundesweit für monatlich nur 9 Euro genutzt werden kann, fürchten sie einen Ansturm auf die Insel. Die geringen Kosten für die Anreise könnten massenhaft Urlauber*innen mit schmalem Budget anlocken, so die Angst – und die gutbetuchte Stammkundschaft stören. Das Unbehagen der Sylter Tourismusbranche, die offenbar um den Distinktionsgewinn ihrer Feriengäste fürchtet, wirkt blasiert. Und doch weisen die Sylter Sorgen auf ein tatsächliches Problem hin: Regionalzüge zu attraktiven Zielen werden bis September sehr voll, in den Hauptreisezeiten wahrscheinlich komplett überfüllt sein. Schon im Normalbetrieb sind die Kapazitäten im öffentlichen Verkehr in Deutschland vielfach völlig überlastet. Auf besondere Angebote wie das 9-Euro-Ticket, das viel mehr Menschen als gewöhnlich zum Nutzen des ÖPNV animieren dürfte, sind sie ganz und gar nicht ausgerichtet.
Trotzdem: Für die Verkehrswende, weg vom individuellen Autoverkehr hin zu kollektiven Formen der Mobilität, ist die Aktion eine große Chance, denn etliche Bus- und Bahnskeptiker*innen werden den Nahverkehr einfach mal ausprobieren. Das Projekt hat aber auch erhebliche Untiefen, denn es kann gut passieren, dass notorische Autofahrende sich in ihren Vorurteilen über den schlechten ÖPNV bestätigt sehen, wenn sie lange Strecken stehend im Zug oder Bus verbringen müssen, oder wenn wegen des großen Andrangs die Fahrpläne völlig aus dem Takt geraten.
Das günstige Monatsticket ist Teil jenes Pakets, mit dem die Ampel-Parteien die Bürger*innen angesichts steigender Energie- und Lebensmittelpreise entlasten wollen. Damit nicht nur Autofahrende in den Genuss staatlicher Unterstützung kommen, haben die Grünen dieses Projekt überraschend in das Paket hineinverhandelt. Diese Kurzfristigkeit erklärt auch, warum es die Parteien im Vorfeld nicht geschafft haben, Einschätzungen der Landesverkehrsminister oder der Verkehrsunternehmen einzuholen. Zum Glück, denn Warnungen vor dem hohen technischen Aufwand hätten das Projekt wohl im Keim erstickt. Die vorübergehende Einführung der Fahrkarte ist für die rund 450 ÖPNV-Unternehmen und rund 60 Verkehrsverbünde in Deutschland eine aufwendige Sache. Tarifänderungen sind komplex, zig Gremien müssen zustimmen, und das Umprogrammieren von Fahrkartenautomaten und Fahrkarten-Apps dauert Wochen. Gelten soll das 9-Euro-Ticket jeweils für einen Kalendermonat, und zwar nicht nur in einzelnen Tarifzonen, sondern bundesweit in Bussen und Bahnen, außer im Fernverkehr. Ein wichtiges Detail: Kund*innen mit einer Monats- oder Jahreskarte bekommen den Differenzbetrag als „Treuebonus“ erstattet, um sie nicht zu benachteiligen. Neben der ökologischen hat das 9-Euro-Ticket damit vor allem auch eine soziale Komponente: Gerade für Bürger*innen mit geringem Verdienst, die einen vergleichsweise höheren Anteil ihres Einkommens für Mobilität ausgeben als Wohlhabende, ist es enorm attraktiv.
Genau das aber könnte zum Problem werden. „Endet das Vorhaben im Chaos?“, fragt der Deutsche Bahnkunden-Verband, der die Aktion eigentlich für eine gute Idee hält, aber wegen der geringen Vorbereitungszeit für eine Verschiebung plädierte. Der Verband kritisiert auch, dass eine wissenschaftliche Begleitung bislang nicht vorgesehen ist – das ist in der Tat ein Versäumnis. Denn damit vergibt der Bund die Chance, bei diesem einzigartigen Feldversuch weiterführende Daten über das Nutzungsverhalten der potentiellen Kund*innen zu bekommen. Deren Bedürfnisse und Gewohnheiten zu kennen, ist für den Ausbau des ÖPNV aber enorm wichtig. Auch wenn noch ungewiss ist, wie viele Menschen das Ticket am Ende tatsächlich nutzen werden, wird zu Recht erwartet, dass es auf etlichen Strecken mehr sein werden, als es die jetzigen Kapazitäten hergeben. Das ist keineswegs eine triviale Feststellung. Denn das würde bedeuten, dass der Bedarf an einem besseren ÖPNV bei einem preislich attraktiven Angebot sehr hoch ist. Die Bereitschaft zum Umstieg vom Pkw auf Bus oder Bahn scheint jedenfalls heute weitaus größer zu sein, als die Bundesverkehrsminister der vergangenen 20 Jahre mit ihrer Autozentriertheit glauben machen wollten – wenn denn das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt. Und genau das ist aktuell nicht der Fall.
Insofern hat die Bundesregierung mit dem 9-Euro-Ticket eines bereits vor dem Start erreicht: Die Aktion hat eine Diskussion über den Zustand des ÖPNV, seine Finanzierung und mögliche Anschlussaktionen zur Kundenbindung in Gang gesetzt. Das ist weitaus wichtiger als die Frage, ab welchen Fahrgastzahlen das Projekt in den jeweiligen Regionen als Erfolg betrachtet werden kann. Wie schlecht es gegenwärtig um den ÖPNV steht, zeigen bereits die Schwierigkeiten, der durch das 9-Euro-Ticket steigenden Nachfrage zu begegnen.
Keine Züge, kein Personal
Dass die Verkehrsunternehmen einfach mehr Fahrzeuge einsetzen und Takte verdichten, um diese zu bedienen, dürfte schon am fehlenden Personal scheitern. Bereits im Normalbetrieb haben etliche Verkehrsunternehmen zu wenig Fahrer*innen und auch die Zahl der Busse und Bahnen ist begrenzt. Die deutschen Verkehrsbetriebe sind daher dazu gezwungen, äußerst knapp zu kalkulieren. Sie haben schlicht keine großen Reserven, die sie jetzt mobilisieren könnten. Zu den strukturellen Problemen kommen die Folgen der Coronakrise. Durch die Pandemie sind die Fahrgastzahlen und damit die Einnahmen erheblich eingebrochen, noch immer ist die Auslastung geringer als vor Corona – was sich durch das 9-Euro-Ticket allerdings ändern dürfte. Auch wenn die Verkehrsunternehmen erhebliche Corona-Hilfen bekommen haben, sehen sie sich ebensowenig wie die Länder dazu in der Lage, jetzt zusätzliche Mittel aufzubringen, um etwa die Dienste privater Busunternehmen einzukaufen.
Da die Initiative für das 9-Euro-Ticket von den Koalitionspartnern der Bundesregierung ausgeht und die Länder überhaupt nicht in die Planungen einbezogen wurden, ist es nur folgerichtig, dass der Bund für die Kosten aufkommt. Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) hat entsprechend zugesagt, die Einnahmeausfälle zu übernehmen. Dennoch ist zwischen den Ländern und Wissing ein heftiger Streit über die Finanzierung entbrannt. Die durch das 9-Euro-Ticket verursachten Einnahmeausfälle werden nach Schätzung der Verkehrsunternehmen über drei Mrd. Euro betragen. Sie leiten das aus den Gesamteinnahmen des letzten Vor-Corona-Jahres 2019 ab, als sie insgesamt rund 13 Mrd. Euro einnahmen. Wissing will der Branche aber nur 2,5 Mrd. Euro geben, weil er Coronahilfen mit den Mitteln für das 9-Euro-Ticket verrechnet. Das ärgert die Länder, die weitere 1,5 Mrd. Euro fordern, damit sie auch die Ausgaben für dichtere Takte oder zusätzliche Züge sowie steigende Personal- und Energiekosten decken können.
Wie nahezu alle Nahverkehrsbranchen auf der Welt kommt auch die deutsche nicht ohne Subventionen aus. 2019 bezuschussten der Bund, die Länder und die Kommunen den Betrieb des ÖPNV mit rund elf Mrd. Euro. Der Bund fördert ihn darüber hinaus auf vielen verschiedenen Wegen, etwa mit den sogenannten Regionalisierungsmitteln, mit der Finanzierung von Modellvorhaben oder Steuervergünstigungen. Der Bundesrechnungshof hat einen regelrechten „Förderdschungel“ ausgemacht und behauptet in einem Bericht vom Februar dieses Jahres, der Bund wüsste gar nicht, mit wie vielen Mitteln er den ÖPNV finanziert. Tatsächlich gibt es keine konsistente Förderstrategie des Bundes. Doch darauf mit der Verweigerung von Mitteln zu reagieren, wie es der Bundesverkehrsminister momentan tut, führt zu erheblichen Problemen.
Falls nicht mehr Geld vom Bund kommt, warnen die Landesverkehrsminister*innen für die Zeit nach Auslaufen des 9-Euro-Tickets ab September vor Tariferhöhungen auf breiter Front. Das aber wäre fatal, denn es würde die möglichen positiven Wirkungen des 9-Euro-Tickets für die Verkehrswende in ihr Gegenteil verkehren. Auch wenn der ÖPNV im Vergleich zur Anschaffung und zum Unterhalt eines Autos schon jetzt günstig ist – die meisten Kund*innen nehmen das anders wahr. Sie setzen nur Spritkosten und Ticketpreise ins Verhältnis zueinander. Anschaffung, Reparaturen, Steuern, Versicherung oder Parkgebühren werden von Autohalter*innen oft nicht als Mobilitätskosten begriffen. Und lange kannten die Tarife im ÖPNV nur eine Richtung: nach oben. In den vergangenen 20 Jahren sind die Preise im Nahverkehr doppelt so stark gestiegen wie die Unterhaltungskosten für einen Pkw. Das 9-Euro-Ticket durchbricht diesen Trend erstmals – wenn auch zeitlich befristet. Es könnte damit den Auftakt für eine Welle neuer, kluger Preismodelle bilden. Schon jetzt arbeiten die Verantwortlichen in vielen Verkehrsunternehmen an Angeboten, um neue Kund*innen zu binden. Aber das wird nur gelingen, wenn für solche Vorhaben genug Geld zur Verfügung steht.
So gut wie kein ÖPNV auf dem Land
Hinzu kommt: Das günstigste Ticket nützt nichts, wenn überhaupt keine oder kaum Busse und Bahnen fahren. Viele Orte auf dem Land sind quasi vom ÖPNV abgehängt, daran ändert auch das 9-Euro-Ticket nichts. Das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung geht davon aus, dass ein Fußweg von acht bis zehn Minuten – das entspricht 600 Metern – zur nächsten Haltestelle zumutbar ist, bei Bahnhöfen sind es 1200 Meter. In den Stadtstaaten Berlin, Bremen und Hamburg ist das für 99 Prozent der Bürger*innen der Fall, zeigt ein Ranking des Instituts für das Bündnis „Allianz pro Schiene“.[1] Für diese Bürger*innen ist das 9-Euro-Ticket ein Gewinn, für viele in Mecklenburg-Vorpommern hingegen nicht. Dort ist der Weg zur nächsten Haltestelle oder zum Bahnhof für mehr als jede fünfte Person nach der Definition des Instituts nicht zumutbar, in Bayern sieht es ähnlich aus. Jede*r, der oder die jemals in einem Flächenland mit öffentlichen Verkehrsmitteln jenseits großer Städte unterwegs gewesen ist, weiß, dass das in der Regel zeitaufwendig und unbequem ist. Ein flächendeckendes ÖPNV-Netz existiert schlicht nicht. Für etliche Landbewohner*innen mag die Fahrt zur Haltestelle oder zum Bahnhof mit dem Fahrrad oder dem Auto durchaus möglich sein. Aber für Hochbetagte oder Menschen mit Handicap ist es das nicht. Für diese Gruppe ist der Zugang zum ÖPNV ohnehin schwierig, denn von einer flächendeckenden Barrierefreiheit kann keine Rede sein – obwohl die Bundesrepublik die Behindertenrechtskonvention ratifiziert hat, der zufolge der ÖPNV bis zum 1. Januar dieses Jahres hätte barrierefrei sein müssen. Doch großzügige Übergangsregelungen haben es den Kommunen erlaubt, die Umsetzung zu verschleppen. Immerhin: Die Ampelregierung hat sich im Koalitionsvertrag das Ziel gesetzt, die Barrierefreiheit im ÖPNV bis 2026 ohne Ausnahme umzusetzen.
Und auch die Bereitschaft für neue, kreative Lösungen ist gestiegen. Mit sogenannten Ruf-Bussen versuchen manche Kommunen und Länder bedarfsgerechte Angebote jenseits festgelegter Linien zu schaffen. Dabei fahren mehrere Fahrgäste mit unterschiedlichen Zielen in einem Fahrzeug, das per App gerufen wird. Bundesweit gibt es rund 40 Projekte, nicht nur im ländlichen Raum. In Großstädten sind Ruf-Busse dazu geeignet, die Lücke zu schließen, die der ÖPNV etwa nachts lässt. Der Preis liegt in der Regel über dem eines Tickets, aber unter den Taxi-Tarifen. Solche Angebote müssen ausgebaut werden, um mehr Menschen an den ÖPNV anzuschließen. Ob diese Projekte auch in das 9-Euro-Ticket eingebunden werden, wird davon abhängen, wie sie generell in den Verkehrsverbünden vor Ort verankert sein werden.
Nachdem der öffentliche Nahverkehr in den Flächenländern über Jahrzehnte ausgedünnt worden ist, gibt es heute mittlerweile wenigstens den erklärten politischen Willen, Verbindungen auszubauen. In keiner Sonntagsrede von Politiker*innen über das Klima oder Mobilität fehlt die Forderung nach einem Ausbau – und das seit Jahren. Doch bislang schreitet dieser nur langsam voran. Dabei sind die verkehrspolitischen Ziele von Bund und Ländern durchaus ehrgeizig. Die Zahl der Fahrgäste im öffentlichen Nahverkehr soll sich bis 2030 im Vergleich zum Jahr 2019 verdoppeln. Einer Studie der linksparteinahen Rosa-Luxemburg-Stiftung zufolge müssten dafür jedes Jahr zusätzlich zu den bestehenden Mitteln acht Mrd. Euro in den Ausbau des ÖPNV fließen, weitere vier Mrd. Euro müssten jährlich für zusätzliches Personal hinzukommen. Vor diesem Hintergrund plädieren die Studienautor*innen dafür, neue Finanzierungsquellen zu erschließen. Beispiele aus der europäischen Nachbarschaft zeigen, welche Möglichkeiten es gibt. So ist der öffentliche Nahverkehr in Luxemburg kostenlos nutzbar, finanziert wird das aus Steuermitteln. In Frankreich gibt es mehr als 30 Städte, in denen Bürger*innen ganz oder zeitweise kostenlos Busse und Bahnen nutzen können, etwa an den Wochenenden in Clermont-Ferrand oder dauerhaft im südfranzösischen Aubagne. Französische Kommunen können dafür von Unternehmen eine Nahverkehrsabgabe erheben. In Wien gibt es bereits seit 1970 eine Arbeitgeberabgabe von zwei Euro pro Beschäftigten und Woche, die in den ÖPNV fließt. Dies gilt ebenso etwa für Parkgebühren von Autofahrenden. Die Verkehrsbetriebe in der österreichischen Hauptstadt hatten deshalb genug Mittel, um 2012 das 365-Euro-Jahresticket einzuführen.
Immmerhin nimmt durch das 9-Euro-Monatsticket nun auch hierzulande die Diskussion über ein Ticket für einen Euro am Tag an Fahrt auf. Die Deutsche Umwelthilfe fordert dessen bundesweite Einführung ab September. Das wäre in der Tat ein guter Auftakt für die versprochene Verkehrswende. Doch um diese tatsächlich in Gänze durchzusetzen, wird noch weit mehr gesellschaftlicher Druck erforderlich sein.
[1] Bayern und Mecklenburg sind Schlusslichter bei der Erreichbarkeit von Bus und Bahn, wwww.allianz-pro-schiene.de, 18.8.2021.