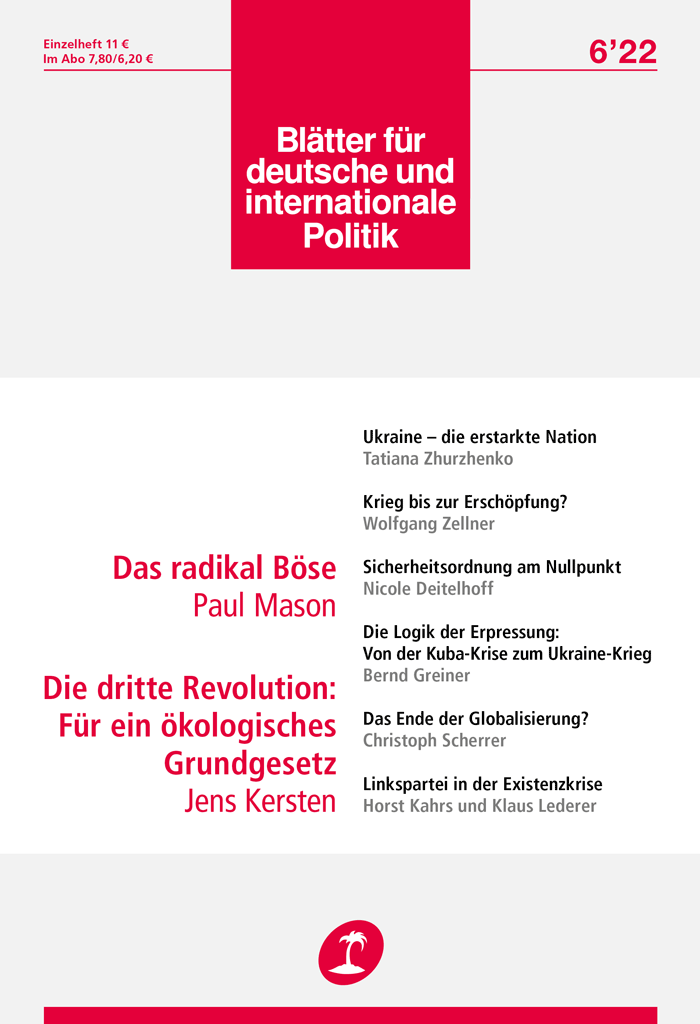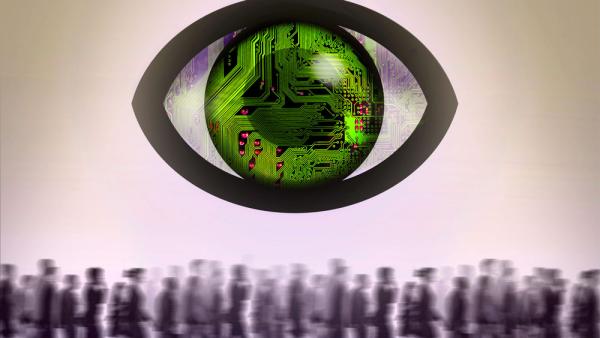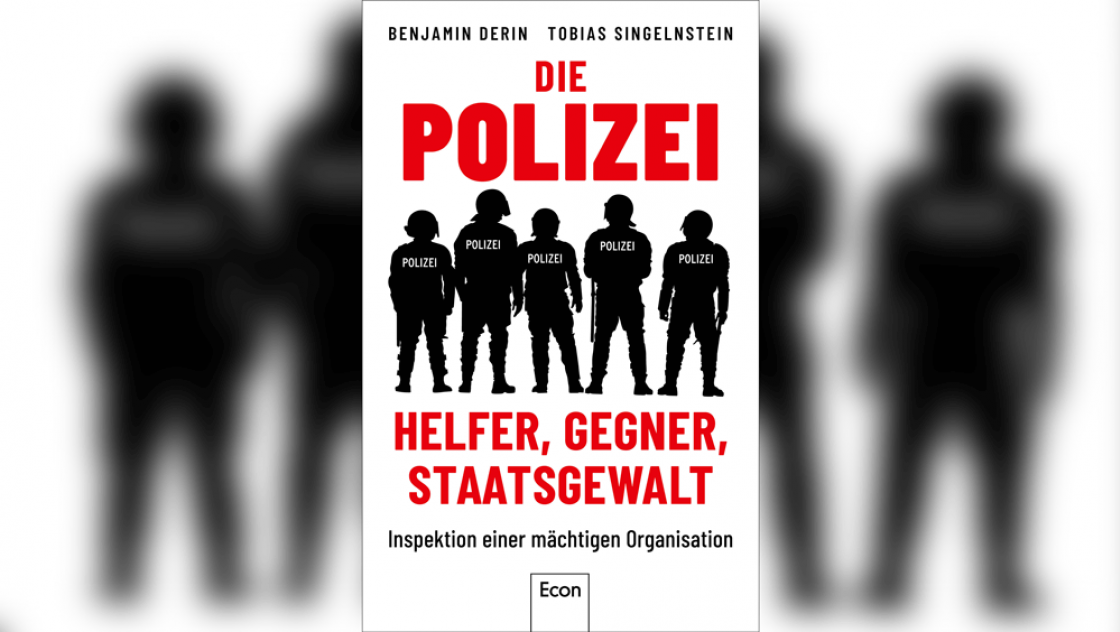
Bild: Econ Verlag
Trotz Gewaltexzessen, Rassismus oder rechtsextremen Neigungen: Das Vertrauen der meisten Deutschen in ihre Polizei ist groß. Dem „Roland Rechtsreport“ vom Februar 2022 zufolge genießen nur kleine und mittlere Unternehmen höhere Zustimmungswerte. In den Lokalnachrichten dominiert entsprechend das Bild des netten Wachtmeisters. Polizist*innen fischen Geldbeutel aus der Kanalisation, bringen entlaufene Katzen zurück und sorgen für unfallfreies Fahren, wenn an einer Kreuzung die Ampelanlage ausgefallen ist.
Doch es gibt auch eine Kehrseite, die Zweifel daran weckt, ob die Organisation zu jeder Zeit auf dem Boden von Recht und Gesetz steht. So prügelten Polizeibeamte Ende Februar in München auf Demonstrierende ein, die friedlich der Opfer des rassistischen Anschlags von Hanau gedenken wollten. Im Juni 2020 demonstrierten Zehntausende unter dem Motto „Black Lives Matter“ in deutschen Städten gegen Polizeigewalt und Rassismus. Und nicht nur sie, auch der Menschenrechtskommissar des Europarats und die EU-Kommission zeigten sich in der Vergangenheit besorgt über rassistisches Verhalten oder Racial Profiling in deutschen Polizeibehörden. In zahlreichen Polizeieinheiten sind seit 2020 zudem rechte Chat-Gruppen bekannt geworden – im Juni 2021 wurde infolgedessen gar das SEK Frankfurt aufgelöst. Vor diesem Hintergrund haben der Bochumer Polizeiforscher und Kriminologe Tobias Singelnstein sowie der Berliner Strafverteidiger Benjamin Derin ein Buch vorgelegt, das die Polizei mit allen ihren Widersprüchen beleuchtet und schonungslos inspiziert.
„Die Polizei – Helfer, Gegner, Staatsgewalt“ ist eine akribische Bestandsaufnahme, die keinen Missstand in der Organisation unerwähnt lässt: Polizeigewalt, Rassismus, Diskriminierung, Sexismus, Rechtsextremismus oder auch die – alles überlagernde – ungenügende Fehlerkultur, die mit einer Cop Culture zusammenhängt, also dem eigenen ungeschriebenen Regelwerk, das innerhalb der „Polizeifamilie“ gilt. Hart ins Gericht gehen die Autoren dabei nicht nur mit der Polizei und ihren einflussreichen Gewerkschaften, die Kritik zuletzt immer öfter als unsachlichen „Polizei-Hass“ abqualifizierten und gerne das Opfer-Image der Polizei als „Prügelknabe der Nation“ hochhielten. Auch die politischen Entscheidungsträger kriegen ihr Fett weg, weil sie den Mut nicht aufbringen, Polizeiarbeit transparenter und kontrollierbarer zu machen. Obwohl Derin und Singelnstein ihre Finger in viele Wunden legen: Polizei-Bashing betreiben sie nicht. Die Missstände werden gesellschaftlich und juristisch eingeordnet, an vielen Stellen des Buches findet sich auch respektvolle Wertschätzung gegenüber der Organisation. Lobend herausgestellt wird etwa die Professionalisierung und zielgerichtete Akademisierung in den letzten Jahren. „Heute ist die deutsche Polizei nicht nur rechtsstaatlicher und demokratischer, sondern auch besser ausgebildet und personell diverser aufgestellt als früher.“
»Männlicher, weißer, deutscher und konservativer«
Aber für die Autoren gibt es eben auch nichts schönzureden: Mitnichten sei die Polizei – wie gerne behauptet wird – ein „Spiegel der Gesellschaft“. Rassismus-, Gewalt- und Verschwörungspotentiale in der Organisation dürften mit dieser Phrase nicht relativiert werden, warnen sie. „Die Polizei ist männlicher, weißer, deutscher und konservativer als der Durchschnitt.“ Studien zeigten zudem, dass fremdenfeindliche, rassistische und rechtsextreme Einstellungen in der Polizei häufiger vorkämen als in der Bevölkerung insgesamt. Rechtsextremismus sei in der deutschen Polizei zumindest kein nur vorübergehendes Problem. In welchem Ausmaß es organisierte Netzwerke gebe oder sogar erfolgreiche Bestrebungen aus der rechtsextremen Szene, Teile der Polizei zu unterwandern, könne jedoch niemand genau sagen. „Der derzeit bereits bekannte Umfang erscheint allerdings schon bedrohlich“, konstatieren die Autoren. Jedenfalls könne nicht mehr von Einzelfällen gesprochen werden: „Polizist*innen mit rechtsextremen Tendenzen oder Einstellungen leben ihre Gesinnung keineswegs nur vereinzelt für sich und im Geheimen aus. Gleichgesinnte finden sich zusammen und bilden gemeinsame Strukturen, die für Zusammenhalt sorgen und Identität stiften.“
Mit Sorge beobachten die Autoren zudem eine Nähe von Teilen der Polizei zur AfD: Diese bemühe sich mit ihrer Propaganda gezielt um Polizisten und könne dabei immer wieder auf Erfolge verweisen, wie sich etwa an der hohen Anzahl ehemaliger Polizisten zeige, die für die AfD in Bund- und Länderparlamente eingezogen seien. Unterwandert werde inzwischen auch die Polizeiausbildung: Singelnstein und Derin verweisen auf Lehrbücher, an denen Autoren des rechten Randes mitgewirkt hätten. Vor diesem Hintergrund sei fraglich, wie lange in der Polizei eine ohnehin schon durchlässige und verwischte Grenze zur extremen Rechten halten werde. „Wenn es an einer Brandmauer fehlt, die dieser Entwicklung entgegensteht, wird die Polizei langsam vergiftet.“
Wie aber lässt sich eine solche Brandmauer errichten? Ob es der Organisation künftig selbst gelingt, mit all diesen Problemen fertig zu werden, halten die Autoren für unwahrscheinlich. Es mangele an einer Fehlerkultur, in der man offen und transparent mit Kritik umgeht. „Wo es offiziell keine Fehler und Probleme geben darf, wo die Organisation als solche unfehlbar ist und wo die Cop Culture Loyalität verlangt, sehen sich viele Polizist*innen nicht in der Lage, ihren Vorgesetzten Missstände auf dem Dienstweg zu melden.“
Angesichts dessen tut nach Auffassung der Autoren eine bessere Kontrolle der Polizei dringend not. Diese scheitere jedoch immer wieder an „erheblichen Teilen der Polizei, den Gewerkschaften und bestimmten Teilen der Politik“, die sich nicht dem Vorwurf eines Generalverdachts gegenüber der Polizei würden aussetzen lassen wollen. Bestes Beispiel dafür sei die nun schon Jahrzehnte währende Diskussion um die anonymisierte Kennzeichnungspflicht. Diese in vielen Ländern übliche und vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte geforderte individuelle Kennzeichnung der Uniform von Beamt*innen soll es ermöglichen, Polizist*innen im Nachhinein zu identifizieren, um Fehlverhalten verfolgen zu können. „Eigentlich eine Selbstverständlichkeit, die wir zum Beispiel auch allen Kfz-Halter*innen zumuten“, bemerken die Autoren. Ebenso wenig komme die Einsetzung unabhängiger Polizeibeauftragter zustande, die polizeiliches Über-die-Stränge-Schlagen im Zweifel aufklären könnten.
Schließlich sorgt auch der Umgang des Gesetzgebers mit der Polizei bei den Autoren für Kopfschütteln. Anstatt diese demokratisch und rechtsstaatlich „einzuhegen“, bekäme sie immer mehr Befugnisse. So ermögliche der in Polizeigesetzen inzwischen zum Dreh- und Angelpunkt avancierte Terminus der „drohenden Gefahr“ polizeiliche Eingriffe bereits im Vorfeld potentieller krimineller Akte; die Rechtmäßigkeit solcher Einsätze lasse sich am Ende allerdings nur schwer überprüfen. Nach dieser einigermaßen ernüchternden Analyse rufen Derin und Singelnstein im Schlusskapitel zu einem „mutigen“ Abbau polizeilicher Aufgaben auf. Denn: Nicht alle gesellschaftlichen Aufgaben, die der Polizei heute zufielen, seien in ihrer Verantwortung am besten aufgehoben. Dass heute für alles und jedes die Polizei gerufen werde, hänge schlicht damit zusammen, dass kompetentere Einrichtungen nicht hinreichend ausgestattet seien: Dazu zählen etwa Anlaufstellen für soziale Arbeit, Suchtberatungen, therapeutische Einrichtungen, die Jugendarbeit oder der Bildungsbereich. Die Autoren verweisen in diesem Zusammenhang auf erfolgreiche „Defund the Police“-Modelle in den USA, wo mancherorts spezialisierte Einrichtungen statt der Polizei zu Konflikten mit psychisch kranken oder drogenabhängigen Menschen geschickt werden und dort unbewaffnet und ohne strafrechtliches Mandat Hilfe leisten. Von derartigen Lösungen erhoffen sich Derin und Singelnstein auch für Deutschland Vorteile: Entlaste man die Polizist*innen und stärke zugleich andere Institutionen, wäre „der Weg für eine demokratischere, kontrollierbarere Organisation bereitet und die mit Polizeieinsätzen einhergehenden Gefahren würden in vielen Fällen vermieden.“
Benjamin Derin und Tobias Singelnstein, Die Polizei: Helfer, Gegner, Staatsgewalt – Inspektion einer mächtigen Organisation, Econ Verlag, Berlin 2022, 446 S., 24,99 Euro.