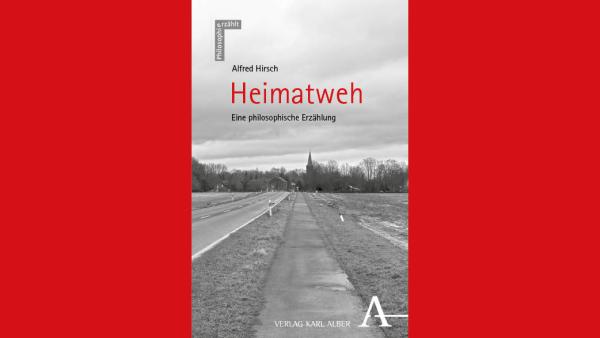Bild: Verlag C.H.Beck
Wer den heutigen Nahen und Mittleren Osten, mehr noch: die islamische Welt von Marokko bis nach – nun ob der documenta ins Gerede gekommenen – Indonesien verstehen will, kommt nicht umhin, sich mit dem politischen Islam, von manchen als „Islamismus“ bezeichnet, auseinanderzusetzen. Das aber führt in eine Zeit zurück, die von heute aus weit entfernt zu sein scheint, nämlich in die Epoche kurz nach dem Ende des Ersten Weltkrieges sowie in die südlichen und östlichen Enden des Mittelmeeres, in die Türkei und nach Ägypten. Kurz: in jene Jahre, als das Osmanische Reich seinem Ende entgegenging. Von besonderem Interesse ist in diesem Zusammenhang Ägypten. So war es schon Napoleon Bonaparte, der mit seiner Expedition dort 1798 die osmanische Herrschaft beendete. Die spätere britische Dominanz hob auch diesen französischen Herrschaftsanspruch auf, woraufhin ein albanischer Offizier die Macht über das Land übernahm – wenngleich noch immer nominell unter osmanischer Herrschaft. Nicht zuletzt des 1869 eröffneten Suezkanals wegen besetzte Großbritannien im Jahr 1882 das Land und erklärte es 1914 zu einem Protektorat, bis Ägypten 1922 ein formell eigenständiges Königreich wurde. Das waren die Zeit und der Raum, in dem der politische Islam entstand. Das neue Buch der Islamwissenschaftlerin Gudrun Krämer erklärt nun die Genese dieser politischen Ideologie anhand der Biographie ihres Gründers: eines Mannes namens Hasan al Banna, der, 1906 als Sohn eines Uhrmachers geboren, zum Begründer der Muslimbruderschaft wurde und 1949 – nach Konflikten mit der damaligen Regierung – auf offener Straße erschossen wurde, ohne dass die Täter je gefasst worden wären.
Krämers exzellente Biographie ist weitaus mehr als nur eine Lebenserzählung, sondern nicht mehr und nicht weniger als eine von verblüffender Gelehrsamkeit getragene, narrativ gehaltene Analyse einer im weitesten Sinne auf Traditionsbestände zurückgreifenden politischen Ideologie. Diese Ideologie unternahm den Versuch, religiöse Traditionen mit den nicht weltanschaulich gebundenen Strukturen einer modernen, besser gesagt: einer sich modernisierenden Gesellschaft unter Fremdherrschaft zu verbinden.
Der beruflich als Lehrer tätige Hasan al Banna gründete die Muslimbruderschaft im März 1928, er war damals gerade einmal zweiundzwanzig Jahre alt. Nach eigener Auskunft erfolgte dies als Reaktion auf gleichaltrige junge Männer, die ihm, einem charismatischen Redner, Folgendes geschrieben hatten: „Wir sind des Lebens in Erniedrigung und Gefangenschaft überdrüssig. Du siehst ja, dass die Araber und Muslime in diesem Land [Ägypten] weder Rang noch Ehre besitzen. Sie sind nichts als Angestellte, die von diesen Ausländern abhängen…“ Nicht zuletzt widmete sich die rasch wachsende Organisation der Bekämpfung christlicher Mission, und zwar dadurch, dass sie sich einer am Koran orientierten islamischen Erziehung sowie dem „Kampf gegen Unmoral“ verschrieb, worunter vor allem der Protest gegen eine vermeintlich zu freizügige, moderne Kleidung von Frauen, den Genuss alkoholischer Getränke sowie wider solche Tanzvergnügungen, bei denen Männer Frauen berührten, gemeint war. Mehr noch: Sogar die ab 1896 in Kairo verkehrenden elektrischen Straßenbahnen galten als Hort der Unmoral – ebenso wie der Umstand, dass zwischen 1870 und dem Börsencrash von 1907 mehr als 150 000 Ausländer nach Ägypten einwanderten: Griechen, Malteser und Italiener, allesamt weder Muslime noch koptische Christen.
Ein Fall von modernem Antimodernismus
Gleichwohl – soviel Moderne musste denn doch sein – gründete die Bruderschaft auch Organisationen für Mädchen und Frauen, in denen allerdings Keuschheit sowie ein traditionelles Bild von Frauen als Hausfrau und Mutter propagiert wurden. Was den Frauen und Mädchen nicht erlaubt war, wurde jedoch umso mehr für die männliche Jugend gefordert: die Ertüchtigung des Körpers durch Sport und paramilitärische Übungen. Trotz dieser moderat modernen Ansätze galt der Kampf der Bruderschaft nicht zuletzt säkularen ägyptischen Nationalisten, vor allem der Wafd-Partei, die seit der formellen Unabhängigkeit Ägyptens mehr und mehr an Einfluss und Macht gewann. Vor diesem Hintergrund erwiesen sich die Muslimbrüder nicht nur als rückwärts gewandte religiöse Reformer, sondern auch als Gruppierung, die trotz ihrer grundsätzlichen Ablehnung des Parlamentarismus politische Konzepte für den ägyptischen Staat vorweisen konnte. In einem Rundschreiben aus dem Jahr 1935 schrieb al Banna über die von ihm kritisierten Modernisten: „Durch die Nachahmung des Westens kriecht das Gift der Viper in ihr Leben, vergiftet ihr Blut und beschmutzt die Reinheit ihres Glücks. […] Geistig sind sie befallen von mörderischer Verzweiflung, tödlicher Trägheit, beschämender Feigheit, unwürdiger Unterwürfigkeit und grassierender Verweichlichung, Gemeinheit und Ichsucht, die sie an jeglicher Anstrengung hindern. […] Was kann man von einer Nation erhoffen, in der sich all diese Elemente in ihrer extremsten Form zum Angriff vereint haben – Imperialismus und Faktionalismus, Wucher und ausländische Unternehmen, Gottlosigkeit, Libertinage und Anarchie in Erziehung und Gesetzgebung, Verzweiflung und Gemeinheit, Impotenz und Feigheit, [verknüpft mit einer] Bewunderung für den Feind, die zur kompletten Nachahmung insbesondere seiner schlechten Taten einlädt.“
Angesichts dessen verwundert es nicht, dass Hasan al Banna und die Muslimbrüder nicht nur radikale Antizionisten waren und sich mit den Arabern Palästinas bis hin zu militärischer Hilfe bei deren Aufstand im Jahr 1936 solidarisch erklärten, sondern dass sie sich auch zunehmend antisemitisch gegen Ägyptens Juden wandten – obwohl sich diese mitsamt ihren rabbinischen Oberhäuptern stets gegen den Zionismus erklärten.
Im Rückblick erweist sich die Geschichte der Muslimbrüder somit als ein schlüssiger Fall einer Dialektik von modernem Antimodernismus, wozu Gudrun Krämer einen nun in der Tat mehr als nur überraschenden Beweis anführt: wurde doch im Osmanischen Reich durchaus auch westliche Literatur rezipiert und auch das nicht zuletzt in dessen arabischen Provinzen. So publizierte ein schottischer Arzt und Reformer namens Samuel Smiles – er lebte von 1812 bis 1904 – im Jahr 1859 eine Schrift mit dem Titel „Self-Help; with Illustrations of Character, Conduct and Perseverance“. Diese Schrift wurde bereits 1880 (!) in Beirut auf Arabisch publiziert und den Muslimbrüdern von Hasan al Banna empfohlen. Bei alledem weist Gudrun Krämer gleichwohl darauf hin, dass Charakterbildung und Selbstdisziplinierung schon Erziehungsideale der mittelalterlichen islamischen Philosophie waren und dass vor allem die sufische Tradition, der al Banna seit seiner Jugend anhing, neben Wissensvermittlung auch das vermittelte, was als „Herzensbildung“ bezeichnet werden kann.
Im Zweiten Weltkrieg, als die Wehrmacht unter Rommel gegen Ägypten vorrückte, verhielt sich al Banna zwiespältig: Er forderte die Einführung der Scharia in Ägypten und galt den Behörden als Risiko. Deshalb zunächst inhaftiert, wurde er jedoch bald aus der Haft entlassen, hielt aber dann massiv antizionistische Reden und nahm gleichwohl Kontakt zur britischen Botschaft auf. Dennoch kam es einige Jahre später, 1945, angesichts des „Balfourgedenktages“ am 2. November – jenes Tages, an dem Lord Balfour 1917 den Juden einen Teil Palästinas zugesprochen hatte – in Kairo und Alexandrien zu massiven antijüdischen und antichristlichen Ausschreitungen. Entsprechend erfahren wir aus Krämers Biographie, dass al Banna und andere Muslimbrüder ihren Judenhass weder rassistisch noch kulturalistisch, sondern wirtschaftlich und politisch begründeten – bedrohe doch die Dominanz von Juden angeblich das nationale Interesse.
Mit Krämers Biographie liegt eine bestens recherchierte sowie quellengesättigte Sozialgeschichte des modernen Ägyptens vor, die wie kein anderes Werk die Dialektik eines antimodernen Modernismus vor dem Hintergrund kolonialer Herrschaft bis ins letzte Detail nachzeichnet. Sie macht auch verständlicher, warum zumal die Länder des Globalen Südens nur schwerlich in der Lage sind, politische Systeme zu etablieren, die an Demokratie und Menschenrechten orientiert sind.
Gudrun Krämer, Der Architekt des Islamismus. Hasan al Banna und die Muslimbrüder. Eine Biographie. C.H. Beck, München 2022, 528 S., 34 Euro.