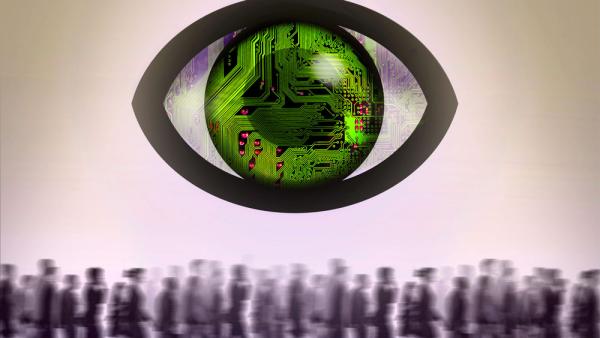Bild: SpaceX CEO Elon Musk feiert den erfolgreichen Start einer Falcon-9-Rakete, Florida, USA, 30.5.2022 (IMAGO / ZUMA Wire / Paul Hennessy)
Eugene Cernan schreibt die Initialen seiner Tochter in den Mondstaub, steigt die Treppen der Weltraumfähre hinauf und die Apollo 17 hebt ab. Für mindestens ein halbes Jahrhundert wird Cernan der letzte Mensch gewesen sein, der den Mond betreten hat. Der Wettlauf zum Mond findet damit am 14. Dezember 1972 sein endgültiges Ende – und läutet gleichzeitig auch das Ende des Space Race zwischen den USA und der Sowjetunion ein.
50 Jahre später befinden wir uns mitten in einem neuen Wettlauf ins Weltall: China plant bis spätestens zum Ende des Jahrzehnts erstmals mit eigenen Raumfahrer*innen („Taikonauten“) auf dem Mond zu landen. Und mit dem Artemis Programm unter US-amerikanischer Federführung sollen nach mehr als einem halben Jahrhundert auch wieder Menschen den Erdtrabanten betreten. Das Auffinden wertvoller Metalle und Ressourcen auf Asteroiden hat eine wahre Goldgräberstimmung im Weltraum ausgelöst, und nicht zuletzt beflügelt die Hoffnung auf bewohnbare Planeten die kolonialen Träume von Technoutopist*innen.
Bevor Cernan den Mond verließ, blickte er hoffnungsvoll in die Zukunft und sagte: „Wir gehen nun wieder und, so Gott will, werden wir zurückkehren mit Frieden und Hoffnung für die gesamte Menschheit.“ Angesichts des neuen Wettlaufs ist die baldige Rückkehr zum Mond wohl ausgemacht. Noch nicht entschieden ist dagegen, ob sie tatsächlich, wie versprochen, Frieden und Hoffnung bringen wird.
Um zu verstehen, was den neuen Wettlauf überhaupt ausgelöst hat und welch massive Triebkräfte die Expansion ins All vorantreiben, lohnt es sich, auf den Beginn der Monderoberung zurückzuschauen. Das Jahr 1955 markiert den Beginn des Wettrennens. Damals verkünden die rivalisierenden Großmächte USA und Sowjetunion, schon bald künstliche Satelliten in die Erdumlaufbahn zu schicken. Nur zwei Jahre später sendet Sputnik 1 die ersten Funksignale zurück zur Erde und damit ein Zeichen in den Westen. Der „Sputnik-Schock“ trifft den Westen ins Mark, war man doch des Glaubens, die Sowjetunion sei technologisch hoffnungslos rückständig. Als Reaktion darauf steigern die USA ihre Anstrengungen massiv und gründen die NASA. Es entspinnt sich ein immer schnellerer Wettlauf der Kontrahenten, in dem nicht weniger als die Überlegenheit der eigenen Gesellschaftsordnung demonstriert werden soll.
Doch die Raketen, die den Kosmonauten Juri Gagarin als ersten Menschen ins All und den Astronauten Neil Armstrong als ersten Menschen auf den Mond bringen, offenbaren auch das militärische Potenzial. Denn die Trägerraketen können nicht nur Menschen ins All befördern, sondern auch nukleare Sprengköpfe an weit entfernte Orte auf der Erde. Zudem liefern Satelliten nicht nur Daten über das Wetter, sondern auch über feindliche Armeen. So ist die Raumfahrt seit jeher untrennbar mit der militärischen Logik verknüpft. Niemand verkörpert das mehr als Wernher von Braun, der als Konstrukteur die V2-Rakete für das NS-Regime entwickelte, die Tausenden in London und Südengland den Tod brachte und später im Kalten Krieg auf US-amerikanischer Seite den ersten bemannten Mondflug möglich machte.
Im Kalten Krieg: Konkurrenz und Kooperation
Jenseits der militärischen Bedrohung kommt es aber auch zur Kooperation zwischen den Blöcken. Symbolisch steht dafür das Apollo-Sojus-Projekt von 1975, bei dem ein US-amerikanisches und ein sowjetisches Raumschiff in der Umlaufbahn aneinandergekoppelt wurden. Ein kleiner Schritt genügte fortan, um ins andere Raumschiff zu gelangen – zugleich war dies ein großer Schritt in Richtung der Internationalen Raumstation ISS. Bis heute gilt die ISS als Vorzeigeprojekt friedlicher internationaler Zusammenarbeit. In den Laboren der Raumstation erforschen Wissenschaftler*innen die Wirkung der kosmischen Strahlung, aber auch Leben und Materie in der Schwerelosigkeit. Aufgrund der abnehmenden Knochendichte im All ist die Raumstation zum Beispiel ein idealer Ort zur Erforschung von Osteoporose.
Satelliten entdeckten 1985 aber auch das Ozonloch und lieferten wichtige Daten über den Klimawandel. Landwirtschaft und Katastrophenschutz verlassen sich schon lange auf die Beobachtungen von Wettersatelliten. Navigationssysteme wie GPS regeln den Verkehr und weisen den Weg für die Lieferketten der Weltwirtschaft. Riesige Photovoltaikanlagen im Erdorbit sollen die künftige Energieversorgung sicherstellen. Und auch die digitale Infrastruktur für das Internet hängt maßgeblich davon ab.
All das zeigt, wie umfassend unser alltägliches Leben auf der Erde inzwischen von menschlichen Errungenschaften im Erdorbit und Weltall bestimmt wird. Da verwundert es nicht, dass Satelliten mittlerweile ein dichtes Netz mit ihren Bahnen um die Erde ziehen. Das unendliche All ist rund um den Planeten Erde mit immer günstiger zu produzierenden und einer damit steigenden Zahl an Mikrosatelliten bevölkert. Tote und zusammengestoßene Satelliten bilden gefährlichen Weltraumschrott, der schon jetzt alle Aktivitäten im Orbit erschwert.
Doch die gewaltige technologische Aktivität im All birgt noch ein weiteres Sicherheitsrisiko: Unsere Abhängigkeit von ihr macht sie angreifbar und damit zur kritischen Infrastruktur. Ein Ausfall kann militärische Informationsflüsse kappen, wirtschaftliche Lieferketten zum Erliegen bringen und unser alltägliches Leben entschieden beeinflussen. Antisatellitenwaffen können den Funkverkehr von Satelliten stören, diese mit Lasern blenden oder sogar ausschalten. 2007 zerstörte China gezielt einen eigenen 750 kg schweren Satelliten und produzierte damit weiteren Weltraumschrott, weshalb die ISS mehrmals im Jahr Ausweichmanöver durchführen muss.
Dieses Beispiel steht für die enorme Dimension des neuen Wettlaufs ins All. 72 Länder betreiben heute ein eigenes Raumfahrtprogramm, unter anderem China, Indien, Brasilien und ein Zusammenschluss europäischer Länder. Der alte Wettlauf stand dagegen noch ganz im Kontext der bipolaren Weltordnung, er spielte sich allein zwischen den Vereinigten Staaten und der Sowjetunion ab. Mit dem Ende des Kalten Krieges errangen die USA für einen zeitgeschichtlich winzigen Moment die Position als unangefochtener Hegemon. Doch mit China steht heute ein neuer Herausforderer bereit, und auch andere Staaten und Bündnisse ringen um Einflusssphären jenseits der Erde.
Die multipolare Weltordnung erschafft neue Unsicherheiten und führt zu einem neuen Wettstreit – auch im All. China, dessen Beteiligung an der ISS am Veto der USA gescheitert war, hat bereits eigene Weltraumstationen ins All geschickt. Und seit 2019 mischt auch Indien im großen Spiel um den Einfluss im All mit, durch erste Tests eigener Antisatellitenraketen. Im selben Jahr gründeten die USA und Frankreich eine gemeinsame Weltraumstreitkraft. Und im Sommer 2021 stellte sogar die Bundeswehr ein Weltraumkommando auf, das eigene Satelliten schützen soll.
Die Ökonomisierung des Weltraums
Doch neben der neuen staatlichen Konkurrenz um Einfluss lässt sich eine zweite, wahrscheinlich noch entscheidendere Entwicklung beobachten. Neben Staaten als dominanten Akteuren im „OldSpace“ treten Privatunternehmen und Privatpersonen als neue einflussreiche Akteure auf die galaktische Bühne des „NewSpace“. Elon Musks Firma SpaceX baut Trägerraketen, die Material und Menschen zur ISS bringen, und im vergangenen Sommer lieferten sich Jeff Bezos und Richard Branson ein spektakuläres Wettrennen darum, wer als erstes Privatunternehmen ins Weltall fliegt. Letzteres lässt sich auch als große Kampagne für die kommerzielle Raumfahrt deuten, die von den Firmen Virgin Galactic und Blue Origin der beiden Multimilliardäre angeboten wird. Über politisch-militärische Interessen hinaus spielen damit auch Profitinteressen eine bedeutende Rolle bei der Expansion in den Weltraum.
Allerdings handelt es sich dabei gar nicht um ein so neues Phänomen. Auch in früheren Missionen arbeitete die staatliche Behörde NASA mit privaten Unternehmen wie Boeing oder dem Rüstungskonzern Lockheed Martin zusammen. Ein entscheidendes Novum gibt es aber doch: Heutzutage kooperieren viele Unternehmen nicht mehr vor allem mit den staatlichen Raumfahrtbehörden, sondern sie expandieren als eigenständige Akteure ins All.
Ideen für eine ökonomische Erschließung des Weltalls existieren bereits seit vielen Jahrzehnten. Schon 1967 formulierte Barron Hilton, Erbe der gleichnamigen Hotelkette, seine damals noch utopisch erscheinenden Pläne: „Wenn die Weltraumforschung die Errichtung von Hotels im Weltraum physikalisch möglich macht, wird sich die Hotelbranche dieser Herausforderung stellen.“[1] Gut 50 Jahre später könnte aus der Utopie Wirklichkeit werden, haben technologische Innovationen und die enorm gesunkenen Kosten der Raumfahrt einen regelrechten Höhenrausch in den Zentralen großer Konzerne entfacht. Insbesondere drei Branchen locken dabei mit astronomischen Profitraten.
Boombranchen im All: Tourismus, Telekommunikation und Bergbau
Erstens der Weltraumtourismus: Bereits jetzt lassen sich kommerziell Flüge in den Weltraum buchen. Für eine knappe halbe Mio. US-Dollar bietet Virgin Galactic einen Ausflug ins All mit mehreren Minuten in der Schwerelosigkeit, und an der ersten privaten Astronautenmission zur ISS konnten im April 2022 drei Weltraumtouristen für jeweils 55 Mio. Dollar teilnehmen. Mit Plänen für das „orbital reef“ kündigte Jeff Bezos‘ Raumfahrtunternehmen Blue Origin dann auch das erste kommerziell betriebene Weltallhotel für das Ende des Jahrzehnts an.
Die zweite profitable Branche im All sind Telekommunikationssysteme mit Satelliten. Allein in den vergangenen zehn Jahren hat sich deren Anzahl mit aktuell über 5000 Satelliten nahezu verfünffacht. Mit dem Projekt „Kuiper“ in Form von mehreren Tausend Satelliten will Amazon in der Zukunft ein globales Breitband-Internet bereitstellen. Marktkonkurrent SpaceX von Elon Musk plant derweil 30 000 weitere Satelliten. Dabei bietet seine Firma Starlink schon jetzt Internet auch an entlegenen Orten und verfügt damit quasi über ein globales Monopol: „Eine Person besitzt die Hälfte der aktiven Satelliten auf der Welt. [...] De facto macht er die Regeln. Der Rest der Welt, einschließlich Europa, reagiert einfach nicht schnell genug“, warnt der Generaldirektor der ESA, Josef Aschbacher. [2]
Der dritte lukrative Wirtschaftszweig im All ist der Weltraumbergbau. Ähnlich wie im späten 19. Jahrhundert in Alaska breitet sich heute mit Blick auf das All eine wahre Goldgräberstimmung aus. Doch anstelle von Gold in Klondike und Yukon berauschen dieses Mal Platin, Kobalt und Nickel auf Asteroiden. Einer Schätzung zufolge befinden sich allein auf dem vergleichsweise kleinen, erdnahen Asteroiden „1986 DA“ Metalle im Wert von 11,65 Billionen Dollar.[3] Das entspricht fast der dreifachen jährlichen Wirtschaftsleistung Deutschlands.
Nicht nur bei der Suche nach wertvollen Rohstoffen auf Asteroiden und dem Mond ergeben sich ganz neue Herausforderungen. Die eigentliche Schwierigkeit besteht nämlich darin, diese dann auch auf die Erde zu transportieren, wofür enorm kostspielige technologische Innovationen erforderlich sind. Daher werden in der Weltraumökonomie dringend potente Kapitalgeber, ob private Investoren oder der Staat, gebraucht. Bis jetzt haben allein Elon Musks Firmen SpaceX und Tesla sieben Milliarden US-Dollar durch Verträge mit dem amerikanischen Staat erhalten, von den weiteren Milliarden durch Steuererleichterungen und andere Subventionen ganz zu schweigen.
Riesige Heilserwartungen und eine radikal-libertäre Weltsicht
Dabei gilt so wie auf der Erde auch für das All: Jede große Investition im Jetzt bedarf einer großen Erzählung für die Zukunft. An großen Narrativen über den Sinn und die Zukunft der Raumfahrt sparen die führenden Weltraumunternehmen jedenfalls nicht. So verkündete Naveen Jain, der Mitgründer von Moon Express, einem Unternehmen, das Bergbau auf dem Mond realisieren möchte, dass der Mond Ressourcen vorhalte, die der Erde und der gesamten Menschheit nutzen könnten.
Des Weiteren werden von Weltraumunternehmer*innen der wissenschaftliche Fortschritt und der natürliche Entdeckergeist des Menschen ins Feld geführt, gerne verziert mit der Erzählung über „unendliche Weiten“ und unendliche Freiheit im Weltraum als „last frontier“, mit der sie in kühler Berechnung an den Mythos der Besiedlung Amerikas anknüpfen.
Ganz bewusst stieg denn auch Jeff Bezos nach seiner Reise ins Weltall mit Cowboyhut und -stiefeln aus der Landekapsel. Als Ort der Freiheit zwischen Zivilisation und Natur hatte die „frontier“ schon immer eine immense Strahlkraft auf die amerikanische Identität. Weit weg vom britischen Mutterland konnten sich die Kolonialist*innen damals den Zöllen und Steuern entziehen. Und wo früher das Vereinigte Königreich die Freiheit einschränkte, ist es heute der kleptokratische, regulative Steuerstaat – so zumindest das anschlussfähige Narrativ der Rechtslibertären, die jetzt ganz maßgeblich Eroberung des Weltalls betreiben. Deren Weltsicht – basierend auf uneingeschränktem Privateigentum, Marktradikalismus und entgrenzter Freiheit – ist eng mit der Entstehung der radikal-libertären Ideologie im kalifornischen Silicon Valley verknüpft. Diese speist sich aus anarchistischer Hippie-Weltanschauung, gepaart mit ökonomischem Liberalismus und einem Technikoptimismus, der alle gesellschaftlichen Probleme lösen können soll. Unter Weltraumunternehmer*innen ist dieser Rechtslibertarismus als Weltsicht weit verbreitet, ja sogar vorherrschend.
Die Ablehnung des Staates und seiner Gesetze zeigt sich nicht zuletzt bei Elon Musk, wie sein milliardenschwerer Kauf von Twitter gezeigt hat. In einer Betaversion seines Satellitennetzwerks Starlink ließ Musk die Nutzer*innen eine Klausel unterschrieben, die besagt, dass der Mars ein freier Planet sei und keine irdische Regierung auf ihm über Souveränität und Autorität verfüge – sprich: er jeder privaten Eroberung offensteht.[4] Was für eine radikal-liberale Utopie! Einem Fernbleiben des Staates aus dem All sieht auch Peter Beck hoffnungsvoll entgegen. Der Chef des Raumfahrtunternehmens Rocket Lab sieht gerade in der Kommerzialisierung des Weltalls dessen Demokratisierung.[5]
»Demokratisierung durch Kommerzialisierung«
Doch wie könnte ein derart „demokratisiertes“ Weltall am Ende aussehen? Einen Vorgeschmack darauf geben rechtslibertäre Projekte auf der Erde, die ohne Regierung und öffentlichen Güter existieren sollen. Nach Vorstellung der rechtslibertären Visionäre soll das gesellschaftliche Leben – einschließlich Polizei, Gesundheitswesen und Justiz – ausschließlich privatwirtschaftlich organisiert werden.
Derartige freie Privatstädte funktionieren angeblich besser, billiger und freier als die heute existierenden Gemeinwesen. Im Wettbewerb um Bewohner*innen organisieren sie sich letztlich wie Unternehmen. Aus Bürger*innen werden Kund*innen; demokratische Prinzipien wie Gewaltenteilung und Pluralismus weichen einer autoritären Unternehmensführung. Mitbestimmung und gesellschaftliche Teilhabe durch ein allgemeines Wahlrecht und den Sozialstaat haben darin keinen Platz, denn das bremse nur den Fortschritt. Nach der libertären Logik verwirklicht sich die Demokratie allein durch Konsumentenentscheidungen und freie Wahl auf dem Markt. Ist ein Kunde unzufrieden mit der Stadt, wechselt er eben zu einer besseren.
Mit der Stadt Próspera in Honduras setzen Unternehmenskonsortien dieses Konzept bereits heute in die Praxis um. 2013 als Sonderwirtschaftszone parlamentarisch beschlossen, lockt die Stadt seither als Steuerparadies und mit dem Versprechen maximaler unternehmerischer Freiheit ganz gezielt Investor*innen an. Die Bevölkerung hat dagegen kein Mitspracherecht bei dem Projekt, für das sogar die Verfassung geändert wurde. In der Folge regt sich Widerstand der lokalen Bevölkerung, die in Sorge um ihr Land und ihre Rechte protestiert.
Genau das macht auch die Expansion ins All so interessant – als einem (noch) unbewohnten Ort, an dem mit Widerstand nicht zu rechnen ist. Genau das sind die Sehnsuchtsorte der libertären Vordenker*innen. Als „Seestätte“ bezeichnen sie daher umfunktionierte Plattformen, Schiffe oder gänzlich neu entworfene, künstliche Inseln, die dauerhaften Lebensraum auf dem Meer bieten – weit entfernt von jeglichen staatlichen Befugnissen.
Letztlich träumen rechtslibertäre Unternehmer*innen von einer anarchokapitalistisch organisierten Gesellschaft. Ihre Ikone ist die Literatin Ayn Rand (1905-1982) mit ihrer Philosophie des reinen Kapitalismus – eines absolut freien Marktes ohne jeden staatlichen Einfluss.
Um diese Träume zu verbreiten und zu konkretisieren, gründeten Patri Friedman, Enkel des neoliberalen Vordenkers Milton Friedman, und der Investor und Paypal-Mitgründer Peter Thiel, ein enger Vertrauter und Förderer Donald Trumps, 2008 das Seastading Institute. Auf der Website dieser „Denkfabrik“ ist zu lesen, es gebe „heutzutage keinen Freiraum mehr, um mit neuen Gesellschaftsformen zu experimentieren“. Mit den schwimmenden Städten könne und wolle man die „Armen reich machen, die Kranken heilen und die Hungrigen ernähren“.[6]
Doch die hehren Absichten dürfen bezweifelt werden. Tatsächlich geht es darum, einen Raum uneingeschränkter Kapitalakkumulation ohne regulierenden Staat für die Tech-Elite zu schaffen – und das jetzt auch mit Blick auf den Weltraum.
Der libertäre Traum einiger weniger als Albtraum für den großen Rest
Der libertäre Traum einiger könnte sich als ein undemokratischer Albtraum für viele entpuppen. Daher ist es wichtiger denn je, in demokratischen Prozessen Regeln zu finden, die der Ökonomisierung des Weltalls zu privaten Zwecken einen Riegel vorschieben.
Dafür muss erstens das Satellitensystem dringend stärker reguliert werden. Der sogenannte Kessler-Effekt beschreibt, wie nur eine kleine Kollision im Orbit eine Kaskade weiterer Kollisionen nach sich ziehen wird und wild umherfliegender Weltraumschrott die Nutzung des Weltraums unmöglich machen kann. Um diese Gefahr einzudämmen, benötigen wir eine international anerkannte Satellitenverkehrsordnung.[7] Dabei muss nicht nur die Flugbahn, sondern auch das Lebensende eines Satelliten vorab klar bestimmt werden. Zudem darf eine derart kritische Infrastruktur nicht in der Hand von Privatunternehmen liegen, was gefährliche Abhängigkeiten zur Folge hat.
Jüngstes Beispiel dafür war das von Elon Musks Firma Starlink für das ukrainische Militär bereitgestellte Internet, das ausgerechnet während der ukrainischen Offensive in einigen Frontbereichen ausfiel. Die Folge waren umgehend Spekulationen über einen Deal zwischen Musk und Moskau. Auch wenn der Ausfall ein Zufall war, bleibt der Aufbau eines unabhängigen europäischen Breitband-Satellitennetzes dringend erforderlich.
In Anbetracht der Klimakrise müssen wir zweitens als Gesellschaft über Sinn und Unsinn von Weltraumtourismus diskutieren. Schon jetzt emittieren Superreiche mit ihren Privatjets, Mega-Yachten und Villen riesige Mengen an schädlichen Gasen in die Atmosphäre. Das reichste Prozent der Menschen stößt dabei mehr CO2 aus als die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung – und der Weltraumflug eines Milliardärs belastet das Klima mehr als manche Menschen in ihrem gesamten Leben.
Drittens gilt es ganz grundsätzlich zu klären, wer einen rechtlich legitimen Anspruch auf die Ressourcen und die Nutzung des Weltraums erheben kann. Wer darf auf dem Mond oder auf einem Asteroiden nach wertvollen Rohstoffen schürfen? Ist es tatsächlich nach dem ungeschriebenen Gesetz des „Wilden Westens“ die erste Person, die auf dem Himmelskörper ein Gebiet entdeckt, absteckt und dort ihre eigenen Regeln setzt – oder gibt es nicht vielmehr ein gemeinsames Erbe der Menschheit?
Das Weltall gehört niemandem oder uns allen
Mit dem Weltraumvertrag von 1967 wurde erstmals ein Abkommen beschlossen, das in Artikel II die „nationale Aneignung“ von Himmelskörpern verbietet. Bis heute haben über hundert Länder diesen Vertrag ratifiziert. Doch in besagtem Artikel klafft eine gewaltige Gesetzeslücke: Die vage Formulierung schließt nämlich nur die nationale Aneignung, nicht aber die privatwirtschaftliche Nutzung aus. Mit dem Mondvertrag von 1979 sollte daher diese Lücke geschlossen werden. Doch obwohl darin der Besitz von Himmelskörpern durch Privatpersonen oder Organisationen verboten wird, lassen sich damit kapitalistisch organisierte Landnahmen und kommerzieller Bergbau nicht verhindern. Denn bisher haben nicht einmal 20 Staaten diesen Vertrag ratifiziert. Wichtige Nationen wie die USA, China oder Deutschland gehören nicht dazu. Der Mondvertrag gilt daher als gescheitert.
Bis heute gibt es also kein stichhaltiges rechtliches Rahmenwerk über Eigentum und Nutzung von Himmelskörpern. Doch die Zeit drängt, denn mit technologischen Neuerungen rücken profitable Bergbau- und Kolonisierungsprojekte immer näher. Und wie wir aus der Geschichte wissen, erfolgten fast alle großen Entdeckungen – ob zu Wasser, zu Lande oder in der Luft – stets nach dem gleichen Muster: Zuerst kommt der Wettbewerb, dann der Machtkampf, und am Ende bestimmt der Sieger die Regeln. Es ist daher dringend an der Zeit, das fatale Muster zu durchbrechen, denn das Weltall gehört entweder niemandem – oder uns allen.
[1] Peter Dickens, The Cosmos as Capitalism’s Outside, in: „The Sociological Review“, 1/2009, S. 66-82.
[2] Peggy Hollinger und Clive Cookson, Elon Musk being allowed to ‚make the rules‘ in space, ESA chief warns, www.ft.com, 5.12.2021.
[3] Juan A. Sanchez et al, Physical Characterization of Metal-rich Near-Earth Asteroids 6178 (1986 DA) and 2016 ED85, in: „The Planetary Science Journal“, 10/2021, S. 13.
[4] Morgane Llanque, Kolonien im Weltall. Das Kolumbus-Syndrom, www.enorm-magazin.de, 24.2.2021.
[5] Victor Lund Shammas und Thomas B. Holen, One giant leap for capitalistkind: private enterprise in outer space, in: „Palgrave Commun“, 10/2019, S. 1-9, www.researchgate.net.
[6] Siehe www.seasteading.org.
[7] Siehe dazu auch: Torben David, Die Kolonialisierung des Weltalls, in: „Blätter“, 11/2017, S. 113-120.