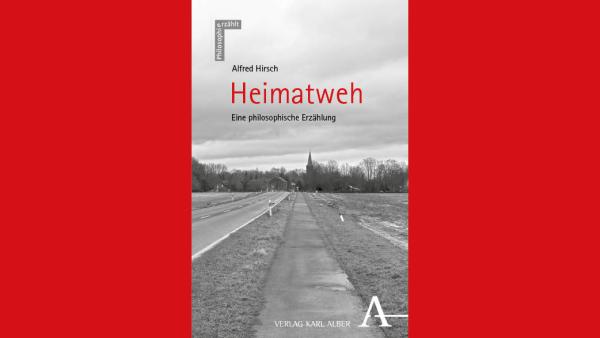Bild: Ein Graffito von Adorno der Graffitikünstler Justus Becker und Oğuz Şen an einem Unigebäude in Frankfurt, 22.6.2021 (IMAGO / Dreamstime)
Vor 55 Jahren, am 6. August 1969, starb Theodor W. Adorno. Damals befand sich die Frankfurter Schule auf dem Höhepunkt ihrer öffentlichen Wirkung. Der Tod Adornos steht symbolisch für das Ende einer Erfolgsgeschichte, führte es aber nicht herbei. Diese Erfolgsgeschichte begann 1949 mit der Rückkehr aus dem Exil. Nur anderthalb Jahrzehnte später war aus Adorno der „Medien-Intellektuelle“ (Axel Schildt) der Republik geworden und ein universitärer Superstar. Seine Vorlesungen waren Events, zu denen nicht nur massenweise Studierende aller Fakultäten strömten, sondern auch reichlich nichtakademisches Publikum aus der Stadt. Für die Studierenden war er ein Idol und als öffentlicher Intellektueller eine Figur ähnlich der Sartres in Frankreich. Um 1960 fiel erstmals das Wort „Frankfurter Schule“, 1968 war es Allgemeingut. Max Horkheimer hatte unmittelbar nach der Remigration an Adorno geschrieben, dass bei einer erfolgreichen Etablierung in Frankfurt eine „einzigartige Situation“ insofern entstehe, „daß zwei Menschen, die so quer zur Wirklichkeit sich verhalten wie wir und eben deshalb zur Machtlosigkeit als vorherbestimmt erscheinen, eine Wirkungsmöglichkeit von kaum berechenbarer Tragweite geboten wäre“.[1] Diese Situation war tatsächlich eingetreten, gegen alle Wahrscheinlichkeit.
Denn nichts sprach zunächst dafür, dass ein Gelehrter wie Adorno eine solche Bedeutung sowohl für die Geistes- und Sozialwissenschaften als auch für die bundesdeutsche Demokratie gewinnen konnte. Niemand kannte ihn, als er nach Frankfurt zurückkehrte. Auf einen Lehrstuhl musste er ein Jahrzehnt warten. Was er anzubieten hatte, war nicht unbedingt satisfaktionsfähig. In Aphorismen drückten sich eher die Gegner akademischer Philosophie aus, seine Texte waren voraussetzungsvoll, codiert, alles andere als leichte Kost. Überhaupt nahm Adorno wenig Rücksicht auf die vermeintlichen Lese- und Hörgewohnheiten, selbst wenn er sich an ein außeruniversitäres Publikum richtete. Gegen einen Erfolg sprach auch das Faktum, dass er als Emigrant zurückgekehrt war, was in der Nachkriegszeit keinen Orden einbrachte, sondern Ressentiments und sogar Ängste provozierte. Womöglich sann dieser von den Amerikanern protegierte „jüdische“ Pseudophilosoph auf Vergeltung? Die Frage „Was haben Sie eigentlich zwischen 1933 und 1945 gemacht?“, mussten sich jedenfalls gerade diejenigen anhören, die während der NS-Diktatur das Land verlassen hatten, weniger die Nazis und Mitläufer.
Und schließlich: Auch wenn die Frankfurter Lehrer, allen voran Horkheimer, keine sozialistische Fahne vor sich hertrugen und zum Arbeiter- und Bauernstaat jenseits des „Eisernen Vorhangs“ sogar ein feindseliges Verhältnis pflegten, war ihre Kritische Theorie doch bloß ein anderer Name für eine wesentlich von Marx herkommende Perspektive auf Geschichte und Gesellschaft. In Zeiten von Kaltem Krieg und staatlich beförderter antikommunistischer Grundstimmung war das eher von Nachteil bei der Etablierung einer Schule.
Reeducation und der »Eros der öffentlichen Kommunikation«
Warum gelang es dennoch? Sicherlich spielten das Charisma und die Genialität Adornos keine geringe Rolle. Die Gabe, sich konzentriert, freihändig und in komplexen Sätzen auszudrücken, ja das Gefühl zu vermitteln, die Gedanken folgten einer Komposition und gehorchten einer Ästhetik, schuf eine gewisse Aura. Adorno verfügte über „den pädagogischen Eros der öffentlichen Kommunikation“ (Wolfram Schütte) und verneigte sich nach einem Vortrag vor dem applaudierenden Publikum wie ein Pianist nach einem Klavierkonzert.[2]
Aber Ausstrahlung allein hätte natürlich nicht gereicht. Das Entscheidende war die amerikanische Reeducation-Politik, ohne die der Durchbruch nicht möglich gewesen wäre. Nicht umsonst wurden die Frankfurter Lehrstühle für die zurückgeholten Direktoren des Instituts für Sozialforschung, in das auch US-Dollar flossen, als „Wiedergutmachungslehrstühle“ bezeichnet. Auch das berühmte „Gruppenexperiment“ des Instituts war ganz eindeutig der Reeducation verpflichtet. An keinem anderen Ort in der Bundesrepublik außer in Frankfurt hätte Adorno sonst einen philosophischen Lehrstuhl bekommen. Den Professorenkollegen war er nicht geheuer, vor allem denen nicht, die eine braune Vergangenheit hatten, also der Mehrzahl. Zwar wusste man nicht, was Adorno wusste, aber man wusste, dass er Informationen über NS-Karrieren sammelte. Man begegnete dem „jüdischen Remigranten“ mit Ehrfurcht: mit einer Mischung aus Ehre und Furcht.[3]
In der Soziologie sah die Lage günstiger aus als in der Philosophie. Hier hatte das Institut einen Vorsprung durch die amerikanischen Erfahrungen. In der akademischen Lehre hatte man in Frankfurt zudem früh die Zeichen der Zeit erkannt und reagierte auf die Expansion des Bildungswesens. Dazu kam, dass die Soziologie vor dem Hintergrund der Systemkonkurrenz zwischen den kapitalistisch-westlichen und den sozialistisch-östlichen Gesellschaften zu einer Art Leitwissenschaft avancierte, mit der philosophisch angeleiteten Gesellschaftstheorie als Leitwährung der Modernisierung. Die Theorie der Gesellschaft – ob kritisch, systemtheoretisch oder „diamatisch“ –, hatte sozusagen die metaphysische Philosophie beerbt und einen sehr weitreichenden Erklärungsansatz für nahezu alle Dinge angeboten, denn es ging ja immer noch um das „Ganze“. Alles schien „gesellschaftlich vermittelt“, von der Musik über die Öffentlichkeit, die Institutionen und die Arbeit bis hin zu den privaten Liebesbeziehungen. Das Frankfurter Angebot war überdies anschlussfähig ans Bildungsbürgertum. Man konnte sich mit Marx beschäftigen, ohne dem Sowjetkommunismus und der DDR in die Karten zu spielen. Und es war dann enorm attraktiv für die Generation, die in den 1960er Jahren ihre Eltern zu fragen begann, was sie während des „Dritten Reiches“ gemacht hatten. Zufriedenstellende Antworten erhielten sie selten. Dieses Vakuum füllte Adorno.
Adorno als moralische Instanz
Adorno war für die Nachkriegs- und Nachwuchsintellektuellen eine moralische Instanz, die das Schweigen über die furchtbare Vergangenheit brach und die sogenannte Restauration kritisierte. Er verlangte bei aller Vergangenheitsaufarbeitung keinen Bruch mit der deutschen klassischen Kultur, bloß den Abbau des autoritären Charakters und eine Offenheit für den Kanon der Moderne von Beckett über Proust bis Schönberg. Der Kritiker der Kulturindustrie war ein passionierter Kinogänger, und manchen progressiven und avantgardistischen Künstlern, die sich als Zaungäste am Frankfurter Hof einfanden, galt er gar als Pate und Mentor. „Meiner ganzen Generation“, schrieb der 1945 geborene Manfred Frank, der das Ganze von Heidelberg aus beobachtete, „war die Existenz der Kritischen Theorie eine geistige Überlebensfrage angesichts von Eltern und Lehrern, die vom Nationalsozialismus entweder kompromittiert waren oder in einer Vermeidungsstrategie die verspäteten Analysen umgingen.“[4]
Solche Verweise auf die Situation in der jungen Bundesrepublik sind Legion, nicht nur bei den Schülern, sondern eben auch bei den Nachbarskindern. Die Reeducation, der Kalte Krieg, das Faktum einer verdrängten, aber nachwirkenden Vergangenheit, ein daran sich entzündender Generationenkonflikt sowie die breite Modernisierung-plus-Demokratisierung der Gesellschaft insgesamt schufen die Voraussetzungen für die Erfolgsgeschichte von Adorno & Co. Das war eine einmalige Konstellation und Gemengelage, die es den Köpfen der Frankfurter Schule – also Hegelmarxisten, Freudianern und „Umerziehern“ – ermöglichte, zur intellektuellen Gründung der Bundesrepublik entscheidend beizutragen. Für kurze Zeit war sie eine Diskursmacht.
So unwahrscheinlich die Erfolgsgeschichte, so wahrscheinlich die des Niedergangs. Nach Adornos Tod stand der Kritischen Theorie ein trostloses Jahrzehnt bevor. Sie wurde dezentralisiert, provinzialisiert und verfügte über keinen festen Ort mehr. Es bildeten sich Metamorphosen, die sich in Milieus und Nischen verflüchtigten. In den universitären Fächern Philosophie und Soziologie war sie mit Ausnahme von Habermas’ Arbeit an einer kritischen Gesellschaftstheorie rasch marginalisiert. Der Anspruch, das Ganze auf den Begriff zu bringen sowie Wesen und Gesetzmäßigkeiten von Geschichte und Gesellschaft zu erkennen, erschien zunehmend anachronistisch, aus der Zeit der heroischen Moderne stammend. Die kritische Gegendarstellung zum falschen Ganzen verlor in einer zunehmend unübersichtlicher werdenden Zeit an Überzeugungskraft.
Von der Erfolgsgeschichte zum jähen Niedergang
An der Frankfurter Universität existierte die Kritische Theorie nur noch in Schrumpfform weiter. Viele Professoren und Dozenten der Philosophischen Fakultät waren erleichtert, dass die kategorischen Imperative der Gründerfiguren nun an Kraft verloren, dass die Soziologisierung der Philosophie und die Politisierung der Wissenschaften nicht mehr der Goldstandard waren. Lediglich Alfred Schmidt hielt in Frankfurt die Stellung, was für die Universität nur gut war, denn der nostalgische Blick auf die Kritische Theorie nutzte dem guten Ruf des wissenschaftlichen Standorts. In seinen Veranstaltungen kamen sowohl akademisch orientierte Philosophen als auch politisch ambitionierte Marx-Leser auf ihre Kosten. Als Lehrstuhlnachfolger Horkheimers hielt er zusammen mit Honorarprofessor Gerhard Schweppenhäuser die Erinnerung an die alten Zeiten Kritischer Theorie an der Goethe-Universität wach. Für die reale Lage dieser Theorie steht aber eher Karl Heinz Haag, der sich nach Adornos Tod als Privatier weiter der Arbeit an ungelösten Problemen der Kritischen Theorie widmete. Aber das bekamen nur noch wenige mit.
Das Institut für Sozialforschung zog sich gleichfalls von der Universität zurück. Es spezialisierte sich fachlich auf die Industriesoziologie und politisch auf die sozialen Konflikte und Arbeitskämpfe. Für diesen Kurs standen die neue Belegschaft und „ihr“ Direktor Gerhard Brandt. Der Preis für die demokratisierte Forschung bestand in großen inneren Spannungen, die sich aus dem zu leistenden Spagat zwischen finanziellen Sachzwängen, wissenschaftlicher Orientierung und politischem Anspruch ergaben, sowie in einer gewissen Ghettoisierung im Fach.
Die Adorno-Schülerin und bekannte Publizistin Helge Pross etwa zählte Frankfurt nicht mehr zu den wichtigsten Forschungsstandorten in Deutschland. Den eigentlichen Strukturwandel des westeuropäischen Kapitalismus in dieser Zeit, also Deindustrialisierung, neoliberale Umstrukturierung und Digitalisierung, erfasste man – nicht nur – in Frankfurt nicht.[5]
In Lüneburg und Hannover entstanden derweil Nester der Kritischen Theorie, die bis heute fortbestehen. Schweppenhäuser imitierte vor den Toren Hamburgs Adorno, sein Idol, und kam mit seinem Stil als Gentleman in diesem speziellen bürgerlichen Ambiente der Kreisstadt am Rande der Heide hervorragend an. Er bot vielen Anhängern der alten Kritischen Theorie Asyl, die aufgrund ihrer politischen Einstellung und hartnäckigen Distanz zum „Wissenschaftsbetrieb“ keinen Platz an einer Universität finden konnten. In Lüneburg entstand so eine lebendige Szene, die ihren Elan und Kampfgeist aus der Gegnerschaft zu Habermas’ kommunikativer Wende der Kritischen Theorie bezog. Der Erfolg des 1983 nach Frankfurt zurückgekehrten Philosophen, der nun in der Öffentlichkeit als legitimer Nachfolger Adornos galt, steigerte die Affekte.
Lüneburg und Hannover als neue Ableger der Kritischen Theorie
In Hannover wiederum bot Oskar Negt den Zersprengten des Frankfurter SDS während der „zweiten Restauration“ ein Winterquartier, nachdem ihm klargeworden war, dass eine Neuauflage von „Frankfurt“ an der Leine nicht möglich war. Aber in Kooperation mit Kollegen und Kolleginnen wie Regina Becker-Schmidt in der Sozialpsychologie und Elisabeth Lenk in der Literaturwissenschaft gelang die Institutionalisierung des marxistischen Wissenschaftsansatzes an der Universität. Zu einer erneuten Schulbildung kam es jedoch aufgrund des Eigensinns der Einzelnen nicht. Dennoch gingen von Hannover Impulse zu Aktualisierungen der Kritischen Theorie aus, namentlich von Becker-Schmidt, die den Gedankenaustausch zwischen Feminismus und Frankfurter Schule initiierte. Lenk hingegen ging surrealistische Sonderwege, die von vornherein in subkulturelle künstlerisch-intellektuelle Milieus führten, die sich im Widerspruch zur Gesamtgesellschaft befanden.
Eigensinnig wie die anderen Schülerinnen und Schüler Adornos war gewiss auch Rolf Tiedemann, der seine Lebens- und Arbeitszeit mit der Herausgabe der Gesammelten Schriften Benjamins und Adornos verbrachte. Vor allem Benjamins irrwitziges Passagen-Werk nahm ihn in Beschlag, ebenso die Kämpfe gegen die alten und bis heute nicht verstummten Vorwürfe, Adorno habe Benjamin zu dessen Lebzeiten zensiert und dessen Erbe manipuliert. Gegen die nun zur vollen Blüte gelangende kulturwissenschaftliche Benjamin-Forschung, die er aus vollem Herzen verachtete, riegelte Tiedemann sein Archiv konsequent ab. Ihm gelangen bewundernswerte Editionen, aber die Welt draußen wurde ihm darüber immer fremder.
Mit Helge Pross, Herbert Schnädelbach und Jürgen Habermas verließen drei wichtige Schüler Adornos Frankfurt, was ihren weiteren Erfolg begünstigte. Pross avancierte zur von Ministerien und Medien gefragten Expertin für sozialpolitische Fragen, insbesondere Frauen und das Geschlechterverhältnis betreffende. Sie darf als eine Pionierin der Genderforschung in den Sozialwissenschaften gelten. Die größte Reichweite erzielte sie jedoch durch das ZDF und die „Brigitte“, also durch Medien, die man nicht gerade mit der Frankfurter Schule in Verbindung bringt. Schnädelbach, dem die Frankfurter Luft ebenfalls zu stickig wurde, verstand es, den gebildeten Ständen der Öffentlichkeit die Vernunftphilosophie zu erklären, ihre gesellschaftliche Relevanz aufzuzeigen und den Platz der Kritischen Theorie darin zu bestimmen. Die Frage „Wozu Philosophie?“ verwandelte sich so allmählich in die Frage „Wozu noch Adorno?“. Ende der 1980er Jahre wurde Schnädelbach Präsident der bis dahin doch eher konservativen Allgemeinen Gesellschaft für Philosophie in Deutschland, auch das vielleicht ein Zeitzeichen.
Auf Habermas’ internationalen Erfolg muss nicht hingewiesen werden. Als Direktor des Max-Planck-Instituts zur Erforschung der Lebensbedingungen der wissenschaftlich-technischen Welt in Starnberg scheiterte er jedoch. Innere Spannungen und eine feindliche Außenwelt ließen ihn nach einem Jahrzehnt resignieren. Und doch entstand in diesen 1970er Jahren, inmitten von Streit und Missgunst, sein großes Werk über vernünftige Kommunikation. Habermas’ wichtigster Gedanke, dass nämlich die menschliche Lebensform durch Prozesse sprachlicher Kommunikation geprägt sei, war durch und durch republikanisch, Philosophie der Bundesrepublik eben. Zurück in Frankfurt, revitalisierte er sowohl das Philosophische Seminar als auch das intellektuelle Klima der Stadt und erfand darüber die Tradition der Kritischen Theorie in gewisser Weise neu. So wurde er zum Supervisor der Mitte der 70er Jahre einsetzenden Historiografie der Frankfurter Schule. In den politischen Debatten der Republik zog er seinen Revolver oft sehr schnell und traf nicht immer ins Schwarze. 1986 aber, im sogenannten Historikerstreit, machte er alles richtig. Habermas wurde in den 1980er Jahren der strahlende Stern mit Frankfurter Provenienz, ja, er baute selbst so etwas wie eine Schule auf, mit immer neuen Klassenkohorten, die bestimmte Grundelemente aus dem Frankfurter Theoriezusammenhang bis heute weiterreichen.
Die Frankfurter Schule als Mythos der Medien
In der Medienöffentlichkeit lebte die Kritische Theorie der Frankfurter Schule nach 1969 als ein Mythos weiter. Man trauerte entweder ihrer Blütezeit nach oder bekämpfte sie wie einen mächtigen Hegemonen. Von konservativer Seite wurden Adorno und seine Erben als Statthalter des Ungeistes von 1968 ausgemacht, dafür stehen pars pro toto die hysterischen Kampagnen gegen den Bildungsreformer Ludwig von Friedeburg. Im „Deutschen Herbst“ 1977 denunzierten Politiker wie Alfred Dregger und Franz Josef Strauß die Erben Adornos dann massiv. Von linksliberaler Seite und in der Gegenöffentlichkeit hingegen wurden vor allem Habermas, Alexander Kluge und Oskar Negt als Adornos Meisterschüler und Leitfiguren im Spätsommer der Theorie geschätzt und auch manchmal gehätschelt. Wer Kluges Filme nicht verstand, war in den 1970er Jahren noch selbst daran schuld. Habermas übernahm die Rolle des öffentlichen Intellektuellen, die einst Adorno innehatte, Negt galt als Cheftheoretiker der Neuen Linken, Kluge als Kopf des Neuen Deutschen Films.
Die beiden Letzteren taten sich schriftstellerisch zusammen und reüssierten auch noch, als die Bewegungen, mit denen sie verbunden waren, längst in die Jahre gekommen waren oder gar nicht mehr existierten. In den 1980er Jahren kam Kluges Kopfkino an sein Ende, ein Jahrzehnt später schloss Negts politische Heimat, das Sozialistische Büro. Dessen Ideen von Selbstverwaltung, antiautoritärer Politik und Lebensweltorientierung waren allerdings längst in die Gesellschaft eingesickert. Der Verfassungspatriot Habermas indessen galt nun bald als Hegel der Bundesrepublik.
Die intellektuelle Arbeit von Adornos Erben war insgesamt sehr produktiv und vielfältig. Jeweils waren sie in Einzelheiten vertieft, die stets das Ganze meinten. Der Niedergang der Frankfurter Schule lag nicht an mangelndem Fleiß oder fehlender Begabung, auch nicht an der Zerstrittenheit der Schüler. „Doch die Verhältnisse, sie sind nicht so!“, könnte man vielmehr mit Bertolt Brecht sagen, „the times they are a-changin’“ mit Bob Dylan.
Vertreibung, Rückkehr, Wissenschaftswunder
Vertreibung, Rückkehr, Wissenschaftswunder: Die Kritische Theorie war wie die Gesamtgesellschaft symbiotisch verbunden mit der Zeit des Nationalsozialismus und dessen Nachleben in der Bundesrepublik. Horkheimers Idee einer „kritischen Theorie“ spiegelte zum einen die historischen Erfahrungen der Gründergeneration, ihre Genesis ist ohne das nationalsozialistische Regime und die Vertreibung der linken und jüdischen Intelligenz aus Deutschland nicht sinnvoll zu rekonstruieren. Zum anderen rührte ein Gutteil der Attraktivität dieses sozialphilosophisch-politischen Angebots für diejenigen, die erst nach dem Ende des Nationalsozialismus erwachsen wurden, gerade von den Lebensläufen Horkheimers und Adornos, Pollocks und Marcuses, Löwenthals und Kracauers her. „Die unvorhersehbare Breitenwirkung der Kritischen Theorie Ende der 60er Jahre hat gewiß damit zu tun, daß diese Theorie tatsächlich vollgesogen war mit den biographischen und zeitgeschichtlichen Erfahrungen von exilierten Juden und unorthodoxen Linken.“[6] So erklärt Jürgen Habermas treffend die Anziehungskraft von Adorno & Co. Was da in Frankfurt als leuchtende Kraft zusammenkam, wirkte zudem als Katalysator für Entwicklungen, die in der ganzen Gesellschaft seit Beginn der 1960er Jahre stattfanden. Die Frankfurter Schule ist ein Kind dieser Aufbruchszeit, in der die Ordnungsvorstellungen einer „formierten Gesellschaft“ anachronistisch wurden. Sie beförderte autoritätskritische Ideen, die ihre Legitimation ganz überwiegend daraus zogen, dass der Schatten des Nationalsozialismus auf diesem Land lag. Die Kritische Theorie reifte für so viele junge intellektuelle Menschen, die mit einem Grundgefühl negativer Identität durchs Leben gingen, zum Gegenentwurf zur postvolksgemeinschaftlichen Ordnung der Adenauer-Ära heran. In den 1960er Jahren stand sie dann in voller Blüte.
Adornos Tod erfolgte inmitten des quasi ödipalen Dramas, das sich zwischen ihm und der studentischen Protestbewegung abspielte. Mit seinem Ableben und der Entstehung der Neuen Linken gerieten auch Adornos Ideen zur Aufarbeitung der NS-Vergangenheit in diesem Milieu in den Hintergrund, insbesondere seine These, dass nach Auschwitz nichts mehr so sei wie zuvor. Generell regredierte das mühsam errungene Geschichtsbewusstsein in der Folgezeit. Nicht ohne Grund hatten sich jüdische Intellektuelle wie Paul Celan, Peter Szondi, Ivan Nagel und Jacob Taubes an Adorno orientiert. Dessen Tod und die Suizide von Celan, Szondi, aber auch von Fritz Bauer und Jean Améry markierten eine Zäsur für die jüdische Nachkriegsexistenz in Deutschland.
Die Regression des Geschichtsbewusstseins und dessen Wiederentdeckung
Zwar stand zu Beginn der 1970er Jahre der spektakuläre Kniefall Willy Brandts vor dem Ehrenmal des Warschauer Ghettos und die symbolischen Gesten nahmen danach zu, doch die Zeit der konkreten kriminalistischen Aufarbeitung der Verbrechen, geschweige denn der materiellen Restitution und Reparation, war noch längst nicht angebrochen. Das Jahrzehnt war vielmehr von den Kulturkämpfen um die Folgen von „1968“ geprägt. Während die „Neokonservativen“ (wie Habermas sie nannte) die Frankfurter Schule für den RAF-Terrorismus haftbar machten, wollte die Neue Linke vom linksbürgerlichen Kulturkritiker Adorno nichts mehr wissen, Marx, Mao und Marcuse hingegen standen hoch im Kurs. Im „roten Jahrzehnt“ (Gerd Koenen) wurde die NS -Zeit in diesen Kreisen zugunsten von Kämpfen sozialer Befreiung und Revolutionserwartungen ein zweites Mal verdrängt.
Nach schmerzlichen Lernprozessen und harten Auseinandersetzungen entstand allerdings in den linken Subkulturen im Verlauf der 1980er Jahre ein aus der Historie generiertes Problembewusstsein, das erkannte und einsah, dass man auch das eigene Selbstverständnis zu hinterfragen habe: Von sektiererischen Irrwegen über manichäische antiimperialistische Weltdeutungen bis hin zur Ignoranz gegenüber den tatsächlichen Opfern der deutschen Geschichte gab es einiges aufzuarbeiten, vor allem antisemitische Einstellungen. Gerade im Umgang mit Israel und dem Palästina-Konflikt zeigte sich, wie unreflektiert die Erbschaft des Landes in der Generation der Nachgeborenen war. Vor allem die Jüdische Gruppe in Frankfurt und einige Einzelne betonten nun die konstituierende Rolle der jüdischen Erfahrung in diesem Jahrhundert für die Kritische Theorie. Adornos Frage „Was bedeutet Aufarbeitung der Vergangenheit?“ stand wieder auf der Tagesordnung. Mit dem Neomarxismus und der Neuen Linken schien sie im Jahrzehnt nach 1968 verschwunden, nun, nach 1986, tauchte sie wieder auf und hatte einen öffentlichen Gebrauchswert. Die Rückkehr der NS -Geschichte führte offenbar zu einer Revitalisierung der Kritischen Theorie, deren Geltung in der alten Bundesrepublik immer stark davon geprägt war, welche Rolle die NS -Vergangenheit im privaten wie öffentlichen Leben spielte.
Auch Adornos Erben verschlossen sich dem natürlich nicht. In den 1990er Jahren schien es geradezu zwingend, das ganze Wirken Adornos auf „Auschwitz“ zu beziehen, zumal der Philosoph dies in der Negativen Dialektik ja selbst getan hatte. In den zwei Jahrzehnten nach 1969 war die Bedeutung dieses welthistorischen Ereignisses für sozialphilosophisches, politisches und kritisches Denken mit linken Parolen und Plattitüden wie „Kapitalismus beseitigen, Imperialismus bekämpfen“ unkenntlich gemacht worden, und auch in den Arbeiten von Adornos Schülern und Schülerinnen finden sich bestenfalls Spurenelemente von Auschwitzbewusstsein. Nach 1989 sollte dieser zentrale Aspekt der Kritischen Theorie von größerer Bedeutung sein als die von Marx inspirierte Kapitalismuskritik, die materialistische Wissenschaftskritik, die dialektische Philosophie und die ästhetische Theorie.
Aus K wird wieder k: Wer entkorkt die Flaschenpost?
Die Kritische Theorie gilt oft als Hegelmarxismus oder freudianischer Marxismus oder westlicher Marxismus. Tatsächlich aber verfügt sie über zahlreiche weitere Facetten: die subjektbezogene Ästhetik und Ethik, die materialistische Philosophie und Gesellschaftstheorie, die politische Praxis eines lebensweltlich orientierten demokratischen Sozialismus, feministische Perspektiven auf die Gesellschaft, demokratieorientierte Sozialphilosophie etc. Zweifelsohne ist Kritische Theorie nicht von Hegels Dialektik und Marx’ Kritik der politischen Ökonomie zu trennen. Alle ihre Metamorphosen bewegen sich mehr oder weniger in diesem Rahmen. Aber mir scheint die „jüdische Erfahrung“ der Gründergeneration ein konstitutives Element zu sein, das lange übersehen wurde und oft unterschätzt wird.
Was bleibt von der Frankfurter Schule? Eines ist sicher: Solange immer wieder der Tod der Kritischen Theorie verkündet wird, lebt sie noch. Als Lehre und Großtheorie mit Totalitätsbezug ist sie in die Jahre gekommen, aber sie hat die intellektuelle und politische Landschaft verändert wie wahrscheinlich keine andere Schule in der Bundesrepublik. Sie ist, so gesehen, erfolgreich gescheitert. Ihr Glutkern – das Existenzialurteil über die falsche Gesellschaft – erlischt nicht, solange es systemische Krisen gibt, wie zum Beispiel den vom Industriekapitalismus erzeugten Klimawandel. Allerdings hat die Kritische Theorie neben Grundsätzlichem selten praktische Vorschläge zur Einrichtung einer vernünftigen Gesellschaft parat. Eine gesellschaftliche Substanz oder ein gesellschaftlicher Akteur, der mit der kritischen Gesellschaftstheorie korrespondiert, ist nicht in Sicht. In meinem Verständnis steht sie heute vor allem für eine ethisch-humanistische Haltung zur Welt, die es politischen Subjekten, die per definitionem über Reflexionsvermögen, ein Sensorium für Ambivalenzen und Nichtidentisches verfügen, ermöglicht, sich kritisch zu orientieren und Resilienz gegen Verdummungszusammenhänge aufzubauen. Das bedeutet aber auch: Man muss aus dem großen K wieder ein kleines k machen, wie Horkheimer es einst vorgeschlagen hatte. Vielleicht wird seine und Adornos Flaschenpost ja eines Tages wieder entkorkt.
Der Beitrag basiert auf „Adornos Erben. Eine Geschichte aus der Bundesrepublik“, dem jüngsten Buch des Autors, das soeben im Suhrkamp Verlag erschienen ist.
[1] Horkheimer an Adorno, 9.11.1949, in: Theodor W. Adorno und Max Horkheimer, Briefwechsel 1927-1969, hg. von Christoph Gödde und Henri Lonitz, Bd. 3: 1945-1949, Frankfurt a.M. 2005, S. 313.
[2] Vgl. Wolfram Schütte, „Nachwort“, in: ders. (Hg.), Adorno in Frankfurt. Ein Kaleidoskop mit Texten und Bildern, Frankfurt a.M. 2003, S. 409-414, hier S. 413.
[3] So Dan Diner im Gespräch mit dem Verfasser im Juli 2019.
[4] UBA FfM Na 60, 145: Manfred Frank an Habermas, 17.12.1990.
[5] Eine Ausnahme bildete die „Computerstudie“. Siehe das Kap. „Linke Sozialforschung und Soziologie für Manager“ in „Adornos Erben. Eine Geschichte aus der Bundesrepublik“, S. 212-240.
[6] Jürgen Habermas, Kritische Theorie und Universität, in: ders., Eine Art Schadensabwicklung. Kleine Politische Schriften VI, Frankfurt a.M. 1987, S. 57-63, hier: S. 58 f.