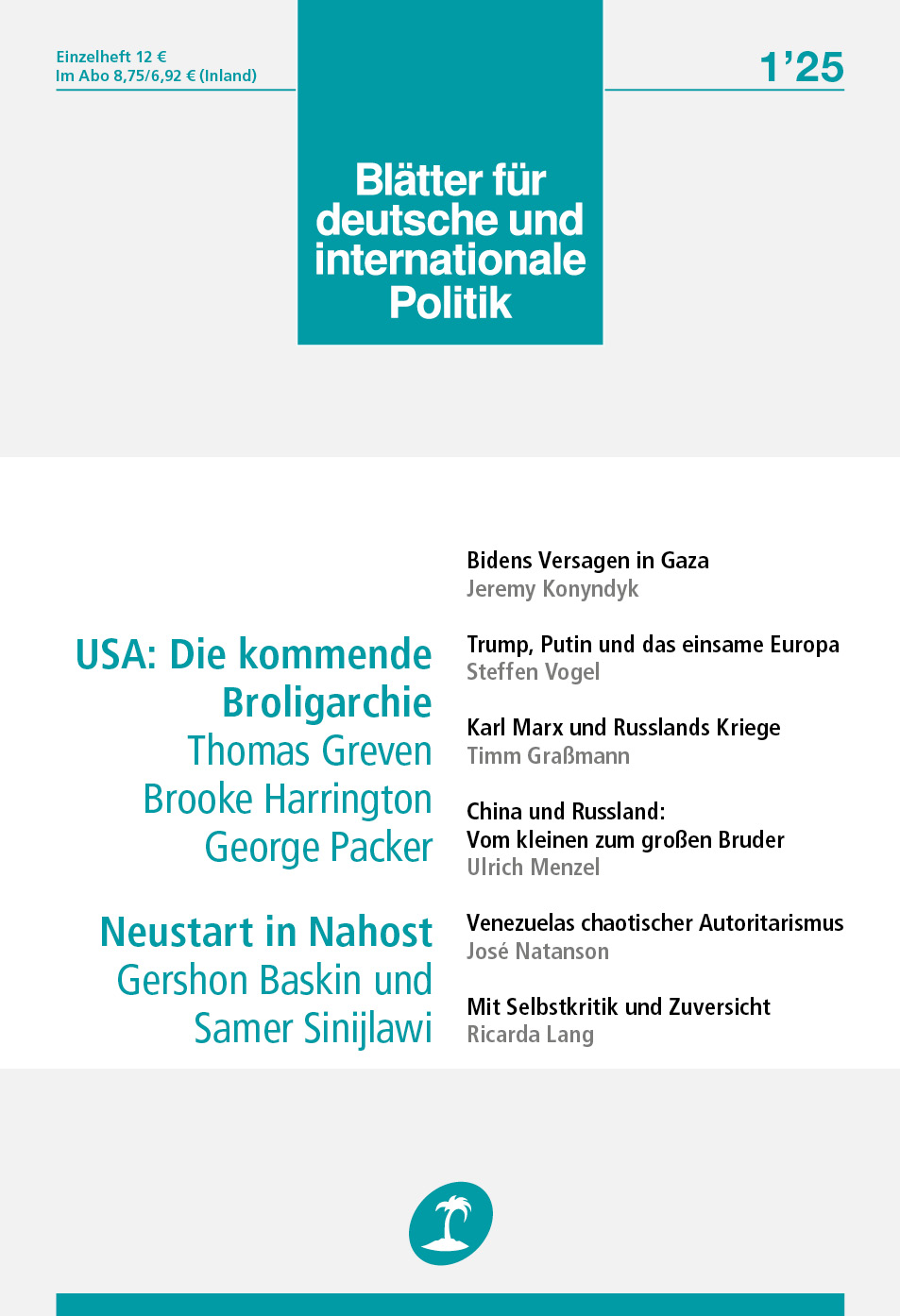Wie Karl Marx Russlands Krieg gegen die Ukraine betrachten würde
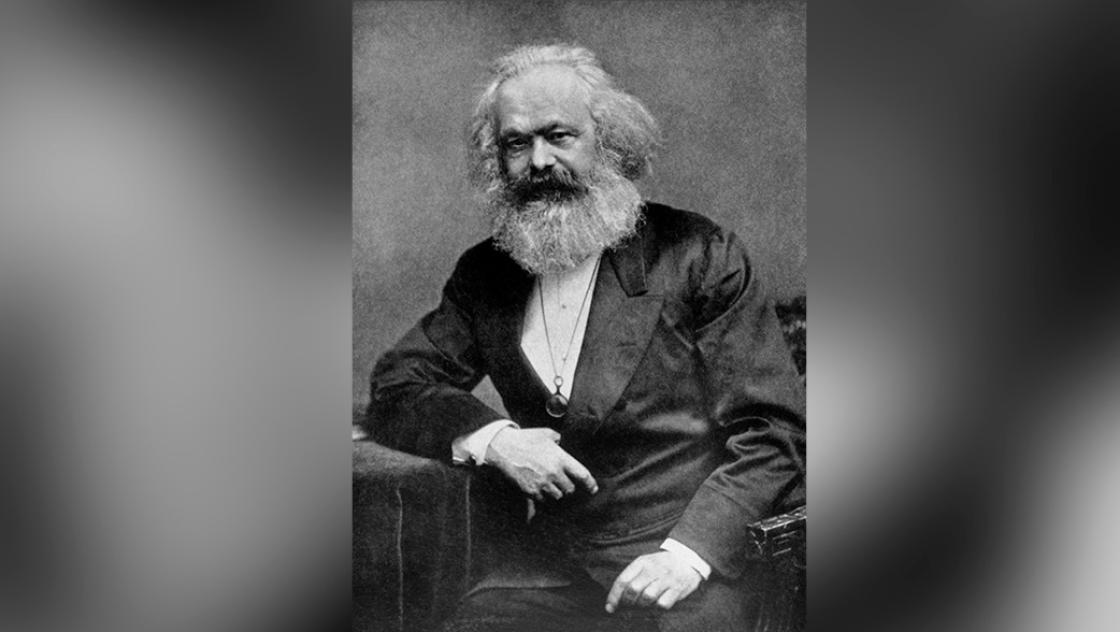
Bild: Karl Marx (1818-1883) auf einem Druck aus dem Jahre 1899 (IMAGO / Georgios Kollidas / Design Pics)
Über weniges gehen die Meinungen innerhalb der Linken in Deutschland, aber auch in ganz Europa, so sehr auseinander wie über Russlands Angriff auf die Ukraine. Die einen sehen in ihm russischen Revisionismus am Werk, zur Wiederherstellung einstiger imperialer Größe, die anderen in vermeintlich materialistischer Tradition einen Stellvertreterkrieg im Dienst der imperialistischen Ambitionen der Vereinigten Staaten. Gemeinsam war den verschiedenen Lagern nur die Erschütterung darüber, dass es am 22. Februar 2022 tatsächlich zu diesem großen Eroberungskrieg gekommen ist. Für ihren Stichwortgeber Karl Marx hingegen wäre dies alles andere als eine Überraschung gewesen. Marx rang sein Leben lang mit dem eigentümlichen Expansionismus der russischen Autokratie und dachte über Mittel nach, mit denen man diesen einhegen könnte.
Keine Freiheit in Europa ohne die Unabhängigkeit Polens
Am 22. Januar 1867 wurde in der Londoner Cambridge Hall mit einer öffentlichen Veranstaltung des polnischen Aufstands von 1863 gedacht. Mit dem Aufstand reagierten die Polen darauf, dass ihre Republik von ihren Nachbarn ausgelöscht worden war. Dieser hatten sie 1791 eine auf Rousseaus Idee der Volkssouveränität und Montesquieus Prinzip der Gewaltenteilung beruhende Verfassung gegeben, doch in Antwort auf ihre demokratischen Bestrebungen teilten sich die drei Autokratien Russland, Preußen und Österreich die Rzeczpospolita untereinander auf und schlugen das annektierte Territorium ihren eigenen Staatsgebieten zu. Ein in der damaligen Geschichte Europas „beispielloser Gewaltakt“.[1]
Mit den drei Teilungen war Polen-Litauen, ein jahrhundertelang mitten in Europa bestehender Staat, von der Landkarte gestrichen worden. Die Polen versuchten, sich ihrer Unterdrückung gewaltsam zu entledigen und die Besatzer aus dem Land zu werfen, doch letztlich verfehlten ihre Aufstände allesamt dieses Ziel. Nach dem Scheitern der jüngsten, gegen die russische Teilungsmacht gerichteten Erhebung, die von den Truppen des Zaren kompromisslos niedergeschlagen wurde und die für Zehntausende Aufständische Hinrichtung oder Zwangsarbeit und Deportation nach Sibirien bedeutete, erließ die zaristische Regierung eine Reihe von Russifizierungsgesetzen, welche die polnische (wie auch die litauische und ukrainische) Sprache unterdrückten und Reste der politischen Autonomie Warschaus beseitigten.
Zur Londoner Gedenkveranstaltung am vierten Jahrestag des Aufstands hatten zwei Organisationen geladen, die aus heutiger Sicht als inkompatibel erscheinen mögen: die Londoner Gemeinde der Vereinigung der Polnischen Emigration, eine Organisation der Exil-Polen mit dem Ziel der Wiederherstellung eines demokratischen polnischen Staats, sowie die Internationale Arbeiterassoziation (kurz: IAA), ein Bund von Arbeitergesellschaften verschiedener Länder, der für die Herstellung einer klassenlosen Gesellschaft eintrat.
Besonders angriffslustig trat ein deutsches Mitglied des Generalrats der IAA auf. In ihrem Tagungsbericht lobte die Redaktion der polnischen Unabhängigkeitszeitung „Głos Wolny“ („Freie Stimme“) später, die Rede des Deutschen sei „voller treffender Einsichten und logischer Überlegungen“[2] gewesen. In seinem Referat unterzog der Redner die russischen Bemühungen zur Zerschlagung Polens einer vernichtenden Kritik. Er sah darin den Ausdruck einer „unveränderbaren“ russischen Politik der territorialen Expansion und der Unterdrückung aller demokratischen Bestrebungen. Den herrschenden Klassen, der Presse und den Sozialisten Westeuropas hielt er vor, sich der russischen Außenpolitik nicht entschlossen genug entgegengestellt und keinen ernsthaften Beitrag zur Restauration eines unabhängigen Polens geleistet zu haben. Diesen „Verrat“ an den Polen würden sie selbst noch unangenehm zu spüren bekommen. Glaubten sie ernsthaft, dass der Zar sich mit jener Scheibe zufriedengeben würde, die er sich gerade wieder aus Polen herausgeschnitten hatte? Warschau wäre nur das Sprungbrett zu weiteren Aktionen Richtung Westen.
Der Redner entließ seine Zuhörer, indem er sie vor eine düstere Wahl stellte: „Vor Europa steht nur eine Alternative. Entweder wird die asiatische Barbarei unter Führung der Moskowiter wie eine Lawine über Europa hereinbrechen, oder es muss Polen wiederherstellen und damit zwanzig Millionen Helden zwischen sich und Asien stellen, um Zeit zu gewinnen für die Vollendung seiner sozialen Erneuerung.“[3] Der Redner war kein Geringerer als Karl Marx.
Dass Marx, der zu dieser Zeit fieberhaft mit der Fertigstellung seines ökonomischen Opus magnum „Das Kapital“ beschäftigt war, prominent auf dem Polenkongress vortrug, kann keinesfalls als Kuriosum verstanden werden. Sein Auftritt war Ausdruck seiner langjährigen Bemühungen um eine eigenständige Außenpolitik der IAA, die für ihn oberste Priorität hatte.
Marx begann sein Referat mit einer beißenden Kritik an der Berichterstattung der englischen Presse. Obwohl es aus dem Westen zwar reichlich emphatische Anteilnahme, aber keine nennenswerte Unterstützung für den polnischen Aufstand von 1863 gegeben hatte, fühlte sich die Tageszeitung „The Times“[4] bemüßigt, zuerst die Unmöglichkeit der polnischen Unabhängigkeit zu einer „Tatsache“ zu erklären und danach zynisch zu eruieren, ob es nicht für alle Beteiligten besser wäre, auf die Versöhnung der Polen mit ihrem „Schicksal“ hinzuarbeiten, anstatt sie in ihrem „hoffnungslosen Kampf“ anzufeuern. Angesichts der jüngsten russischen Beschlüsse zur Abschaffung ihres Staats, setzte Marx ein, habe die „Times“ die Polen aufgefordert, zu Moskowitern zu werden.
Auch unter den herrschenden Klassen im Westen, fuhr er fort, greife die Verblendung um sich. Russlands Vordringen in Asien, wo es immer wieder neue Gebiete eroberte und befestigte, war vorerst „unaufhaltsam“, doch selbst auf die beiden Westmächte Frankreich und England konnte man nicht zählen. Noch deren militärisches Vorgehen im Krimkrieg – bei dem der russische Anspruch auf Konstantinopel zurückgewiesen wurde – führte entgegen ihren Versprechungen zu keiner Verbesserung der Lage der Polen, wohl aber zur russischen Dominanz über den Kaukasus und das Schwarze Meer. Es sei der scheinheiligen Elite wichtiger, dass Moskau seine in der Londoner City aufgenommenen Anleihen pünktlich abträgt, als einer angegriffenen Republik im Osten des Kontinents unter die Arme zu greifen.
Pierre-Joseph Proudhon oder das Versagen der Linken
Aber wie reagierte die Linke im Westen? Würde sie nicht alle Hebel in Bewegung setzen, um der Zerstückelung und Zerstörung einer Republik entgegenzuwirken, die ausgerechnet von den drei reaktionärsten Staaten Europas durchgeführt wurde, welche sich zur „Heiligen Allianz“ zusammengetan hatten, um die alte „Ordnung“ – gestützt auf Kaiserherrschaft, kirchliche Autorität und Klassenprivilegien – am Leben zu halten? Lautete die Losung des polnischen Aufstands von 1830/31 nicht „ Za naszą i waszą wolność“ (Für unsere und eure Freiheit)?
Doch anstatt die polnischen Verdienste um die europäische Arbeiterbewegung anzuerkennen, sprachen führende Sozialisten dem einst größten Land Osteuropas einfach das Existenzrecht ab. Pierre-Joseph Proudhon hatte die Polen angesichts ihres Aufstands von 1863 bezichtigt, zum „Stolperstein der Diplomatie, des Völkerrechts und des Weltfriedens“[5] geworden zu sein. Für Proudhon waren die Polen bloß ein lästiger Störenfried für die „Freiheiten aller Völker“ und den „Frieden Europas“, Dinge, die seiner – für einen selbsterklärten Gesellschaftskritiker merkwürdigen – Auffassung nach offensichtlich schon Bestand hatten. Proudhon zeigte sich einverstanden mit der bestehenden Aufteilung Europas in bestimmte Einflusssphären, welche die aufständischen Polen nur verletzten. Marx brachte auf dem Polenkongress daher eine Resolution ein, die sich wörtlich gegen Proudhons Anschauung richtete. Er stellte unmissverständlich klar: „Dass Freiheit in Europa nicht ohne Unabhängigkeit Polens erlangt werden kann.“[6]
Ohne ein unabhängiges Polen keine Freiheit in Europa. Dies war eine der wichtigsten politischen Überzeugungen von Marx, die er fest im Programm der IAA verankert sehen wollte. Doch dass die Internationale einer nationalen Frage ein derartiges Gewicht einräumen sollte, stieß nicht bei all ihren Mitgliedern auf Zustimmung. Gerade erst war das Marx’sche Anliegen von französischen Sozialisten, die unter dem Einfluss Proudhons standen, sabotiert worden. Die Proudhonisten behaupteten, dass für die IAA nur die Klassenfrage und ökonomische Dinge von Belang seien und dass es sich bei der Polenfrage um eine „rein politische Frage“ handeln würde. Um das sozialistische Lager von der polnischen Sache zu überzeugen, erinnerte Marx in seiner Kongressrede daran, dass 1830 Pläne in St. Petersburg existiert hatten, in die Julirevolution in Frankreich zu intervenieren, die allein durch einen polnischen Aufstand vereitelt wurden. Auch in der europaweiten Revolution von 1848, als sogar in deutschen Städten Barrikaden errichtet worden waren, war es der Aufstand in der Provinz Posen, der Russland zunächst in Schach hielt. Erst nachdem die Nationalversammlung in der Frankfurter Paulskirche einen Antrag, der die Wiederherstellung Polens zur deutschen Pflicht erklären wollte, mit überwältigender Mehrheit ablehnte und preußische Truppen den Aufstand niederschlugen, hatte der Zar freie Hand, seine Truppen in Ungarn einmarschieren zu lassen, um dort militärisch gegen die Revolution vorzugehen. „Die soziale Revolution, was bedeutet sie anderes als Klassenkampf?“, wies Marx in seiner Rede auf eine seiner wichtigsten gesellschaftstheoretischen Einsichten hin. Weil jeder Aufstand einem externen Aggressor die Tür öffne, müsse gerade die Partei der Revolution auf der Hut vor einer russischen Intervention sein. Gerade sie habe sich daher für ein unabhängiges Polen einzusetzen.
Das »heilige Russland« als »Gendarm Europas« gegen die Revolution
Denn das autokratische Russland hatte sich nicht einfach nur seit vielen Jahrhunderten unentwegt darum bemüht, sein Staatsterritorium in alle möglichen Himmelsrichtungen zu erweitern, sondern spätestens seit der Französischen Revolution hatte es auch eine regelrechte Revolutionsphobie entwickelt und begonnen, sich als „Retter der Ordnung“ aufzuspielen. Um zu verhindern, dass die Revolution jemals bei sich zu Hause ankommt, zog das „heilige Russland“ aus, sie im Ausland zu besiegen, und war der „Gendarm Europas“ geworden. Die Welt von dekadenten Ideen zu befreien und den Aufstieg der Arbeiterklasse zu unterbinden, ließ Marx seine Zuhörer in der Cambridge Hall wissen, würde es jederzeit zum Anlass nehmen, einen neuen Anlauf zu seinem traditionellen außenpolitischen Ziel zu unternehmen – der Errichtung eines weltumspannenden Imperiums: „[D]ie Politik Russlands ist unveränderlich, wie ihr offizieller Historiker, der Moskowiter Karamsin, beteuert. Ihre Methoden, ihre Taktik, ihre Manöver mögen sich ändern, aber der Leitstern ihrer Politik ist ein Fixstern – das Weltimperium. […] Polen ist das große Werkzeug für die Ausführung der weltumfassenden Pläne Russlands, aber auch sein unüberwindliches Hindernis.“[7] Bliebe nur zu hoffen, so Marx, dass die Polen ihren Kampf, ermüdet vom akkumulierten Verrat Europas, nicht eines Tages aufgeben würden. Ernüchtert fügte er hinzu: „Ist nun, abgesehen von der Haltung des polnischen Volkes, irgendetwas geschehen, das die Pläne Russlands durchkreuzt oder sein Handeln paralysiert hätte?“
Eine Kritik der „unveränderbaren“ russischen Politik taucht in beinahe allen großen Texten von Marx auf. Im „Manifest der Kommunistischen Partei“ (1848) wird neben dem Papst auch der Zar in die vom Gespenst des Kommunismus aufgeschreckte Ahnenreihe der „Mächte des alten Europa“ aufgenommen. In der „Inauguraladresse“ der IAA (1864) bilanzierte Marx, dass „der schamlose Beifall, die Schein-Sympathie oder idiotische Gleichgültigkeit, womit die höheren Classen Europa’s dem Meuchelmord des heroischen Polen und der Erbeutung der Bergveste des Kaukasus durch Rußland zusahen“[8], die Arbeiterklasse die Notwendigkeit einer eigenständigen Außenpolitik gelehrt hätten. Auch im ersten Band des „Kapital“ (1867) steht schwarz auf weiß, dass Russland 1828/29, unter dem „Beifallsklatsch des liberalen Cretinismus von ganz Europa“[9], versuchte, sich Teile der Donaufürstentümer Moldau und Walachei unter den Nagel zu reißen, und die dortigen Ausbeutungsverhältnisse massiv verschärfte. Und in „The Civil War in France“ (1871) genügte es Marx nicht, Adolphe Thiers als den Schlächter der Pariser Commune anzuprangern, er musste noch hinzufügen, dass Thiers in seiner politischen Laufbahn zwar viele warme Worte für die polnische Sache übrighatte, in Wirklichkeit aber „die Drecksarbeit für Russland“[10] erledigt und die Polen verraten hatte.
Die Teilungen Polens, die wiederkehrende Okkupation der Donaufürstentümer, die Kolonisierung Zentralasiens, die schleichende Eroberung des Kaukasus: Marx ließ keine Gelegenheit aus, um auf Russlands jüngste Annexionen, die katastrophalen Auswirkungen seiner Militärbesatzung auf die betroffene Bevölkerung und die Widerstandslosigkeit, mit der es agieren konnte, zu thematisieren. Die äußere Bewegung des russischen Staats sah er durch die gleiche abstrakte Selbstbezüglichkeit wie das Kapital charakterisiert: Basierend auf der Ausbeutung und Versklavung seiner Untertanen, ruht sie nicht in sich selbst, sondern sucht sich mit Hilfe gewaltsamer Übergriffe zu erweitern. Engels brachte diesen maßlosen Prozess auf die Formel: „Auf Annexion folgt Annexion.“ Wie dem Kapital müsse man der traditionellen russischen Außenpolitik eine Grenze setzen, damit man sie eines Tages überwinden könne.
Die halbasiatische Autokratie
Es steht außer Zweifel, dass man von einem an Marx orientierten Standpunkt aus heute die Ukraine leidenschaftlich und mit voller Kraft unterstützen muss. Viele, die sich auf ihn berufen, stehen allerdings in großer Nähe zur Position Proudhons. In politischen Fragen sehen die selbsterklärten Marxisten wie ihre angeblich schlimmsten Gegner aus: wie Proudhonisten. Zwar war Marx tatsächlich kein Marxist, allerdings ist seine Auffassung in den letzten Jahren auch wenig bekannt gemacht worden. Durch editorische Entscheidungen wurde sie gar absichtlich unterdrückt, etwa durch die Auslassung seiner fulminanten Artikelserie zur Geschichte der russischen Autokratie, den „Revelations of the Diplomatic History of the 18th Century“, aus der deutschen Ausgabe der (im sowjetischen Moskau konzipierten) „Marx-Engels-Werke“. Was steckte hinter Marx’ vehementer Befürwortung eines unabhängigen Polens? Warum hatte er gerade der russischen Autokratie so sehr den Kampf angesagt?
Seine Position war keinesfalls Ausdruck einer Slawo- oder Russophobie oder orientalistischer Vorstellungen eines ewig unaufgeklärten „Ostens“. Es handelte sich vielmehr um eine Gegnerschaft zu einer politischen Form, die im 14. Jahrhundert in Moskau entstanden war und einen Expansionismus ausbildete, der Russland zu jenem Reich von ungeheurem Ausmaß werden ließ, das beständig und konsequent danach strebt, seine politische Herrschaft über einen noch größeren Raum auszudehnen. Da das Problem 140 Jahre nach Marx’ Tod noch immer (oder wieder) besteht, scheinen die heutigen Kollektivphantasien, wonach Putin eine Art Wiedergänger Hitlers („Putler“) oder Stalins[11] sei, zu kurz zu greifen. Die Debatte krankt an einem schwachen Langzeitgedächtnis. Auf Putins Hirn lastet der Alb der außenpolitischen Tradition des Zarismus[12], die Marx beinahe vierzig Jahre lang beobachtet und untersucht hat, und zwar in der festen Überzeugung, sie konfrontieren zu müssen.
Den Ursprung der russischen Autokratie und ihrer planmäßigen Eroberungspolitik sah Marx noch vor der Entstehung des Kapitalismus. Er lag vielmehr in der „asiatischen Produktionsweise“. Diese galt ihm – neben der antiken, der feudalen und der kapitalistischen Produktionsweise – als eine der besonderen Produktionsformen, welche die Menschheit bislang hervorgebracht hat. In der „asiatischen“ Form der gesellschaftlichen Beziehungen erhebt sich ein despotischer Staat, ausgestattet mit einer bürokratischen Klasse und einer starken Armee, über eine atomisierte, inaktive, zur gemeinsamen Aktion unfähige Gesellschaft aus voneinander isolierten Produzenten und presst deren Surplusarbeit durch exzessive Besteuerung ab. Die asiatische Produktionsweise darf nicht mit der feudalen verwechselt werden. Anders als im Feudalismus bestehen hier unter den Produzenten etwa Formen des Gemeineigentums. Die einzelnen (Dorf-)Gemeinden sind direkt dem Staat unterworfen, der als „Eigentümer“ und Ausbeuter seiner Untertanen auftritt und eine politische Willkürherrschaft ausübt, die jede Form von Selbstorganisation brutal unterdrückt. Zwar übernimmt der Staat mitunter den Bau einer öffentlichen Infrastruktur (wie Bewässerungsanlagen), aber die wirtschaftliche Entwicklung ist typischerweise militärischen Zielen untergeordnet. Der fiskalische Apparat zur Plünderung des Inlands findet seine Ergänzung in der Kriegsmaschine zur Plünderung des Auslands. Da es weder im Staat noch in der Gesellschaft andere Machtzentren gibt, welche die zentralisierte Gewalt begrenzen würden, übt der Staat, wie Karl August Wittfogel betonte, „totale Macht“ aus und ist in diesem Sinne „stärker als die Gesellschaft“.[13]
Wenn Marx das Zarenreich ab und an als „asiatisch“ oder „halbasiatisch“ bezeichnete, dachte er daran, dass Russland diese Produktionsform mitsamt seines verselbständigten, stark zentralisierten und ungehemmten Staatsapparats von seinen mongolischen Invasoren im 14. Jahrhundert geerbt hatte. Die Mongolen gelten als die „größten Eroberer aller Zeiten“; Moskau hat von ihnen gelernt. Die Herrscher des Fürstentums Moskau, die sich ab 1547 Zaren nannten, hatten sich an die Stelle ihrer mongolischen Herren gesetzt und deren Herrschaftsmodell und Gesellschaftsstruktur übernommen. Ein neues Imperium wuchs so auf den Ruinen am Rande des alten heran. Zugleich machte Marx auf die so systematische wie unvollständige Modernisierung dieses Staatsapparats unter Peter dem Großen zu Beginn des 18. Jahrhunderts aufmerksam. Das russische Streben nach einem weltumgreifenden Imperium vermählte sich mit Elementen der modernen Gesellschaft.
Für Marx war daher das Verhältnis zwischen Russland und dem Westen zentral. Anders als heutige liberale Historiker erzählen, sind die Westmächte weder unschuldig vor sich hin geschlafwandelt noch betreiben sie seit 300 Jahren eine kluge Containmentpolitik. In seiner Publizistik zum Krimkrieg (1853–56) wunderte sich Marx vielmehr darüber, dass der Westen mit diplomatischen Noten, nicht mit Kanonenbooten auf die russische Aggression antworten wollte und keine Anstrengungen zur Wiederherstellung Polens unternahm. Allerdings war Russlands Vorgehen für Marx auch keine Reaktion auf einen westlichen „Imperialismus“, wie es heutige Linke gern glauben wollen. Marx charakterisierte die westliche Politik stattdessen als russlandhörig. Trotz ihrer propolnischen Rhetorik handelten die Westmächte immer wieder auf die raffinierteste Weise für Russland. Der Westen war entgegen seinem Selbstverständnis keinesfalls ein Garant von Demokratie und Freiheit in der Welt, vielmehr „Rußlands mächtigstes Werkzeug“.[14] Dass die westliche Politik Europa an Russland verkaufte, musste sie vor den Augen der Welt blamieren. In ihrer Schmach witterte Marx eine Chance für seine Partei der Revolution. Den „Verrat“ des Westens führte Marx nicht auf handfeste ökonomische Interessen zurück; der russlandfreundliche Geist der westlichen Diplomatie ist daher auch nicht zwingend notwendig. Gleichwohl sah er gute Gründe für ihn. Größer als die Sympathien für den „Gendarm Europas“ und sein autoritäres Herrschaftsmodell und größer als die Unterwanderung durch russische Agenten ist im Westen nur noch die Angst vor gesellschaftlichen Veränderungen, die noch jeden Versuch verhindert, das russische Phantom zu stellen. So wie sich die Moskauer Großfürsten ihrer mongolischen Herren bedienten, um sich von deren Unterdrückung zu lösen, behauptet Marx, dass das moderne Russland den Westen als Werkzeug benutzt, um eine Macht auszuüben, die es selbst nicht besitzt. Moskau zehrt von einer fremden Kraft, die es durch Manipulation für seine eigenen Vorhaben zu nutzen und schließlich zu Fall zu bringen sucht.
Heute Kyjiw, damals Nowgorod
Marx‘ Beschreibung des machiavellistischen Charakters, den der russische Kampf um die Macht infolgedessen annimmt, liest sich heute wie eine Charakteristik des putinistischen Staats. Es ist nicht erst ein seltsames sowjetisches „Geheimdienstdenken“ in Putins Kopf, sondern eine viel ältere diplomatische Tradition der Manipulation. Das Feld der Diplomatie ist die eigentliche Stärke Russlands.[15] Auf eine solche Weise emanzipierte sich Marx zufolge Moskau unter Ivan III. von der mongolischen Herrschaft. Ivan vollbrachte weder eine Innovationsleistung noch erhob er sich in einem gewaltsamen Aufstand: „So eroberte er die Macht nicht, sondern erschlich sie.“[16]
Symptomatisch war das finale Vertreiben der Mongolen im Jahr 1480 durch das sogenannte „Stehen an der Ugra“: Aus bis heute nicht eindeutig geklärten Gründen – laut Marx streuten die Moskowiter Gerüchte über die überwältigende Größe einer mit ihnen verbündeten Armee –, traten die Mongolen nicht zur Schlacht an und gaben damit ihre beinahe 250 Jahre währende Herrschaft über die Erblande der Kyjiwer Rus kampflos auf.
Es wäre ein Irrtum zu glauben, Marx hätte „Russland“ an sich als prinzipiell autokratisch, unfrei und manipulativ essentialisiert. Eine solche politische Kultur, eine solche Tradition der Machtausübung bildete sich allein im historischen Moskau heraus. Dieses allerdings begann sich auszubreiten und die bestehenden demokratischen Traditionen in Russland zu zerschlagen und fortan zu unterdrücken.
Zu den zahlreichen politischen Einheiten der Kyjiwer Rus zählte etwa die autonome Republik Nowgorod, deren „Traditionen, Politik und Bestrebungen denen des modernen Rußlands so zuwiderliefen, daß das eine nur auf den Ruinen des andern begründet werden konnte“.[17] Moskau zerstörte die große Republik Nowgorod und verleibte sich ihr Territorium, das vom Arktischen Ozean bis zum Ural reichte, vollständig ein. Keine Spur von Demokratie und Freiheit kann der zum Herren gewordene Sklave neben sich dulden, wie Marx in einem atemberaubenden Vergleich der Zerschlagung Nowgorods, des ukrainischen Hetmanats und der polnisch-litauischen Rzeczpospolita betont: „Es bleibt noch immer bemerkenswert, wieviel Sorgfalt das Moskauer Reich sowie auch das moderne Rußland stets darauf verwendet haben, Republiken zu vernichten. Nowgorod und seine Kolonien führten den Reigen an, die Kosakenrepublik folgte, Polen schließt ihn ab. Um zu verstehen, wie Rußland Polen zerfleischte, betrachte man die Zerstörung Nowgorods, die von 1478 bis 1528 dauert.“[18]
Die Moskowiter plünderten, folterten und mordeten in Nowgorod, zwangsumsiedelten seine Bevölkerung und zerstörten seine demokratischen Institutionen, die Veče (Stadtversammlung) und den Posadnik (gewählter Bürgermeister). Die Glocke, welche die Veče zu ihren Sitzungen einberief, wurde demontiert und nach Moskau gebracht. Wie Nowgorod (1478) erging es unter anderem dem Fürstentum Twer (1485) und der Republik Pskow (1510): Eroberung durch Moskau, Eingliederung seines Territoriums, Neuverteilung des Landes unter moskautreue Bojaren, teilweise Zwangsumsiedlung seiner Bevölkerung, Verlust seiner politischen Unabhängigkeit. Inwiefern sich die russische Autokratie seit ihrer scharfsinnigen Analyse durch Marx – also im Laufe des 20. Jahrhunderts – transformiert hat, ist Gegenstand einer reichen Literatur. Unbestritten ist eines: dass sie nach wie vor existiert. Diese „Kontinuität der Autokratie“ ist innerlich geknüpft an eine andere „Konstante russischer Geschichte: die Reichsbildung durch Expansion“.[19] Mit einer Großinvasion in das Nachbarland einzufallen, um die dortige Republik zu zerstören und es von Moskau aus zu kontrollieren, dann (nach Misslingen des ursprünglichen Plans, die Ukraine ihrer Unabhängigkeit zu berauben) Annexionen ukrainischen Territoriums anzustreben – das alles erscheint insofern als eine einfache Reaktivierung der bereits von Marx beschriebenen „traditionellen auswärtigen Politik Russlands“.
Den Kritikern seiner Russland-Publizistik erschien Marx als unmaterialistisch, idealistisch und verschwörungstheoretisch. In der Tat sah Marx das Geschehen seiner Zeit auch durch Machtpolitik, Korruption, Erpressung und Intrige zustandekommen. In Moskau bildete sich eine eigenständige politische Tradition aus, deren Ursprung im mongolischen Imperium und nicht im Imperium des Kapitals lag. Nicht die ganze Welt lässt sich aus den „materiellen Interessen“ einer herrschenden Klasse, einer „Logik des Kapitals“ oder daraus erklären, dass in einer „Totalität“ alles miteinander zusammenhängt. Marx betrachtete den russischen Staat schlicht als das, was er war: ein Phänomen der Politik.
Der Beitrag basiert auf Auszügen aus dem neuen Buch des Autors, „Marx gegen Moskau. Zur Außenpolitik der Arbeiterklasse“, das soeben in der Reihe BLACK BOOKS im Schmetterling Verlag erschienen ist.
[1] Andreas Kappeler, Russland als Vielvölkerreich. Entstehung, Geschichte, Zerfall, München 1992, S. 70.
[2] Zit. nach Marx-Engels-Gesamtausgabe (im Folgenden MEGA), Band I/20, S. 1282.
[3] Karl Marx, Draft for a Speech at the Polish Meeting in London, in: MEGA I/20, S. 247. (Übersetzung der fremdsprachigen Zitate hier und im Folgenden T.G.)
[4] Vgl. „The Times“, 7.1.1867, S. 6.
[5] Pierre-Joseph Proudhon, Si les Traités de 1815 ont cessé d’exister? Actes du futur congrès, Paris 1863, S. 64.
[6] Karl Marx, Draft for a Speech at the Polish Meeting in London, in: MEGA I/20, S. 243.
[7] Ebd., S. 245.
[8] Karl Marx, Manifest an die arbeitende Klasse Europas, in: MEGA I/20, S. 25.
[9] Karl Marx, Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie, Bd. 1, in: MEGA II/5, S. 183.
[10] Karl Marx, The Civil War in France, in: MEGA I/22, S. 146.
[11] Putin wolle „die Sowjetunion wiederherstellen“, urteilte US-Präsident Biden im Februar 2022.
[12] Auf die Frage eines verblüfften Oligarchen, wie Putin denn eine so gewaltige Invasion in einem so kleinen Kreis hatte planen können, ohne dass die meisten hochrangigen Beamten des Kremls es für möglich gehalten hätten, antwortete Außenminister Lawrow: „Er hat nur drei Berater. Ivan der Schreckliche, Peter der Große, Katharina die Große.“ („Financial Times“, 23.2. 2023)
[13] Karl A. Wittfogel, Die orientalische Despotie. Eine vergleichende Studie totaler Macht, Köln, Berlin 1962.
[14] Karl Marx, Enthüllungen zur Geschichte der Diplomatie im 18. Jahrhundert, übersetzt von Elke Jessett und Iring Fetscher, herausgegeben und eingeleitet von Karl August Wittfogel, Frankfurt a. M. 1981, S. 134.
[15] „Wo immer die russische Diplomatie auf die englische und französische trifft, ist sie durchweg erfolgreich.“ (Karl Marx und Friedrich Engels, Russia in China, in: MEGA I/16, S. 470.)
[16] Karl Marx, Enthüllungen zur Geschichte der Diplomatie im 18. Jahrhundert, S. 115.
[17] Ebd., S. 107.
[18] Ebd., S. 121.
[19] Dietrich Geyer, Das russische Imperium. Von den Romanows bis zum Ende der Sowjetunion, herausgegeben von Jörg Baberowski und Rainer Lindner, Berlin und Boston 2020, S. 8.