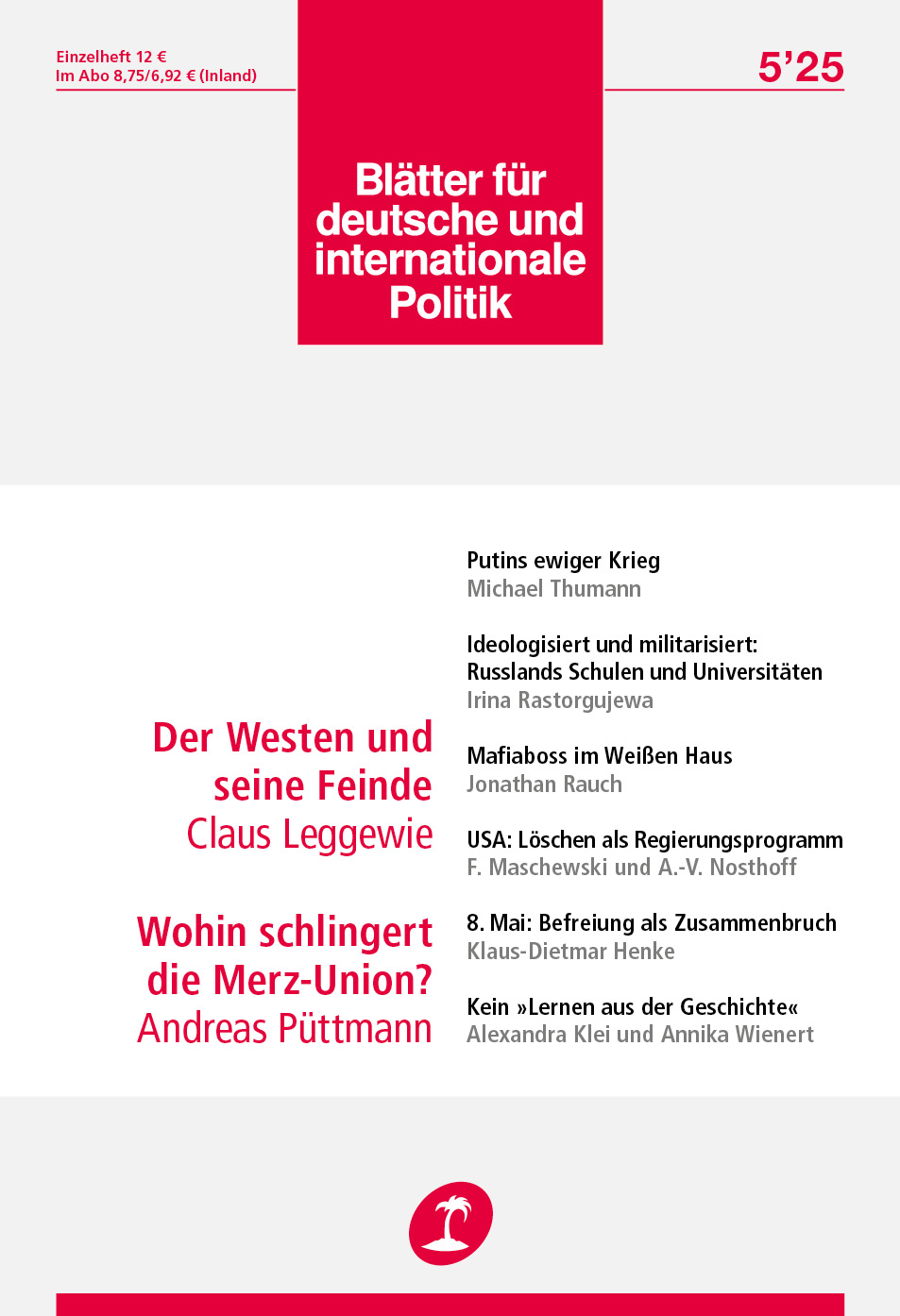Bild: Fliegen gehört in Deutschland mittlerweile zur sozialen Norm, obwohl die Klimaschäden durch den Flugverkehr bekannt sind. (IMAGO / imagebroker)
Fliegen gehört in Deutschland mittlerweile zur sozialen Norm, obwohl die Klimaschäden durch den Flugverkehr bekannt sind. Anhänger der Grünen fliegen sogar mehr als der Durchschnitt der Deutschen. Kathrin Boehme und Carolin Maaßen plädieren deshalb dafür, das Fliegen nicht nur teurer zu machen und klimafreundliche Transportalternativen auszubauen, sondern fordern auch einen Mentalitätswechsel.
Jahrhundertfluten, Waldbrände und Dürren gehören inzwischen zur neuen Normalität in einer sich erhitzenden Welt. 2024 war das wärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Dennoch setzen die Staaten Klimaschutzmaßnahmen nur schleppend um. Besonders beim Flugverkehr, der weltweit für rund fünf Prozent der globalen Erwärmung verantwortlich ist, scheint der Status quo unverrückbar.
Dabei ist kein anderes Verkehrsmittel so klimaschädlich wie das Flugzeug. Ein Hin- und Rückflug von Frankfurt am Main nach New York stößt mit 3652 Kilogramm pro Person deutlich mehr CO2 aus, als mit einem Mittelklassewagen 12 000 Kilometer Auto zu fahren (2000 Kilogramm).1 Dazu kommen gesundheitliche Folgen: Studien zeigen, dass Menschen, die in der Nähe von Flughäfen wohnen, durch Partikel und Lärmbelästigung einem höheren Risiko für Krankheiten wie Demenz, Bluthochdruck und Diabetes ausgesetzt sind.2 Allein in Deutschland sterben jährlich rund 43 000 Menschen aufgrund von Luftverschmutzung. Trotz all der negativen Konsequenzen des Fliegens wird die Flugindustrie steuerlich massiv bevorteilt und Kerosin nicht besteuert. Damit entgehen Deutschland Milliarden Euro an Einnahmen: Wie das Umweltbundesamt berechnete, hätte eine Kerosinsteuer bei 65,5 Cent pro Liter im Jahr 2018 über acht Mrd. Euro einbringen können. Zusätzlich werden internationale Flüge auch noch von der Mehrwertsteuer befreit.3 Die wahren Kosten einer Flugreise spiegelt der Ticketpreis also gar nicht wider. Durch die fehlende Kerosinsteuer und klimaschädliche Subventionen für die Flugindustrie werden die Preise künstlich niedrig gehalten. Hinzu kommen weitere verborgene Kosten des billigen Fliegens: Menschen, die unter schlechten Arbeitsbedingungen in der Flugbranche oder unter den direkten Folgen der Klimakrise leiden. Müssten Fluggesellschaften für ihre negativen Auswirkungen aufkommen, wäre das Fliegen deutlich teurer. Nach Berechnungen der Politikberatungsfirma CE Delft würde der Ticketpreis eines Fluges von Amsterdam nach Paris bei Einbeziehung aller Kosten um rund 25 Prozent ansteigen. Eine Flugreise von Amsterdam nach Los Angeles würde sogar 85 Prozent mehr kosten.4 Diese Preisverzerrung verschafft der Flugindustrie Vorteile gegenüber klimafreundlicheren Alternativen: Denn natürlich wählen Menschen aufgrund der oft günstigeren Preise auch bei kürzeren Distanzen eher den Flieger als die Bahn. Während also die Fluggesellschaften die Profite privatisieren, werden die negativen Folgen und Kosten des Fliegens auf die Allgemeinheit und künftige Generationen abgewälzt.
Angesichts dessen werden Preiserhöhungen immer wieder diskutiert. Manche Ökonominnen und Ökonomen hoffen auf die Lenkungswirkung von Preisen, um Anreize für nachhaltiges Konsumverhalten zu schaffen. Doch auch wenn steigende Flugpreise erst einmal vielversprechend klingen, führen sie nicht unbedingt zum Ziel. Denn es fliegen hauptsächlich die wohlhabenderen Schichten, die sich im Schnitt drei Langstreckenflüge pro Jahr leisten. Ärmere Menschen fliegen dagegen im Schnitt nur alle fünf Jahre und tragen deutlich weniger zu den Emissionen bei. Global ist der Unterschied noch größer: 2019 sind nur 20 Prozent der Weltbevölkerung überhaupt geflogen, während die Zahl an Privatjetflügen rasant ansteigt: So verzeichnete Deutschland 2022 die Rekordzahl von 94 000 Starts, die etwa zehn Mio. Tonnen CO2 freisetzten.5 Bei moderat steigenden Preisen würden sich daher aller Voraussicht nach vor allem bestehende soziale Ungleichheiten vertiefen – während Wohlhabende moderate Preiserhöhungen wegstecken könnten und einfach weiterhin fliegen würden, könnten sich Ärmere noch seltener als bisher einen Flug leisten. Insgesamt würden sich die Emissionen voraussichtlich kaum verringern.
Eine Verhaltensänderung bei Wohlhabenden würden nur drastische Preissteigerungen bewirken. Die aber sind nicht zu erwarten, schließlich sind Politik und Wirtschaft nach wie vor dem Glauben verhaftet, dass die Flugbranche weiter wachsen und konkurrenzfähig bleiben soll und das mit den Klimazielen vereinbar sei – was im Widerspruch zu den Erkenntnissen der Wissenschaft steht. Nachhaltiges Kerosin ist und bleibt ein ferner Traum von Technikoptimisten.
»Bei moderat steigenden Preisen würden sich vor allem bestehende soziale Ungleichheiten vertiefen.«
Wie empfindlich die Flugbranche allein auf kleine Veränderungen der für sie günstigen Rahmenbedingungen reagiert, zeigte sich zuletzt, als die Bundesregierung die Steuer auf Flugtickets im Mai 2024 leicht anhob. Als Reaktion darauf kündigte Ryanair an, ab diesem Sommer 22 Strecken von und nach Deutschland zu streichen, und auch die Lufthansa warnt vor einer Reduzierung ihres Angebots. In ihren Augen behindert die Steuer die Erholung der Branche.
Diese allerdings boomt wieder: Nach dem pandemiebedingten Einbruch sind die Prognosen für den Luftverkehr in Europa gut, nicht aber für das Klima: Bis zum Jahr 2050 könnten die CO2-Emissionen aus Flugverkehr sogar um rund 60 Prozent zunehmen.6 Dass es so schwer ist, den Status quo zu verändern, hat vor allem damit zu tun, dass Fluggesellschaften massiv gegen Klimaschutz lobbyieren. Die fünf größten europäischen Airline-Verbände sowie die Flugzeugbauer Boeing und Airbus geben jährlich rund sieben Mio. Euro für Lobbying aus.7 Ihre Strategie ist einfach: Öffentlich begrüßen sie Klimaneutralität bis 2050, widersetzen sich aber gleichzeitig allen Klimaschutzmaßnahmen für den Luftverkehr. Gleichzeitig investieren die Unternehmen in PR- und Werbekampagnen, um ihre Marken mit Klimaschutz in Verbindung zu bringen.
Die wohl relevanteste Strategie ist dabei das „Carbon-Offsetting“, die Förderung von Kompensationen anstelle einer echten Reduzierung der Treibhausgase. Dabei werden gezielt Kosten und Verantwortung für Klimaschutzmaßnahmen von der Industrie auf die Verbrauchenden abgewälzt. Jede und jeder kann bei der Buchung selbst entscheiden, ob der „grünere” Flug gewählt wird und sie einen Baum pro Flugmeile pflanzen wollen. So entledigen sich die Unternehmen nicht nur der Folgekosten des Fliegens, sondern entziehen auch der um sich greifenden Flugscham ihre Grundlage. Denn diese – und das mit ihr verbundene Wissen um die negativen Auswirkungen des Fliegens – ist es, die Menschen dazu bewegen kann, ihr Konsumverhalten zu überdenken.
In den vergangenen Jahrzehnten ist das Fliegen mehr und mehr zur Normalität geworden. Durch die niedrigen Preise können sich immer mehr Menschen eine Flugreise leisten. Zwar sind die Preise durch die Energiekrise zuletzt leicht gestiegen, aber immer noch weit davon entfernt, die wahren Kosten widerzuspiegeln. Und gerade nach den Einschränkungen der Coronapandemie möchten sich viele Menschen nichts mehr verbieten lassen – auch nicht das Fliegen.Angefeuert wird das Bedürfnis nach Urlaubsreisen zudem durch Werbung und die sozialen Medien. Viele Influencerinnen und Influencer leben eine Realität vor, in der regelmäßige Flugreisen zum Leben dazuzugehören scheinen, sei es das Wochenende zum Junggesellenabschied auf Mallorca oder der Besuch von Freunden auf Bali.
Laut einer Studie lassen sich 75 Prozent der befragten Personen von den sozialen Medien zu einem Urlaub inspirieren.8 Zugleich ist vor allem für die Generation Z und die Millennials das Teilen von Fotos und Videos demnach ein immer wichtigerer Grund, eine Reise anzutreten. Neben Freunden und Familie sorgen also mittlerweile auch die Medien dafür, dass sich Flugreisen als soziale Norm in der Gesellschaft etablieren.
»Soziale Normen lassen sich verändern. Es liegt daher auch an uns, welche Richtung wir einschlagen.«
Die Wissenschaft zeigt allerdings, dass Normen auch umkehrbar sind oder sich verändern lassen: So hat etwa die Bereitschaft, freiwillige Zahlungen zum Ausgleich von CO2-Emissionen zu leisten, in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Bereits 2013 wiesen Forschende in einer Studie nach, dass die soziale Norm des engeren Umfelds der Teilnehmenden, bei Flugreisen einen CO2-Ausgleich zu leisten, für eine höhere Kompensations- als auch Zahlungsbereitschaft sorgte.9 Soziale Normen prägen unser Verhalten. Und so können auch wir das Verhalten anderer mit beeinflussen. Es liegt an der Politik, aber auch an uns, welche Richtung wir einschlagen. Doch obwohl die meisten die Gründe für und die Auswirkungen des Klimawandels kennen und etwas dagegen tun wollen, ändern nur die wenigsten ihr Verhalten. Zwar geben 40 Prozent der Europäerinnen und Europäer an, am ehesten auf Flugreisen zu verzichten, um den Klimawandel zu bekämpfen, und vor allem junge Menschen legen oft großen Wert auf Klimaschutz.10 Doch gerade die Gruppe der unter 30-Jährigen fliegt von allen Altersgruppen am häufigsten. Auch Anhänger der Grünen fliegen öfter als Mitglieder anderer Parteien. Wie passt das zusammen?
»Es ist anstrengend, Gewohnheiten zu verändern und dem Verhalten des eigenen Umfelds zu trotzen.«
Unter kognitiver Dissonanz versteht man das unangenehme Gefühl, das entsteht, wenn Verhalten und Einstellung nicht zueinander passen. Das gilt auch für die dritte Flugreise im Jahr, obwohl uns der Klimawandel Sorgen bereitet. Es gibt viele Strategien, um diesen inneren Widerspruch aufzulösen. Das Verhalten tatsächlich zu ändern, gehört dabei zu der schwierigsten: Es ist anstrengend, Gewohnheiten zu verändern und dem Verhalten des eigenen Umfelds zu trotzen. Viel eher neigen wir dazu, den Widerspruch kleinzureden, uns abzulenken oder zu rechtfertigen. Denn „alle anderen fliegen ja auch” und „das Flugzeug hebt auch ohne mich ab”. Der Schaden, bei Flugreisen ohnehin nicht direkt selbst erlebbar, wird so argumentativ minimiert und das eigene Handeln rationalisiert, um eine Übereinstimmung mit dem Selbstbild zu bewahren. Der innere Konflikt wird aufgelöst, ohne tatsächlich etwas am eigenen Verhalten zu ändern.
Gleichzeitig ist es gerade bei weiten Flugreisen schwer bis unmöglich, Alternativen zum Fliegen zu finden. Beruflich wie privat ist die Entscheidung für eine Flugreise in einer globalisierten Welt tatsächlich manchmal unumgänglich. Zugleich ermöglichen Fernreisen den Blick über den Tellerrand und sind für Bildung und Austausch nicht zu unterschätzen. Aber sie sollten wohlüberlegt sein und ein Luxus bleiben: Schließlich gibt es Alternativen für Kurzstreckenflüge und Zugverbindungen durch ganz Europa – wenn auch bisher noch nicht in dem Umfang und zu Preisen, die das Bahnfahren tatsächlich zu einer Alternative zum Fliegen machen würden.11
Zugleich gilt es, auf verbindliche staatliche und internationale Regulierungen hinzuarbeiten, denn das Engagement von Fluggesellschaften für Klimaschutz fällt bescheiden aus und eine Eigeninitiative der Branche ist kaum zu erwarten. Um klimaneutral zu werden, muss Deutschland endlich aufhören, klimaschädliche Industrien systematisch zu bevorteilen. Stattdessen sollte die neue Bundesregierung das Problem angehen und auf globalen Regelungen bestehen. Angesichts der derzeitigen Kräfteverhältnisse im Land scheint dies jedoch utopisch – umso mehr sind zivilgesellschaftliche Initiativen wie klimapolitische Bewegungen gefragt, Druck auf die Regierung auszuüben.
Ein tiefgreifender Wandel ist allerdings nur möglich, wenn sich gleichzeitig auch unser Wertesystem ändert. Steuern oder Subventionen allein werden langfristig nicht helfen, wenn sich nicht auch die öffentliche Meinung zum Thema Fliegen ändert. Wir brauchen neue Narrative, die den Hype ums Fliegen hinterfragen, Alternativen aufzeigen und sich nicht an den Wünschen einer wohlhabenden Minderheit orientierten, sondern beschreiben, wie wir als Gesellschaft in einer Welt mit begrenzten Ressourcen gut leben können. Soziale Werte können Veränderungen anstoßen und haben das Potenzial, den Weg für echten Wandel zu ebnen.
1 Berechnet auf dem Portal atmosfair.de.
2 Tens of thousands at increased risk of diabetes, high blood pressure and dementia due to airport pollution, aef.org.uk, 25.6.2024.
3 Vgl. Umweltschädliche Subventionen in Deutschland, umweltbundesamt.de, 2021.
4 Report: The real price of flying, cedelft.eu, März 2024.
5 Millionen Tonnen Treibhausgase durch Privatjets, tagesschau.de, 12.1.2023.
6 Tobias Hungerland u.a., Innovative Antriebe und Kraftstoffe für einen klimaverträglicheren Luftverkehr, publikationen.bibliothek.kit.edu, 8.5.2024.
7 The Aviation Industry Lobbying and European Climate Policy, influencemap.org, 6/2021.
8 American Express Travel, 2023 Global Travel Trends Report, americanexpress.com, 2023.
9 Context effects and heterogeneity in voluntary carbon offsetting – a choice experiment in Switzerland, tandfonline.com, 10.10.2013.
10 Europäische Investitionsbank, Worauf würden Sie für das Klima verzichten?, EIB-Klimaumfrage 2020–2021 (2/3), eib.org, 2021.
11 Vgl. Lena Donat, Grüne Bahn-Renaissance: Im Nachtzug nach Europa?, in: „Blätter“, 7/2021, S. 9-12.